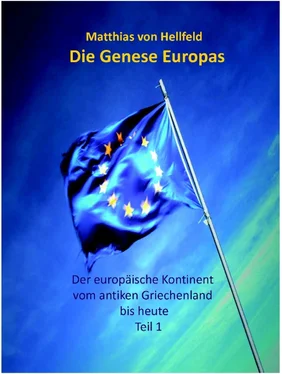Bis in die Mitte des fünften vorchristlichen Jahrhunderts haben die Griechen von Europa also zunächst eine mythische Vorstellung – nämlich die der von Zeus nach Kreta verbrachten phönizischen Prinzessin. Dann ist eine vage geographische Idee von Europa als einem Raum zwischen spanischer Südküste und Schwarzem Meer hinzugekommen. Bei Herodot tritt eine dritte Vorstellung hinzu: Europa als Identitätskategorie, die aus griechischer Sicht das Eigene gegenüber den asiatisch-persischen Feinden abgrenzt. Eine etwas andere Variante dieser Vorstellung findet sich bei dem als Arzt berühmt gewordenen Hippokrates von Kos (460 – 370 v. Chr.). Nach Monika Franz hat er den Europäern „Mut, Liebe zu Freiheit und Angriffslust“ zugesprochen, während er den Asiaten „Begeisterung für den Krieg und die Kunst“ sowie „Weichheit und Antriebslosigkeit“ zuschreibt. Als Ursache für diese merkwürdige Unterscheidung führt der Arzt die klimatischen Bedingungen an, die nach seiner Ansicht prägend für die jeweiligen Charaktere seien. Aus der mythologischen Europavorstellung ist binnen relativ kurzer Zeit ein Kampfbegriff geworden, der die eigenen Lebensvorstellungen überhöht und die der anderen verteufelt.
Die Hegemonialstellung Athens hat den Dualismus mit Sparta zur Folge, der ab 431 v. Chr. zum Peloponnesischen Krieg führt. Auslöser ist die harte Hand, mit der Athen den attisch-delischen Seebund führt. Die Mitglieder müssen hohe Tribute zahlen, mit denen teilweise der prunkvolle Ausbau Athens finanziert wird. Immer wieder kommt es zu lokalen Aufstände und Unruhen, die 431 v. Chr. von Sparta zu einem Überfall genutzt werden. Einem Plan von Perikles (490 – 429 v. Chr.) folgend verbarrikadieren sich die Bürger Athens in ihrer Stadt, während sie ohnmächtig miterleben müssen, wie ihr Land verwüstet wird. Zwei Jahre später bricht in der Stadt eine Typhus-Epidemie aus, an der viele Tausend Stadtbewohner sterben - unter ihnen auch Perikles. Am Ende der Epidemie ist die Athener Bevölkerung um ein Drittel dezimiert. 421 v. Chr. wird ein Friede geschlossen, nachdem auf beiden Seiten jene die Mehrheit verloren haben, die für eine Fortsetzung des Krieges plädieren. Der attische Heerführer Nikias (ca. 470 – 413 v. Chr.) handelt den später als „faul“ bezeichneten Frieden aus. Er soll den „Status Quo ante“ auf 50 Jahre festschreiben, also die beiderseitigen Besitzstände vor Beginn des Peloponnesischen Krieges bewahren. Aber die Ursachen des Konfliktes werden nicht beseitigt, so dass dieser Friede nicht lange hält und noch im gleichen Jahr gebrochen wird. Kurz danach folgt ein schwerer Schlag für die attische Flotte, sie erleidet 413 v. Chr. eine vernichtende Niederlage vor Sizilien. Damit beginnt der Anfang vom Ende der Hegemonie Athens.
Denn ein Jahr später schließt Sparta ein Militärbündnis mit dem alten Feind Persien und ist damit dem delisch-attischen Seebund deutlich überlegen. Als Folge dieser neuen Lage wird in Athen die Demokratie gestürzt und durch einen oligarchischen „Rat der 400“ ersetzt. Aus der Herrschaft aller, wird eine Herrschaft einiger. In diesen Putsch sind persische Unterhändler, ein athenischer Heerführer namens Alkibiades (451 – 404 v. Chr.) sowie diverse Kommandeure des attisch - delischen Seebundes verwickelt. Ihnen erscheint die militärische Lage nach der misslungenen Sizilienexpedition und der erfolgreichen Besetzung einer Festung auf attischem Gebiet durch Sparta derart verheerend, dass sie ihr Heil in einem Umsturz suchen. In Athen werden die bis dahin funktionierenden demokratischen Institutionen aufgelöst und die politischen Akteure nach Hause geschickt. Aber der Spuk ist nach vier Monaten wieder beendet. Durch eine Art Konterrevolution wird die Demokratie in Athen wieder hergestellt.
Dennoch ist das Ende Athens nicht mehr aufzuhalten, es kommt nach der Belagerung der Stadt durch spartanische Truppen 404 v. Chr. Die Menschen in den Stadtmauern leiden nicht nur unter den Entbehrungen, die sich in einer von der Außenwelt abgeschnittenen Stadt zwangsläufig ergeben. Sie haben obendrein Angst, man würde mit ihnen genauso brutal umgehen, wie ihre Soldaten es mit besiegten Gegnern gemacht haben. Derartige Torturen bleiben ihnen zwar weitgehend erspart, aber die Friedensbedingungen der Spartaner sind hart: Neben Tributzahlungen und der Reduzierung der einst so stolzen athenischen Flotte auf zehn Schiffe, übernimmt ein tyrannisches Regiment die Herrschaft in Athen. Die Stadt wird geschliffen und gedemütigt: Athen muss die Hegemonie Spartas dadurch anerkennen, dass die Stadt nebst allen Verbündeten in den Peloponnesischen Bund unter der Führung Spartas eintritt. Fast 30 Jahre hat der Krieg in Hellas getobt, zigtausend Soldaten sind den Kämpfen zum Opfer gefallen, Kultanlagen und antike Städte sind zerstört worden. Nun tritt Sparta an die Stelle Athens als Hegemonialmacht auf dem griechischen Festland. Aber die spartanische Herrschaft beschwört durch ihre ungewöhnliche Härte Widerstand herauf, der die griechische Welt instabiler macht.
Alle Macht den Philosophen!
Neben den ersten demokratischen Schritten hat das antike Griechenland den europäischen Kontinent durch die Philosophie geprägt. Ausgangspunkt für die griechischen Philosophen ist das Nachdenken über die antike Welt mit dem Ergebnis, dass Zweifel über den damaligen Wissens- und Erkenntnisstand angebracht sind. Der Zweifel befördert das Denken über Alternativen und ist dadurch zu einem Akt der Selbstbefreiung des Menschen von herrschenden Überzeugungen geworden. Indem der Mensch zu denken beginnt und seine Umwelt in Frage stellt, entfernt er sich von den Fesseln überirdischer Erklärungen, deren heidnisch-kultische Rituale ihm bis dahin eine Erklärung der Welt geliefert haben. Mit dem Zweifel an den Erklärungen über den Sinn des irdischen Lebens tritt der Mensch in den Mittelpunkt des Denkens. Sein Leben soll nun mit den Möglichkeiten der Vernunft und nicht länger mit dem Verweis auf göttliche Vorsehung erklärt werden. Damit steht auch das „von den Göttern“ geschaffene gesellschaftliche „Ordnungssystem“ auf dem Prüfstand. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass die attische Demokratie den Rahmen geschaffen hat, in der sich die Philosophie hat entfalten können. Und umgekehrt ist die Demokratie in gewisser Weise auch die Fortsetzung der Philosophie gewesen, denn deren Ideen können in einem demokratischen Rahmen in der Praxis erprobt werden.
Das Nachdenken über den Sinn des Lebens, aus dem sich im Laufe der Zeit eine zusammenhängende Philosophie entwickelt hat, findet in Athen öffentlich und zwar im Dialog statt. Dichter und Denker bringen dem Publikum in großen Amphitheatern philosophische Fragen nahe. In öffentlichen Lesewettbewerben treten zwei Philosophen im Wettstreit um die bessere Lösung eines Problems gegeneinander an. Dabei werden die Diskutanten aufgefordert, eine Angelegenheit nicht nur von einer Seite zu betrachten. Die Kunst des richtigen Debattierens besteht in Athen darin, die Argumente des Anderen in Betracht zu ziehen und zu werten. So entsteht eine den europäischen Kontinent prägende „Kultur der Freiheit“ mit der ernsthaften Bereitschaft sich selber und die Welt der Götter, die bis dahin den Lauf der Dinge erklärt haben, radikal in Frage zu stellen – so der Gedanke des Althistorikers Christian Meier. Diese Art des öffentlichen Lebens verträgt auf Dauer keine aristokratische Gesellschaftsordnung oder die Herrschaft eines Einzelnen. Die Demokratie ist die einzige politische Ordnung, in der sich die griechische Philosophie ausbreiten und fortentwickeln kann. Dabei kommt es den Griechen zu Gute, dass sie inzwischen eine regelrechte Fest- und Feierkultur entwickelt haben. Diese Kultur sorgt dafür, dass sich griechische Philosophie in Theatern und Streitgesprächen, auf der Straße oder in Bibliotheken in Rede und Gegenrede entwickelt. Aus der Vielzahl der Philosophen und Denker der griechischen Antike ragen drei heraus, die das Denken Europas bis heute maßgeblich beeinflussen: Sokrates, Platon und Aristoteles.
Читать дальше