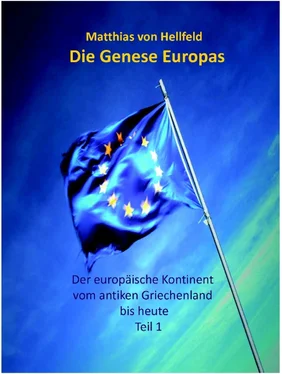Aber angesichts der hohen Kosten und des Imageschadens, der sich für das nahezu insolvente Athen im restlichen Attika abzeichnet, zählt die Schönheit dieser Bauwerke bald nichts mehr. Auch die Tatsache, dass in der Regierungszeit von Perikles das Bildungswesen erheblich verbessert worden ist, die meisten Athener nun lesen und schreiben können und in riesigen Theatern mitunter Tage lang die Finessen zeitgenössischer Dramaturgie vorgeführt bekommen, hält man ihm nicht länger zu Gute.
15 Jahre, so lange wie niemand vor ihm, fungiert Perikles als Stratege. Er ist der militärisch Verantwortliche, der „erste Bürger Athens“, der die Geschicke der Stadt mit großem Erfolg gelenkt hat. Als er aber in zunehmende Bedrängnis gerät, bringt er Athen auf einen neuen außenpolitischen Kurs, der in einer Konfrontation mit Sparta mündet. Der Verlauf des Peloponnesischen Krieg zwischen Athen und Sparta ist der Anfang vom Ende nicht nur des großen Reformers Perikles, sondern das Ende der Blütezeit Athens.
Perikles ist zweifellos einer der bedeutendsten Staatsmänner des antiken Athens gewesen. Er hat entscheidenden Anteil am Auf- und Ausbau der Demokratie, auf die sich heute noch die europäische Welt beruft. Einschränkend sei auf ein Zitat des griechischen Schriftsteller Thukydides (ca. 454 – 396 v. Chr.) hingewiesen, der den beeindruckenden Satz geprägt hat, die athenische Demokratie sei nur dem Namen nach eine solche gewesen, in Wirklichkeit habe es sich um die „Herrschaft des ersten Mannes“ gehandelt. Aber von jenem Thukydides ist auch überliefert, wie stark das Selbstverständnis der attischen Bevölkerung in jenen Jahren von zentralen Demokratiebegriffen wie Freiheit, Gleichheit, Selbstlosigkeit, Überparteilichkeit oder Weltoffenheit geprägt gewesen ist. Ein Ensemble von Werten, von denen die modernen europäischen Demokratien immer noch geformt werden.
Die Ursprünge der Demokratie liegen in Griechenland, genauer formuliert in der attischen Polisgesellschaft und dem von Athen dominierten Teil des griechischen Festlands. Das antike griechische Demokratieverständnis beruht auf der bis heute richtigen Einsicht, dass das Allgemeinwohl aus der aktiven Teilnahme der Bürger am Leben seiner Polis entsteht. Heute würden wir eher von der Zivilgesellschaft reden, die sich im öffentlichen Raum Gehör verschafft, wenn es um das Gemeinwohl geht – von der Umgehungsstraße bis zur Ampel vor einer Schule. Die moderne Demokratie am Beginn des 21. Jahrhunderts ist weiter entwickelt – zum Glück, sonst wären Frauen und weniger Begüterte womöglich immer noch von ihr ausgeschlossen. Aber die Tatsache, dass durch die Solon’schen Reformen das Individuum in den Mittelpunkt gestellt worden ist, finden wir rund 2.000 Jahre später in der Renaissance, der Aufklärung und schließlich in unseren westlichen Demokratien wieder. Welch eine Nachhaltigkeit einer Idee!
Bildung steht bei den antiken Griechen hoch im Kurs. Wer gebildet ist, kann über die öffentlichen Angelegenheiten mitreden und mitentscheiden. Das hat sich über die Jahrhunderte fortgesetzt: Gebildete genießen immer hohes Ansehen. Damals wie heute sind viele Menschen bestrebt, sich weiter zu bilden, mehr Wissen anzuhäufen und über mehr Dinge Bescheid zu wissen, als es für die Bewältigung des eigenen Lebens vielleicht unbedingt notwendig ist. Im 15. Jahrhundert entsteht in Europa der Humanismus. Er wird sich ausdrücklich auf die griechische Antike berufen und in dem allseits gebildeten Menschen das Ideal schlechthin erblicken. Nur der gebildete Mensch sei in der Lage, lebenswichtige Entscheidungen zu treffen, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein oder kulturelle Schaffenskraft zu entwickeln. Platons Satz „Der Mensch ist das Maß aller Dinge“ wird die Leitplanke der Humanisten und vieler anderer Geistesströmungen werden.
Das gemeinsame kulturelle Erbe Europas aus der griechischen Antike ist eben auch die Erkenntnis, dass Bildung ein wesentlicher Teil des menschlichen Lebens ist. Jeder kann und sollte gebildet sein. Im Mittelalter ist es unter französischen oder deutschen Gelehrten wichtig gewesen, die lateinische und griechische Sprache zu beherrschen. Nur so haben sie von einer Universität zur nächsten wechseln können, weil sie gewusst haben, dass sowohl die Lehrer als auch die Studenten diese Sprachen beherrschen. Es ist durchaus schade, dass uns eine gemeinsame Sprache in Europa verloren gegangen ist – wie viel einfacher wäre dann ein Einigungsprozess unter den Europäern.
Dennoch hat Europa aus Griechenland eine ungeheure kulturelle Vielfalt geerbt. Auf ihr basiert alles, was nach dem Ende der griechischen Antike kommen soll. Insgesamt ist Europa von drei Kulturkreisen beeinflusst – oder aus ihnen entstanden. Der erste griechisch-hellenistische Kulturkreis hat sich nach den Feldzügen Alexanders „des Großen“ vom Balkan über das spätere oströmische Reich bis weit in den Orient hinein erstreckt. Der zweite ist der slawische Kulturkreis - meist islamisch geprägt und sowohl asiatischen als auch abendländischen Einflüssen ausgesetzt. Er ist bis heute in einigen südost- oder osteuropäischen Ländern zu bewundern. Der römisch-germanische Kulturkreis ist der dritte im Bund. Hier tritt das griechisch-römische Erbe an die Wiege Europas. Dieser Mix macht die Vielfalt Europas ebenso aus wie sie eine Klammer für alle Europäer bildet. Die Europäer sind Kinder dieser Kulturkreise, die in dieser Dichte und in diesem Reichtum nicht so oft auf der Welt anzutreffen sind. Die gegenseitigen kulturellen Verflechtungen, die sich daraus ergebenden besonderen Strukturen in Europa sind keineswegs Ausdruck des „alten“ – nahezu untergehenden Europas, wie es einmal der offenbar einseitig „gebildete“ amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld (1932) in gründlicher Unkenntnis der europäischen Geschichte gesagt hat. Im Gegenteil: Dieses Erbe ist der charakterisierende Wesenszug des europäischen Kontinents.
Grenzen der Polisdemokratie
Die Polisdemokratie hat bei einer relativ kleinen Bürgerschaft funktioniert. In seiner Blütezeit haben etwas mehr als 150.000 Menschen in Athen gelebt – für damalige Verhältnisse eine wahrhaft gigantische Metropolis. Nicht alle von ihnen sind frei und damit im Vollbesitz politischer Rechte gewesen. Von den 60.000 Männern unter den 150.000 Einwohnern dürften nur etwa 30.000 Vollbürger gewesen sein. Frauen, die zugereisten Arbeitskräfte (Metöken) und Sklaven sind von den Bürgerrechten ausgeschlossen und können an der Polisdemokratie nicht teilhaben. Unveräußerliche Menschenrechte wie das Recht auf Meinungsfreiheit oder das Recht auf Opposition sind in der Antike unbekannt. Im antiken Athen ist die Gleichheit vor dem Gesetz nicht identisch mit der Gleichheit an individuellen Rechten. Der Einzelne ist Mitglied der athenischen Polis, in der er frei und gleich ist. Seine politische Freiheit besteht im Rederecht in der Volksversammlung oder in den gleichen Zugangschancen zu Ämtern. Man kann die damaligen Bürgerrechte nicht mit den heutigen vergleichen, aber die heutigen basieren auf diesen ersten Versuchen.
In der Wirtschafts- und Sozialpolitik herrscht die pure Ungleichheit. Die Familien sind streng hierarchisch organisiert, der Mann ist der "Despot" und hat uneingeschränkt das Sagen. Wirtschafts- und Sozialpolitik gehört nicht zu den Themen der Volksversammlung. Eine Politik, die sich dem Ausgleich sozialer und ökonomischer Unterschiede im Zeichen sozialer Gerechtigkeit verschrieben hätte, gibt es in der attischen Demokratie nicht. Durchsetzung und Entfaltung der attischen Demokratie beruhen auf Bedingungen, die nicht vergleichbar sind mit modernen Demokratien von heute. Die Entwicklung der Demokratie im antiken Athen wird nicht selten durch äußere Einflüsse vorangetrieben. Der Flottenausbau zieht einen enormen Bedarf an Ruderern nach sich, der nur aus den Reihen der Besitzlosen gedeckt werden kann. Deren Forderung nach größerer Teilhabe an den „öffentlichen Angelegenheiten“ muss als Gegenleistung für Kriegsdienste erfüllt werden.
Читать дальше