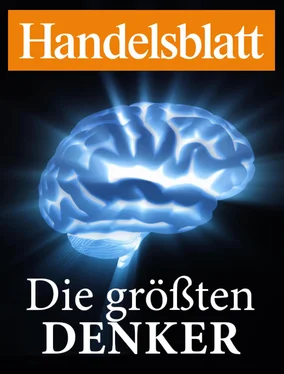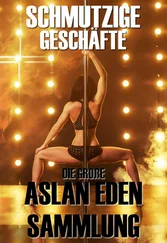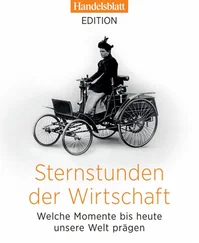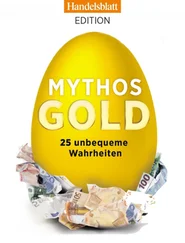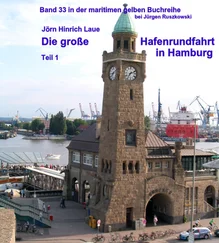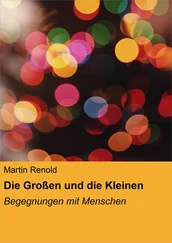Irgendwann Anfang des neuen Jahrtausends ist Lanier klar geworden, dass die Technik die Welt nicht nur zum Besseren verändert. "Ich bin enttäuscht, welchen Weg das Internet in den vergangenen zehn Jahren genommen hat", sagte Lanier schon vor drei Jahren. Im Interview mit dem Handelsblatt ergänzte er: "Die ursprüngliche Idee des Internets war: Jeder konnte alles hochladen und alles sehen, was er will. In der Theorie ist das wahr. Aber in der Praxis hat es sich zu einem von Unternehmen kontrollierten Ort gewandelt."
Lanier kritisiert, dass wenige große Konzerne wie Google oder Facebook das Internet quasi kontrollieren und damit alle Macht auf sich vereinen. "Nur die Menschen, die die Maschinen kontrollieren, konzentrieren den Reichtum auf sich und alle anderen scheitern. Es entsprich ziemlich genau den Ängsten des 19. Jahrhunderts, frühen Science-Fiction-Autoren wie H. G. Wells. Wenn man den Maschinen zu viel Macht gibt, dann nimmt man sich selbst logischerweise Macht weg", sagt er.
Der 54-Jährige ist der Ansicht, dass wir gerade "eine feudale Gesellschaft schaffen, in der die Schlösser die größten Computer sind". Damit meint er Unternehmen, die weltweit die größten Server betreiben und unglaublich viele Daten sammeln, er nennt sie Sirenenserver.
"Jeder, der so einen besitzt, kann das Verhalten von allen anderen lenken und bestimmen. Und die Menschen werden schleichend immer ärmer. Es ist in einer soften Art genau das, was in der Geschichte immer wieder bei der Konzentration von Macht geschehen ist", fürchtet Lanier.
Seine Vision beschreibt er gerne mit dem Beispiel der Übersetzungssoftware. Sie sei sehr nützlich für uns, aber sie bediene sich bei den echten Übersetzern. Millionenfach werden täglich Übersetzungen digital ausgewertet. Damit wird die Arbeit der menschlichen Übersetzer einerseits schleichend überflüssig und andererseits wird ihnen der Lohn für ihre Mühen versagt. Laniers Lösung: Die Übersetzer müssen dafür bezahlt werden.
Der Internet-Kritiker fragt weiter: "Man denke an Facebook, das erste große öffentliche Unternehmen dieser Art, das von einem einzigen sterblichen Individuum kontrolliert wird. Facebook steuert heute zum großen Teil die Muster sozialer Verbindungen in der ganzen Welt. Doch wer wird seine Macht erben? Steckt in diesem Dilemma nicht eine neue Art von Gefahr?"
Für den Denker Lanier ist die Antwort ganz klar Ja. Denn Unternehmen wie Facebook oder Google, die versuchen Nutzerverhalten zu analysieren und sogar zu lenken, sind Hebel einer Gefahr, die ihn sorgt. "Wenn es eines gibt, das mich am Internet ängstigt, dann dies: Es ist ein Medium, das ‚Flashmobs‘ auslösen kann und regelmäßig schlagartig ‚virale‘ Trends schafft", sagt Lanier. Zwar hätten diese Effekte bisher noch keinen größeren Schaden angerichtet. "Aber was haben wir im Gegenzug, um sie zu verhindern? Wenn Generationen heranwachsen, die sich großenteils über globale korporative Cyber-Strukturen wie geschützte soziale Netzwerke organisieren und austauschen, woher wissen wir, wer die Kontrolle über diese Strukturen erbt?"
Die Gefahr in der neuen Technik liegt für Lanier darin, dass sich der Mensch zu sehr aufgebe. "Ich hatte immer das Gefühl, dass der Ansatz in der Computerwissenschaft, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, zu mehr interessanten, exotischen, wilden und heldenhaften Erlebnissen führt als der Ansatz der Überlegenheit der Maschinen, bei dem Informationen das höchste Ziel sind", sagte Lanier einmal.
Die Informationen, die sich in Big Data ansammeln, würden nun genutzt, um zu versuchen, den Menschen zu lenken und vorauszuberechnen. Das freilich sei nicht einmal eine einseitige Entwicklung, vorangetrieben ausschließlich von den Konzernen. Der Mensch lasse es geschehen. Dabei lehnt Lanier Big Data nicht ab: "Ich bin kein Gegner von Big Data. Ich habe vielmehr einige Zeit an Big Data gearbeitet. Ohne deren Analyse wüssten wir zum Beispiel bei weitem nicht so viel über die Veränderungen des Klimas. Big Data ist nicht nur von großem Nutzen, sondern eine Frage des Überlebens."
Doch im Silicon Valley sei die Computerwissenschaft für manche zur Religion geworden, bemerkt Lanier. "Manch einer glaubt, wir sind auf dem Weg zu einer vollkommenen Gesellschaft, wir haben mit dem Internet den Schlüssel zur Perfektion."
Die einflussreichsten Technologieexperten in den Unternehmen würden denken, dass wir auf dem Weg zur Unsterblichkeit sind, weil Computer und Menschen äquivalent sind, und dass Computer so schnell werden, dass sie erst mit dem menschlichen Hirn gleichziehen und es dann überholen werden. "Wir werden dann quasi in die Computer hochgeladen. Das Superhirn wird irgendwann die Menschlichkeit überwinden."
Eine irre Vorstellung für Lanier.
Für "Wem gehört die Zukunft?" hat Jaron Lanier den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2014 bekommen. Auch in den USA wurde Lanier gefeiert: Die "New York Times" nannte sein Buch das wichtigste des vergangenen Jahres. Mit seinen Publikationen hat sich Lanier einen Namen als Internet-Philosoph gemacht.
Der 54-Jährige kritisiert in seinen Büchern die digitale Welt, ist aber selbst seit den Anfängen des Internets dabei. Er hat für fast alle großen Computerkonzerne gearbeitet, war an vier Start-ups beteiligt und gründete Anfang der 1980er-Jahre VPL Research - das erste Unternehmen, das Produkte der virtuellen Realität verkaufte. Seine Leidenschaft gilt der Musik. Er spielt Klavier sowie diverse historische Instrumente - und tritt damit auch auf.
MARTHA NUSSBAUM: Die Einheitvon Fühlen und Denken
Die amerikanische Philosophin passt in kein Klischee. Sie analysiert juristische und soziale Probleme - auf Grundlage einer ausgefeilten Theorie, die den Zusammenhang zwischen Rationalität und Emotionen beschreibt. Von Frank Wiebe
Heute trägt sie modische Stiefel - keine Stöckelschuhe, obwohl sie die nach eigenem Bekenntnis mag. Ihre Haare sind blondiert und die Fingernägel blau lackiert. Martha Nussbaum passt in kein Klischee - auch nicht in das einer feministischen Philosophin. Dabei ist sie genau das: eine Philosophin, die sich für Frauenrechte starkmacht.
Sie befürwortet zum Beispiel das neue Gesetz Kaliforniens, das unter der Formel "Yes is Yes" bekannt geworden ist und speziell für die Universitäten gilt. Danach kann ein Mann nur dann davon ausgehen, dass eine Frau Sex will, wenn sie ausdrücklich zugestimmt hat. Hintergrund dieser Regelung sind Skandale, bei denen betrunkene Studenten und Studentinnen Sex hatten und hinterher unklar war, ob der einvernehmlich war oder nicht. Hintergrund sind aber auch, wie Nussbaum betont, Gerichtsurteile, bei denen Frauen vorgehalten wurde, selbst in offensichtlich bedrohlichen Zwangs-Situationen nicht deutlich genug Nein gesagt zu haben.
Auf der anderen Seite tritt Nussbaum für die Legalisierung der Prostitution ein - sie ist also mindestens so liberal wie feministisch. Und tritt damit einer großen Zahl von Feministinnen auf die Füße - zum Beispiel denen, die in Schweden mit durchgesetzt haben, dass die Kunden von Prostituierten sich strafbar machen. Auch in religiösen Fragen ist sie eher liberal und pragmatisch als feministisch. Zu der Frage, ob man Mädchen zum Schwimmunterricht im Badeanzug zwingen soll, wenn sie damit gegen religiöse Auflagen verstoßen, sagt sie: "Man kann auch mit langen Gewändern schwimmen, das haben sie im viktorianischen England auch gemacht."
Sex, Gewalt, Toleranz - das sind nur drei der vielen Themen, mit denen sich die Philosophin beschäftigt, für die Philosophie immer schon mehr als eine akademische Beschäftigung war. In ihren zahlreichen Werken zeigt sie die gedankliche Schärfe der analytischen Philosophie, die bis heute, wenn auch mit abnehmender Strahlkraft, das herrschende Konzept ihres Fachs ist. Aber sie verbindet sie mit einer gründlichen Kenntnis der antiken Quellen - sie hat ihr Studium mit den alten Sprachen begonnen, und man merkt fast jeder ihrer zahlreichen Schriften an, dass sie in den Klassikern zu Hause ist. Außerdem schöpft sie tief aus der Literatur- und der Musikgeschichte.
Читать дальше