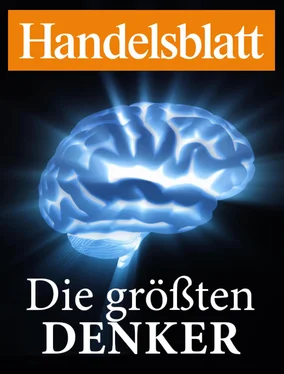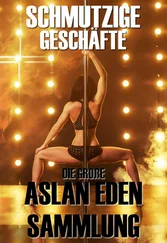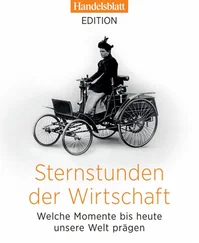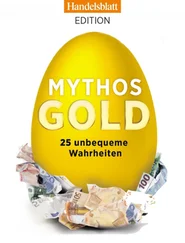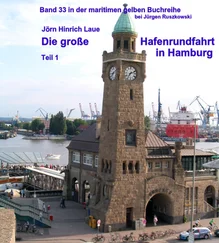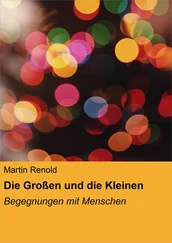Treibende Kraft für die aktuelle Neuordnung ist Chinas Aufstieg zur Weltmacht. Die Volksrepublik hat Deutschland als Exportweltmeister bereits abgelöst - und wird in wenigen Jahren die USA wirtschaftlich überholen. Damit gewinnt auch das chinesische Modell einer autoritären Marktwirtschaft an Attraktivität im Systemwettbewerb mit den westlichen Demokratien. Ob wirtschaftlicher Fortschritt dauerhaft ohne politische Freiheit zu haben ist, ist damit jedoch noch nicht gesagt. Allerdings tun sich pluralistische Gesellschaften wie in den USA und Europa ungeheuer schwer, den erreichten Wohlstand ihrer Bürger zu erhalten. Das Unbehagen über die ungleiche Verteilung zwischen Gewinnern und Verlierern der Globalisierung wächst, der soziale Kit bröckelt. "Wir stehen vor einer Zeitenwende", sagt der Historiker Ferguson.
Die Macher spüren, dass "machen" alleine nicht mehr reicht. So gab US-Präsident Obama dem britischen Premier David Cameron den Tipp: "Das Wichtigste in unserem Job ist, sich während des Tages viel Zeit zum Nachdenken zu nehmen." Ein Blick in die Terminkalender von Top-Managern und Spitzenpolitikern zeigt jedoch, dass dafür kaum Platz ist. "Die heutigen Vorstandschefs sind meist 20 Tage im Monat unterwegs", sagt Jeffrey Sonnenfeld von der Yale School of Management, "wer soll angesichts dieser Reisestrapazen auf der Höhe der Zeit sein?" Ein gutes Urteil entstünde durch Nachdenken und dafür brauche man Zeit, sekundiert der Personalberater Tony Schwartz vom Energy Project.
Was für eine Ironie: In unserer Wissensgesellschaft haben wir immer weniger Zeit zum Nachdenken. Oder wir nehmen sie uns nicht, weil uns die tägliche Informationsflut atem- und kopflos macht. Wieder einmal ist die Technologie Segen und Fluch zugleich. Es gibt heute fast keine Branche, kein Unternehmen und keinen Arbeitsplatz mehr, der nicht von der Digitalisierung betroffen wäre. Die Wissenschaftler Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee von der amerikanischen Eliteuniversität Massachusetts Technology Institute haben dieses Doppelgesicht des technischen Fortschritts in ihrem Bestseller "The Second Machine Age" akribisch beschrieben. Demnach wird das Zusammentreffen von Big Data, Robotik und künstlicher Intelligenz unser Berufsleben im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf stellen - und zwar mit zunehmender Geschwindigkeit.
Ihr Fazit ist so faszinierend wie beängstigend: Unterm Strich werde die Bilanz der digitalen Revolution positiv ausfallen. Viele alte Jobs würden zwar überflüssig, aber es entstünden auch viele neue Arbeitsplätze. Die Übergangsphase der schöpferischen Zerstörung unseres Arbeitslebens könne allerdings mehr als ein Jahrzehnt dauern. Die Frage ist, wie wir diesen Übergang so sozialverträglich gestalten, dass uns dabei nicht unsere gesellschaftliche Ordnung um die Ohren fliegt.
"Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns?" Mit diesen existenziellen Fragen beginnt Ernst Bloch in den 30er- Jahren des vorigen Jahrhunderts seine berühmte Trilogie "Das Prinzip Hoffnung". Einige dieser Fragen werden heute wieder gestellt, weil immer mehr alte Gewissheiten erschüttert werden. Viele versuchen, die ungewisse Zukunft durch ausgetüftelte Prognosen zu überholen. Spätestens seit John Maynard Keynes wissen wir jedoch: Die Zukunft ist prinzipiell unsicher. Das Einzige, was wir dagegen tun können, ist, aus der Vergangenheit zu lernen, um unsere Gegenwart besser zu verstehen.
Die 25 Denker, die wir in den kommenden Wochen vorstellen, werden nicht auf alle Zukunftsfragen eine Antwort geben können. Aber sie bieten Denkanstöße für ganz verschiedene Fragen unseres Lebens und provozieren uns so zum Mit- und Nachdenken. Bei den meisten findet sich dabei jenes Prinzip Hoffnung, das Bloch beschworen hat. Ohne dieses Prinzip Hoffnung werden wir die vor uns liegenden Herausforderungen nicht meistern können.
NASSIM NICHOLAS TALEB: Der Philosoph, der das Chaos ordnet
Ob das Auftreten für unmöglich gehaltener Ereignisse oder der permanente Wandel unseres Seins: Niemand beschreibt die Unsicherheit unserer Welt besser als der Multi-Intellektuelle. Von Michael Maisch
Wer Leben und Sterben des Truthahns kennt, der hat im Prinzip auch Nassim Nicholas Taleb verstanden. Insofern eignen sich wenige Momente im Jahr so gut für eine Auseinandersetzung mit diesem intellektuellen Multitalent wie die Tage rund um den amerikanischen Feiertag Thanksgiving. Das Fest, an dem die ganze Nation Truthähne verspeist.
Also sitzt Taleb schon am frühen Morgen dieses Tages in seinem Arbeitszimmer in einem New Yorker Vorort und sagt: "Ich weiß schon jetzt, dass ich heute zu viel essen werde." Mit Mitleid aber darf das Tier nicht rechnen - nicht von Taleb, wie er unzählige Male erklärt hat. Denn das unabwendbare Schicksal des Federviehs ist eine der bevorzugten Metaphern, mit denen der Denker seine großen Themen erklärt: Unsicherheit, Zufall, Volatilität und unsere Unfähigkeit, damit umzugehen.
Die tumben Tiere stehen in Talebs Welt für Borniertheit und Kurzsichtigkeit. Der Vogel wird tausend Tage lang vom Metzger gefüttert, bis kurz vor Thanksgiving. Wäre der Vogel Chefanalytiker in einem Unternehmen oder in der Politik, dann hätte er bis dahin mit "wachsender statistischer Zuversicht" verkündet, dass Metzger aufrichtig am Wohlergehen aller Truthähne interessiert seien. Dabei hätte das Tier allerdings einen entscheidenden Fehler gemacht: Der Vogel verwechselt die Abwesenheit eines Beweises für Gefahr mit dem Beweis der Abwesenheit von Gefahr. Und so kommt der Tag, an dem sich die Truthahn-These vom Metzger als bestem Freund als fataler Fehlschluss erweist.
Taleb hat bereits drei Karrieren erfolgreich gestemmt: Er war Wall-Street-Händler, Bestseller-Autor und ist heute einer der anerkanntesten Intellektuellen unserer Zeit. Die Bücher des 54-Jährigen eklektisch zu nennen wäre eine Untertreibung. Völlig ungeniert bedient er sich bei Philosophie, Ökonomie, Soziologie, Mathematik und Statistik, verknetet das Ganze und würzt die Mischung mit einer reichlichen Prise Alltagsbeobachtungen. Herausgekommen ist dabei zuletzt sein Opus Magnum, "Antifragilität", eine Art universeller Gebrauchsanweisung für eine Welt, die immer undurchschaubar und unberechenbar bleiben muss.
Neben dem Truthahn steht dafür ein weiterer Vogel: der "schwarze Schwan". 2007, kurz vor Ausbruch der Finanzkrise, veröffentlichte Taleb ein Buch mit diesem Titel. Darin beschreibt er kaum vorhersehbare, sehr seltene Ereignisse mit extremen Folgen: Thanksgiving für den Truthahn oder die Pleite der Investmentbank Lehman-Brothers, die beinahe das globale Finanzsystem in den Abgrund gerissen hätte.
Der titelgebende Vogel bezieht sich auf ein Theorem der Wissenschaftstheorie. Der Satz "Alle Schwäne sind weiß" kann nie absolut wahr sein. Selbst wenn seit Menschengedenken jeder einzelne Schwan blütenweiß war, reicht ein einziges schwarzes Exemplar, um das Weißheits-Gesetz zu widerlegen.
Taleb macht eine Reihe von Fehlleistungen dafür verantwortlich, dass wir mit "schwarzen Schwänen" nicht umgehen können. So gehen wir davon aus, dass der strukturierte, berechenbare Zufall auch die großen entscheidenden Einschnitte im Leben und in der Geschichte bestimmt. Tatsächlich steckt hinter schwarzen Schwänen aber eine unstrukturierte Klasse von Unsicherheit.
Außerdem sitzen wir dem Irrtum auf, dass sich die Zukunft mit Vergangenheitsdaten vorhersagen lässt. Und schließlich "erfindet" der Mensch Geschichten, mit denen sich im Nachhinein Ereignisse als zwangsläufig erklären lassen, doch diese Erklärungen funktionieren eben nur ex post.
Mehr als drei Millionen Mal verkaufte sich der "Schwarze Schwan" weltweit. Die "Sunday Times" wählte das Werk des Autors mit libanesischen Wurzeln unter die zwölf einflussreichsten Bücher seit dem Zweiten Weltkrieg. Lorbeeren, die bei Taleb gemischte Gefühle auslösen: "Je mehr Leute meine Bücher lesen, desto mehr sind dabei, die sie eigentlich nicht lesen sollten." Am Ende habe der Erfolg ihn nur gezwungen, "zu viel mit der Außenwelt zu interagieren".
Читать дальше