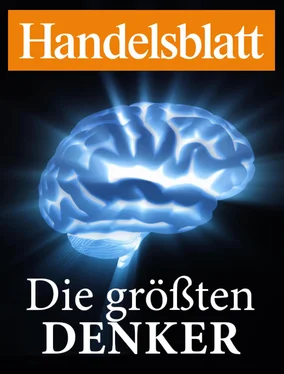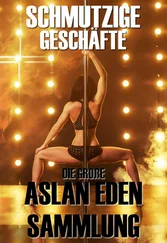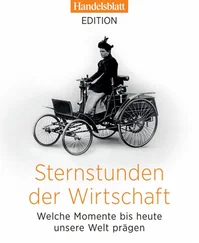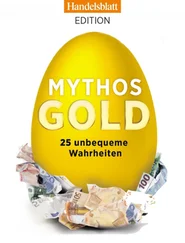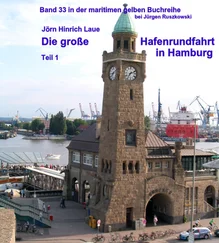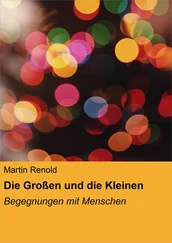Sein Schlüsselerlebnis als Wissenschaftler hatte Kahneman, als er Ende der 60er-Jahre den etwas jüngeren Psychologen Amos Tversky kennenlernte. Tversky war ein Pionier in der kognitiven Psychologie und beschäftigte sich mit ähnlichen Fragen wie sein Kollege. Aus der Begegnung ergab sich für beide eine überaus fruchtbare, jahrzehntelange Zusammenarbeit. In langen Gesprächen und Gedankenexperimenten überprüften die beiden Wissenschaftler nahezu täglich ihre Thesen. "Meinen Nobelpreis erhielt ich für die Arbeit aus dieser intensiven Kooperation", sagt Kahneman noch heute voller Dankbarkeit für seinen 1996 verstorbenen Freund.
Zum Abschied bleibt eigentlich nur eine Frage: Wie schafft es jemand, der sich sein Leben lang mit den Schwächen des menschlichen Geistes beschäftigt hat, ein möglichst fehlerloses Leben zu führen? Die verblüffende Antwort: "Ich bin in meinem Privatleben nicht wirklich meinen Erkenntnissen als Wissenschaftler gefolgt." So gab es nur eine einzige Entscheidung, die er zuvor professionell durchdacht habe, sagt Kahneman. "Bei dem Kauf meines Hauses habe ich zeitgleich die Einrichtung bestellt. Wenn man nämlich erst das Haus und dann die Einrichtung kauft, wird das Mobiliar meist zu billig ausfallen."
Daniel Kahneman wurde 1934 in Tel Aviv als Sohn litauischer Juden geboren, verbrachte seine Kindheit jedoch im von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich. Später studierte er Psychologie und Mathematik in Jerusalem und lehrte danach als Professor in Berkeley und Princeton. Die jüdische Tradition des Gossips lieferte ihm den Rohstoff für die Erforschung des menschlichen Geistes. Er ist mit der Psychologin Anne Treisman in zweiter Ehe verheiratet.
Kahneman wurde 2002 für seine neue Erwartungstheorie (Prospect Theory) mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Damit schuf er eine Alternative zu der bis dahin dominierenden rationalen Entscheidungstheorie. Er gilt als einer der Begründer der modernen Verhaltensökonomie.
JARON LANIER: Warnung vor dem Superhirn
Der Autor, Informatiker und Unternehmer ist ein Veteran des Internets. Dennoch ist Jaron Lanier einer der größten Kritiker der Tech-Konzerne. In seinem Denken steht nicht die Maschine im Mittelpunkt - sondern der Mensch. Von Grischa Brower-Rabinowitsch
Man sollte sich davor hüten, Jaron Lanier falsch zu verstehen. Was leicht passieren kann. Denn Lanier ist einerseits ein Oldtimer des Internets und der Computertechnik, schon von seinem zotteligen Äußeren her der typische Nerd. Doch anders als die meisten Nerds hat Lanier einen abweichenden Weg eingeschlagen: Er kennt die Entwicklungen des Internets und die Gedanken seiner Macher wie kaum ein zweiter; er ist vom Segen der digitalen Revolution überzeugt. Und dennoch ist Lanier einer der schärfsten Kritiker dieser Entwicklung - so gefährlich für die Mächte des Digitalen, weil so kundig. Im Mittelpunkt seines Denkens steht nicht die Maschine, sondern der Mensch.
Und der Mensch, das ist das Grundthema seiner beiden bedeutenden Bücher "You are not a Gadget" und "Who owns the Future", gibt sich der Technik zu sehr preis, er glaubt zu sehr an die Wahrhaftigkeit dessen, was der Computer ausspuckt. "Die Menschen sind zu maschinenhörig geworden", sagte Lanier vor wenigen Monaten im Interview mit dem Handelsblatt.
Der US-Experte hat sich mit seinen beiden Büchern und diversen Aufsätzen sehr kritisch mit dem Internet und der digitalen Welt auseinandergesetzt. Seine Thesen sind auf den ersten Blick scheinbar technikfeindlich. Doch er hat sich nicht gegen das Internet gewandt, er hat sich nicht gegen die Technik gewandt, sondern dagegen, was Menschen daraus gemacht haben, und wie sie es nutzen, um Macht aufzubauen und zu missbrauchen. "Ich habe immer noch größere Freude an Technologie, als ich ausdrücken kann. Die virtuelle Realität kann Spaß machen und wunderschön sein", sagte Lanier in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an ihn vor wenigen Wochen.
Das für viele Menschen verstörende Element bei dem 54-jährigen Lanier ist, dass er Kritik an der virtuellen Realität übt, an der er selbst doch als einer der ersten Menschen mitgewirkt hat. Ihm wird sogar immer wieder zugeschrieben, den Begriff "Virtual Reality" geprägt zu haben. Doch Lanier lässt sich, wie viele andere "Visionäre" auch, nicht gerne in Schubladen pressen. Das Ungewöhnliche ist Teil seines Lebens und seines Denkens.
"Ich finde es für mich sehr wertvoll, nicht wie alle anderen zu sein, unabhängig zu denken. Das ist notwendig für jeden kreativen Menschen. Es hat mir geholfen, die Welt zu erschaffen, die ich nun kritisiere", formuliert er.
Lanier ist tief geprägt von der Geschichte seiner Familie, die ebenso außergewöhnlich ist. Seine Mutter Lilly war eine Pianistin, Malerin und Tänzerin, die ein Konzentrationslager überlebte und mit 15 Jahren aus Wien in die USA emigrierte. Sein Vater Ellery war das Kind ukrainischer Juden, der als Architekt, Maler, Schriftsteller und Lehrer arbeitete. Beiden Eltern hatte die Nazizeit in Europa schlimmes Leid zugefügt. Eine Tante seines Vaters, erzählte Lanier in seiner Rede zur Buchpreisverleihung, "war ihr Leben lang stumm, nachdem sie als kleines Mädchen nur überlebt hatte, weil sie vollkommen still unter einem Bett ausharrte, während ihre ältere Schwester vor ihr durch ein Schwert getötet wurde. Von der Familie meiner Mutter in Wien sind viele, viele in den Konzentrationslagern umgekommen."
"Und nach all dem bin nur noch ich übrig", sagte Lanier weiter, denn sein Vater ist kürzlich gestorben. Seine Mutter hatte Lanier bereits verloren, als er zehn Jahre alt war. Sie starb bei einem Autounfall.
Seine Eltern hatten die Erlebnisse der Nazizeit tief verunsichert. Kurz nach der Geburt von Jaron gaben sie ihren eigentlichen Nachnamen Zepel für den weniger jüdisch klingenden Lanier auf. Sie wählten den Namen nach Sidney Lanier, einem Poeten und Flötisten des 19. Jahrhunderts. Und Lilly und Ellery gaben ihr Leben in der Künstlerszene von New York auf, nahmen ihren kleinen Sohn und zogen nach Texas. "Ich glaube, sie haben gedacht ‚Wir haben jetzt ein Kind, lass uns weit weg gehen, lass uns uns verstecken‘", sagte Lanier.
Sein Elternhaus war für den jungen Lanier ein einziger Fundus an Interessantem. Seine Mutter hatte ihm das Klavierspiel beigebracht, bei seinem Vater fand er außergewöhnliche Bücher. "Sie hatten Tonnen von bizarren, aufregenden Dingen", erklärt der Autor. So wie er selbst heute auch. Lanier hat zum Beispiel mehr als tausend rarer Instrumente gesammelt, die er alle spielt. Die Musik ist neben der Technik seine zweite Leidenschaft. Doch auch in der Musik sucht er das Außergewöhnliche. Einige seiner historischen, altertümlichen Instrumente verlangen hohen körperlichen Einsatz, man spielt sich die Finger blutig.
Die Musik spielte auch eine Rolle bei Laniers Karrierestart in der Tech-Welt, der Entwicklung des ungewöhnlichen Videospiels "Moondust" für den Commodore 64 im Jahr 1983. Bei dem Kulthit, das erste Kunst-Videogame, erzeugten die Bewegungen des Joysticks einen Soundtrack. Das Spiel brachte ihm einen Job bei der Computerfirma Atari ein und ihn später mit dem Programmierer Tom Zimmerman zusammen. Die beiden gründeten 1985 die Firma VPL, die erste aus dem Bereich "Virtual Reality". Sieben Jahre später brach sie zusammen. Komplexe virtuelle Welten zu entwickeln hatte sich als schwieriger herausgestellt als gedacht.
Nach einigen Monaten, in denen er sich unter anderem in New York seiner Musik widmete, heuerte er als wissenschaftlicher Chef der Firma Eyematic in Los Angeles an, die Algorithmen entwickelte, mit denen ein Computer menschliche Gesichter erkennen und verfolgen kann. Google kaufte die Firma 2006, Lanier ließ sich ausbezahlen und arbeitet seitdem unter anderem für Microsoft Research, wo er wieder an Tools für virtuelle Welten forscht.
Читать дальше