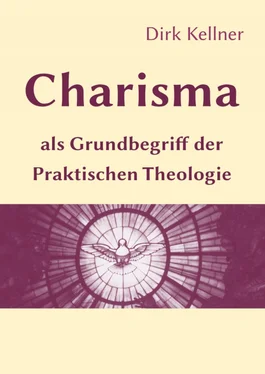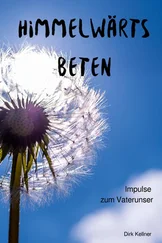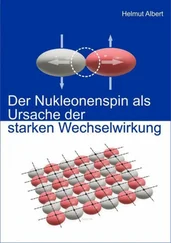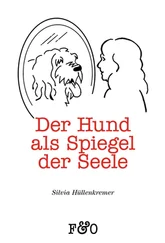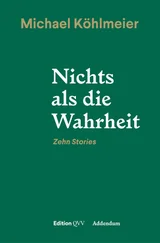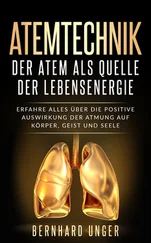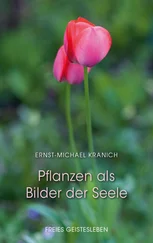2.3.3 Hans Küng, Gotthold Hasenhüttl und Jürgen Moltmann: Dogmatische Besinnung auf die charismatische Grundstruktur der Kirche
Die exegetischen Impulse wurden in den 60er Jahren vor allem von katholischen Dogmatikern aufgenommen und in die kontroverse Debatte um ekklesiologische Grundsatzfragen eingebracht – am umfassendsten und pointiertesten von Hans Küng und Gotthold Hasenhüttl.[296]
Hans Küng nimmt in seinem umstrittenen Buch «Die Kirche»[297] (erste Auflage 1967) die Herausforderung an, «die bleibende charismatische Struktur der Kirche von der paulinischen Ekklesiologie her zu erhellen»[298]. Küng nennt und überwindet drei «Mißverständnisse des Charismas», die bisher seine grundlegende Bedeutung für Theorie und Praxis der Kirche verdunkelt hatten.
«Die Charismen sind nicht eine primär außerordentliche, sondern eine alltägliche, sind nicht eine einförmige, sondern eine vielförmige, sind nicht eine auf einen bestimmten Personenkreis beschränkte, sondern in der Kirche ganz und gar allgemeine Erscheinung. Und dies alles heißt zugleich: sie sind nicht nur eine damalige […], sondern eine höchst gegenwärtige und aktuelle, sind nicht nur eine periphere, sondern eine höchst zentrale und wesenhafte Erscheinung in der Kirche.»[299]
Bestimmen die Charismen die Kirche in ihrem Wesen und in ihrer Grundstruktur als Geistgeschöpf, so muss man nach Küng «von einer charismatischen Struktur der Kirche reden»[300]. Die kirchliche Ämterstruktur ist der charismatischen Struktur nicht als das eigentliche Konstitutivum übergeordnet, sondern bildet einen «bestimmten Aspekt der allgemeinen, grundlegenden charismatischen Struktur der Kirche»[301] und ist ihr als «diakonische Struktur»[302] dienend eingebettet. Ihre Besonderheit liegt darin, dass die charismatische Berufung «nicht willkürlich kommt und geht», sondern «in einer bestimmten Stetigkeit mit bestimmten Personen verbunden bleibt».[303]
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt zwei Jahre später (1969) Gotthold Hasenhüttl, der «vom Blickwinkel des Dogmatikers historisch untersuchen [will], welche Bedeutung der Begriff Charisma für die Struktur der Gemeinde hat».[304] In seiner umfassenden Monographie «Charisma» (1969) lehnt er die Vorstellung ab, das Charisma sei eine «vorübergehende Erscheinung», die «nur für die Anfangszeit der Kirche galt»,[305] und versteht es als «Ordnungsprinzip der Kirche» (so der Untertitel), das die Kirche in ihrem Wesen und ihrer Grundstruktur bestimmt. Er kommt zu der Schlussfolgerung:
«Die Gemeinde würde ihre Grundstruktur aufgeben, würde sie nicht von den Charismen leben […]. Charismatische Grundstruktur der Kirche bedeutet, daß jeder seinen Platz in der Gemeinde hat, der ihm durch die Vollmacht geschenkt ist, daß dieser Platz der Ort ist, an dem er durch sein Charisma gestellt wurde, und daß er gerade an diesem Ort Kirche mitkonstituiert […]. Ordnung in der Gemeinde ist nur möglich durch die charismatische Grundstruktur, die jedem seine Stelle offenhält.»[306]
Wie Küng versteht Hasenhüttl die kirchlichen Ämter als «zweite Form der Berufung» neben der allen Christen geltenden charismatischen Berufung. Diese ist ebenfalls charismatisch zu verstehen, aber «nicht vorübergehend, sondern auf Dauer gedacht»[307]. Sie formt die «Ordnungsstrukturen der Kirche»[308], welche eine gewisse Notwendigkeit haben, aber als «Hilfsstrukturen»[309] der charismatischen Grundstruktur der Kirche zu- und untergeordnet sind.
Küng und Hasenhüttl widersprechen in ihren Erörterung nicht nur der vorkonziliaren katholischen Ekklesiologie, die das Wesen der Kirche in der kirchlichen Hierarchie begründen und den Charismen weithin als «eine Art Luxus der übernatürlichen Ordnung» und «eine geheimnisvolle Ergänzung» zur Bekräftigung der urkirchlichen Missionspredigt verstehen.[310] Sie gehen auch bewusst über die Beschlüsse des zweiten Vatikanischen Konzils hinaus, bzw. wollen sie «nach vorne interpretieren»[311]. In ihnen seien zwar, zum Teil erst nach kontroversen Diskussionen,[312] bemerkenswerte Aussagen über die bleibende Bedeutung der Charismen für die Kirche aufgenommen worden, allerdings werde, so ihre Kritik, das Charismatische als Grundstruktur der Kirche nicht deutlich genug der hierarchisch amtlichen Hilfsstruktur vor- bzw. übergeordnet.[313] Küng und Hasenhüttl berufen sich vor allem auf die berühmte Passage in LG 12/DH 4131:
«Derselbe Heilige Geist heiligt außerdem nicht nur das Volk Gottes durch die Sakramente und die Dienstleistungen, er führt es nicht nur und stattet es mit Tugenden aus, sondern ‹teilt den Einzelnen, wie er will› (1Kor 12,11), seine Gaben ( dona ) aus und verteilt unter den Gläubigen jeglichen Standes auch besondere Gnaden ( gratias quoque speciales ), durch die er sie geeignet und bereit macht, verschiedene für die Erneuerung und den weiteren Aufbau der Kirche nützliche Werke und Dienste zu übernehmen gemäß dem Wort: ‹Einem jeden wird der Erweis des Geistes zum Nutzen gegeben› (1Kor 12,7). Solche Gnadengaben ( charismata ), ob sie nun von besonderer Leuchtkraft oder auch schlichter und allgemeiner verbreitet sind, sind mit Dankbarkeit und Trost anzunehmen, da sie den Erfordernissen der Kirche besonders angepaßt und nützlich sind. Außerordentliche Gaben ( dona extraordinaria ) soll man aber nicht leichtfertig erstreben, noch soll man vermessen von ihnen Früchte für die apostolischen Bemühungen erwarten; vielmehr steht das Urteil über ihre Echtheit und geordnete Ausübung denen zu, die in der Kirche die Leitung haben und denen es in besonderer Weise zukommt, den Geist nicht auszulöschen, sondern alles zu prüfen und, was gut ist, zu behalten (vgl. 1Thess 5,12.19–21).»
In der evangelischen Dogmatik greift v.a. Jürgen Moltmann die Thematik auf und folgt im Wesentlichen den exegetischen Erkenntnissen Käsemanns.[314] Er bestimmt die Kirche als eine charismatische Gemeinschaft, in der die eschatologischen Lebenskräfte des Geistes an jedem und durch jeden Einzelnen wirken – und zwar gerade in der Konkretheit seines Lebens. Bekannt wurde die universale Tendenz, die er dem Begriff «Charisma» verlieh: «Leben ist überall begabt. Es gibt kein unbegabtes Leben.»[315] Auch das «behinderte Leben» ist als «Charisma» zu verstehen: «Jede Behinderung ist auch eine Begabung»[316]. Darüber hinaus hebt auch Moltmann das kritische Potential des Begriffs «Charisma» gegenüber der kirchlichen Wirklichkeit hervor: Er widerspreche der «Usurpation aller Ämter und Aufgaben durch eine Hierarchie ‹geistlicher Würdenträger› oder eine Aristokratie von Pastoren»[317].
2.3.4 Peter Zimmerling: Die charismatischen Bewegungen als (praktisch-) theologische Herausforderung
Die pfingstlerisch-charismatische Bewegung[318], der sich nach einem in der Kirchengeschichte einzigartigen Wachstum gegenwärtig fast ein Sechstel der gesamten Christenheit zurechnet,[319] ist von ihren Anfängen vor einem Jahrhundert bis heute durch das Auftreten spektakulärer Geistesgaben geprägt. Die Zungenrede erlangte bereits in der Erweckung innerhalb der Azusa-Street-Mission (Los Angeles) im Jahre 1905, dem «Ausgangspunkt der weltweiten traditionellen Pfingstbewegung»[320], die Bedeutung eines Beweises für die empfangene Geisttaufe. Sie gilt bis heute in den meisten Pfingstkirchen als «initial sign» der persönlichen Pfingsterfahrung.[321] Daneben erfahren andere spektakuläre Charismen wie Prophetie, Heilungen und Wundertaten eine besondere Wertschätzung und nehmen eine zentrale Rolle im Gemeindeleben ein. Besonders bei den Charismatikern der «Dritten Welle», z.B. John Wimber und C. Peter Wagner, werden die Zeichen und Wunder zur Evangelisationsmethode («power evangelism»).[322]
Die charismatische Bewegung, die sich Anfang der 60er Jahren als innerkirchliche Erneuerungsbewegung bildete, ist wie die traditionellen Pfingstkirchen und neopfingstlichen Gruppen durch die Wertschätzung und Praktizierung der neutestamentlichen Charismen gekennzeichnet. Die spektakulären Geistesgaben werden in ihr nicht abgelehnt, spielen aber eine weniger zentrale Rolle im Selbstverständnis der Bewegung. Sie werden in das charismatische Wirken des gesamten Leibes Christi in seinen unterschiedlichen Funktionen und Diensten eingeordnet. Die innerkirchlichen charismatischen Bewegungen «betonten von Anfang an nicht einzelne spektakuläre Geistesgaben, sondern die charismatische Dimension des Christseins als Ganzes und die ekklesiologische Ausrichtung der Charismen»[323]. Durch diese Zurückhaltung und Ausrichtung gewann die Bewegung Sympathien und Einfluss bei zahlreichen Vertretern der traditionellen Kirchen. So berichtet Pfr. Arnold Bittlinger, einer der Schlüsselfiguren der späteren «Geistlichen Gemeindeerneuerung» (GGE), von seiner Reise in die Vereinigte Staaten im Jahr 1962:
Читать дальше