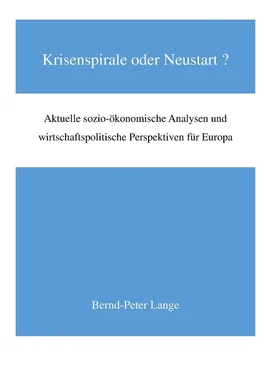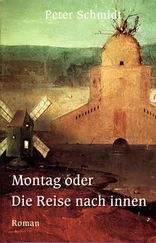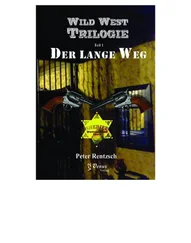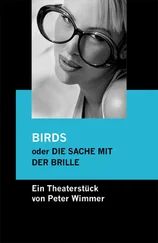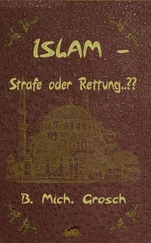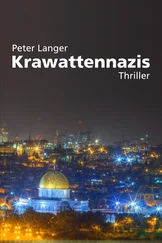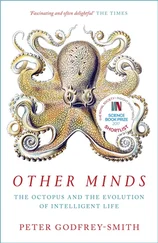In dieser Einführung gehe ich nicht systematisch - also z. B. von der Mikroökonomie über die Analyse der Marktformen hin zur Makroökonomie - vor, sondern schildere am Beispiel der krisenhaften Entwicklung seit 2007, was einen sozio-ökonomischen Ansatz leisten kann. Dabei werden verschiedene Aspekte der Krise analysiert: zunächst die internationale Finanzmarktkrise, sodann die Eurokrise in verschiedenen Ländern, dann die Staatsschuldenkrise und schließlich die Krise der Europäischen Integration mit den jeweiligen Querverweisen zwischen diesen Teilbereichen. Es geht darum, hinter den Erscheinungsformen z. B. von Bankenzusammenbrüchen bzw. -rettungen die Ursachen und Folgen zu ergründen und die kontroversen politischen Antworten darzustellen und nach ex- und impliziten Interessenpositionen und den jeweiligen externen Effekten zu bewerten. Vor dieser Folie sollen dann eigene Krisenvermeidungs- bzw. Bewältigungsstrategien zur Diskussion gestellt werden.
Als der Verfasser 1963 das wirtschaftswissenschaftliche Studium an der Universität Bonn aufnahm, lehrte Professor Krelle: "Vergessen Sie Krisen. Wir haben heute ein wirtschaftswissenschaftliches Instrumentarium, um einen gleichmäßigen, aufsteigenden Wirtschaftspfad zu steuern". Es war vom Beginn des "golden age" die Rede. Vergegenwärtigt man sich diese Prophezeiungen, so muss man sich fragen: Was ist in den herrschenden Wirtschaftswissenschaften falsch gelaufen?
Das Krisenparadigma setzt begriffsnotwendig als Gegenentwurf den "Normalzustand" wirtschaftlicher Entwicklung voraus: ausgeglichene Haushalte, angemessenes Wachstum, hohes Beschäftigungsniveau, stabile Währungen und nachhaltige europäische Integration. Aus historischer Perspektive ist zu fragen, ob der postulierte Normalzustand nicht auch ein Artefakt ist. Dann wäre Krisenbewältigung bzw. -vermeidung unter anderen Perspektiven zu diskutieren, als unter der der Rückkehr zu einer wie auch immer gearteten Normalität und Stabilität. Es wäre dann besonders nach gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Resilienz gegen allfällige Krisenschocks angesichts dynamischer wirtschaftlicher Entwicklung und kontinuierlichem gesellschaftlichem Wandel zu fragen.
Der Begriff der Krise enthält auch immer den Verweis auf die Chancen, die sie eröffnet: Chancen zu einem Neustart, die die Krisenerfahrung eröffnet. Diese Publikation weist bei aller oft grundsätzlichen Kritik den Weg zu praktikablen, ordnungspolitisch begründeten Reformschritten.
In diesem Zusammenhang soll auch die Kritik der vorherrschenden Wirtschaftstheorie zur Krisenerklärung entfaltet werden mit deren Artefakt des homo oeconomicus, des immer rational handelnden Menschen sowohl als Konsument als auch als Investor als auch als Banker oder Unternehmer. Dabei wird auch das Postulat sich selbst regulierender Märkte - also ohne staatliche Intervention - einem Realitätscheck unterzogen.
Auf der Basis dieser beiden Analysestränge werden dann Strategien zur Überwindung der Krisen diskutiert auf breiter interdisziplinärer Basis: es geht um juristische Regulierung und ihre jeweilige Wirksamkeit, es geht um alternative wirtschaftspolitische Konzepte auf der Basis unterschiedlicher wirtschaftstheoretischer Ansätze und spezifischen gesellschaftlicher Interessen, es geht um gesellschaftspolitische Grundvorstellungen über das Verhältnis von wirtschaftlicher Macht und demokratisch legitimierter politischer Souveränität, es geht schließlich um die Perspektiven der europäischen Integration vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen.
Kontroverse Ansätze sollen jeweils zunächst dargestellt und sodann auf ihren ideologischen Hintergrund abgeklopft werden. Ideologien sind Argumentationsstränge, die Allgemeingültigkeit beanspruchen, tatsächlich aber spezifische Interessenpositionen absichern sollen.
Ziel dieser Analysen ist es
- die relevanten realen Vorgänge mit Hilfe eines sozio-ökonomischen Instrumentariums zu sezieren und ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen zu beschreiben,
- Ursachen und Wirkungszusammenhänge theoretisch zu erfassen und das heißt hinter den vielfältigen Erscheinungsformen wirtschaftlicher Entwicklungen nach Gesetzmäßigkeiten und Strukturen zu fragen,
- jeweils herauszuarbeiten, was politisch zur Krisenbekämpfung getan oder aber auch unterlassen wurde; dabei geht es auch darum zu ergründen, wem das Eine oder wem das Andere nützt.
- die notwendigen weiteren regulatorischen und politischen Reformschritte zu skizzieren;
- hierbei sollen so weit als möglich Erkenntnisse, die aus anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen fruchtbar gemacht werden können, verarbeitet werden.
Da es keine wertfreie Sozialwissenschaft gibt - schon die Auswahl der behandelten Themen stellt eine Wertentscheidung dar -, muss bei allen Analysen der jeweilige Wertehorizont so präzise wie möglich offengelegt werden. Hier spielen die im Grundgesetz verankerten Werte, wie z. B. das Selbstbestimmungsrecht jeder einzelnen Person gerade auch gegenüber mächtigen wirtschaftlichen Institutionen wie z. B. Banken, und das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, - so viel Markt wie möglich, so viel staatliche Regulierung wie nötig -, eine besondere Rolle. Hier geht es auch um die volle Entfaltung demokratischer Entscheidungen angesichts wirtschaftlicher Macht auf den verschiedenen Ebenen der Nationalstaaten, der EU und auf globaler Ebene. Die Frage lautet: Sind die institutionellen Arrangements auf diesen Ebenen bzw. ist ihr Zusammenwirken effizient genug, um global agierenden Banken und anderen Finanzinstitutionen wie Hedge Fonds - gerade auch in Bezug auf ihre engen Verflechtungen untereinander - einen festen ordnungspolitischen Rahmen vorzugeben? Sind demokratisch legitimierte Institutionen so durchsetzungsfähig, damit Krisen soweit als möglich vermieden werden können bzw. ihre negativen Auswirkungen nicht immer wieder die Allgemeinheit schwer belasten. Die weitere ordnungspolitische Frage auf der Basis eines Konzepts eines funktionsfähigen Währungsraumes lautet: Welche wirtschaftspolitischen Schritte sind erforderlich, um die Eurokrise, die von der Finanzkrise befeuert wurde, dauerhaft zu beenden. Damit zusammenhängend ist nach dem notwendigen Wertewandel in Politik und Gesellschaft auf der Basis des Konzepts von Generationengerechtigkeit zu fragen, um die weitere Ausbreitung der Staatsschuldenkrise zu stoppen. Schließlich ist zu klären, ob der weitere Weg zu vereinigten Staaten von Europa als Bundesstaat sui generis einen Ausweg aus der Krise der europäischen Integration darstellt und wenn ja, wie er konkret beschritten werden kann.
Der hier vertretene Wertehorizont geht also von der Priorität der Grundrechte und dem Demokratiegebot aus. Er orientiert sich an den ordnungspolitischen Grundentscheidungen des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft. Er speist sich darüber hinaus aus den Überzeugungen der friedensstiftenden Funktion der europäischen Integration.
Neben der interdisziplinären Anlage der Analysen geht es auch um einen vergleichenden Ansatz zwischen den Entwicklungen in den USA und der EU, dabei weiter differenzierend zwischen den Entwicklungen der einzelnen Mitgliedsländer.
Bei diesem Unterfangen ist eine unendliche Fülle von Materialien - Statistiken, Dokumenten, Gerichtsentscheidungen und Literatur - zu sichten und aufzuarbeiten. Dabei kann es nicht um Vollständigkeit gehen, sondern nur um eine Auswahl der für diese Analysen wesentlichen Unterlagen. Verweise auf einschlägige Literatur dienen auch als Anregungen zur vertieften eigenen Auseinandersetzung.
In Bezug auf über die Tatsachen wiedergebende Berichte hinausgehende mediale Einschätzungen ist Vorsicht geboten. Privatwirtschaftliche Medien neigen aus Gründen des Buhlens um Aufmerksamkeit zu negativen Schlagzeilen und zur Skandalisierung von Ereignissen. Wie oft ist schon in den vergangenen 5 Jahren das Ende der Euro Zone beschworen worden, wie oft stand die nächste Finanzkrise unmittelbar bevor, ohne dass diese "Berichte" seriös begründet waren. Es ist daher zwischen oft negativen "headlines" und oft medial vernachlässigten "trendlines", den positiven durchgängigen Entwicklungen, zu unterscheiden.
Читать дальше