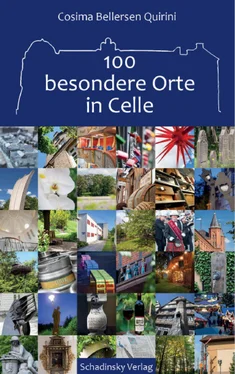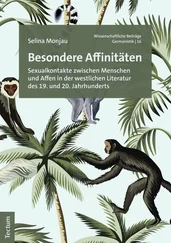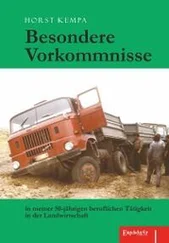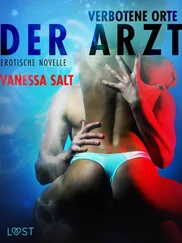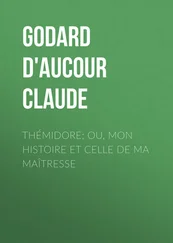Das Bomann-Museum ist ein Museum für niedersächsische Volkskunde und die Landes- und Stadtgeschichte Celles. Es ist das größte kulturgeschichtliche Museum in Niedersachsen. Gegründet wurde es 1892 als „Vaterländisches Museum“ mit Sitz in der Bergstraße. Sein Gründer und erster Museumsdirektor war Wilhelm Bomann, Spross einer Wollgarndynastie. Seine Leidenschaft galt dem Sammeln von bäuerlichen und städtischen Gebrauchsgegenständen. Das Museum wuchs rasch und bezog 1907 den Neubau am heutigen Standort am Schlossplatz. 1923 gab Bomann die Leitung des Museums ab, im gleichen Jahr wurde es auf seinen Namen umgetauft. Es umfasst Sammlungen zu Ur- und Frühgeschichte, zur Militär- und Landesgeschichte (u. a. Ehrenhalle der Hannoverschen Armee) sowie zur Handwerks- und Industriegeschichte, bäuerlichen Kulturgeschichte und bürgerlichen Kulturgeschichte der Stadt Celle. Außerdem besitzt es eine große Sammlung an Kostümen und Trachten. Neben moderner Kunst beherbergt das Museum außerdem die Stiftung Miniaturensammlung Tansey (siehe auch Seite 114), sowie die Eberhard-Schlotter-Stiftung.
Im Museum ist also sehr viel zu sehen, doch längst nicht alles! In der Regel finden weniger als zwanzig Prozent des Gesamtbestandes den Weg in Ausstellungen, der Rest wird sorgsam aufbewahrt. Mehrmals im Jahr öffnet das Depot seine Pforten und der Museumsdirektor führt durch die dem Publikum normalerweise verborgenen und nicht zugänglichen Hallen. Dann dürfen Sie Einblick nehmen und vom Geburtsstuhl bis zur Leichenkutsche restlos alles, was menschliches Leben in irgendeiner Form dokumentiert, entdecken.

14 Die sprechenden Laternen
Einzigartige Lichtart auf dem Globus
Wenn Sie in der Innenstadt plötzlich von einer Laterne mit der Stimme von Lilo Wanders angesprochen werden, dann befinden Sie sich zweifelsfrei in Celle! Nirgendwo auf der Welt ist es sonst bislang möglich, Laternen sprechen zu lassen. Legt die zweite Laterne auch los, erkennen Sie möglicherweise die Stimme von Stefan Westphal, der als Moderator und Autor bekannt ist. Der dritten Laterne hat Gerlach Fiedler, der Schauspieler, Schriftsteller und Synchronsprecher (unter anderem des „Krümelmonsters“ aus der Sesamstraße und 2010 verstorben), seine Stimme geliehen. Die vierte gehört zu Oliver Vollmering, vielen bekannt als Radiomoderator, die letzte zu einem Celler Jungen namens Jonas Pache-Brunsch, der bei einem Kinderstimmen-Casting für die kleine Laterne ausgewählt wurde. Lilo Wanders (eigentlich Ernst-Johann Reinhardt), bekannt als Schauspieler und Travestiekünstler, hat übrigens 1955 in der Landesfrauenklinik zu Celle das Licht der Welt erblickt. Sie/er war wohl das größte Baby, das je in dem Gebäude geboren wurde, nämlich 59 Zentimeter lang. (siehe auch S. 192). Fünf Laternen also, eine „Oma“ (Wanders), eine „Perfekte“ (Westphal), eine „Dicke“ (Gerlach), ein „Langer Lulatsch“ (Vollmering) und ein „Kind“ (Pache-Brunsch) bilden das ungewöhnliche Laternen-Quintett, welches Leuten, die in seine Nähe kommen, freudig und beredt Geschichten über Celle erzählt. Die Idee dazu entstand im Rahmen der LICHTART und wurde zum Jubiläum „150 Jahre Gaslaterne“, unterstützt durch viele Sponsoren, umgesetzt. Die Laternen, auch als Lichtfiguren betitelt, stehen seit 2008 in der Celler Altstadt. Sie haben einen Metallkorpus und einen leuchtenden Kopf mit dem typischen „Laternenhut“ der frühen Gaslaternen des 19. Jahrhunderts. Witzig ist dabei auch die silhouettenhafte Darstellung der fünf Charaktertypen. Bewegungssensoren lösen die Redelust aus – entweder allein oder in Interaktion miteinander. Die Stimmen starten, sobald sich jemand in die Mitte der Laternengruppe stellt. In einem benachbarten Geschäftshaus ist die dafür notwendige Elektronik installiert, die per Zufallsgenerator eine der gespeicherten Geschichten auswählt. Nach Ende einer Sequenz kommt eine dreiminütige Pause, bevor die Stimmen erneut aktiviert werden können. Tagsüber erzählt sich das Quintett kurze Geschichten, Fakten oder Anekdoten über die Celler Altstadt und gibt auch mal witzige Sprüche zum Besten. Am Abend werden die vorübergehenden Passanten gern gegrüßt und mit einem Gutenacht-Ständchen beglückt. Zu besonderen Anlässen sprechen auch gelegentlich zwei der Laternen „live“. Dann versteckt sich einer der Sprecher in der Nähe und unterhält sich über Funk mit den Passanten. Gefertigt wurden die Laternen von den Hildesheimer Lichtdesignern Matthias Schiminski und Peter Schmitz. Die gesprochenen Texte stammen aus der Feder von Celler Bürgern.

15 Dammaschwiese und Thaers Garten
Über alte Schweineweiden und den Eselsweg
Will man der Historie Glauben schenken, ist die „Dammaschwiese“ bereits 1292 bei der Stadtgründung von Herzog Otto dem Strengen als Geschenk an die neuen Celler Bürger ausgewiesen worden. Hier durften sie sich von Arbeit und Alltag erholen und ihre Schweine weiden lassen, und in der Tat, das Gebiet an der Oberaller ist ein Idyll mitten im Stadtgebiet. Der Turm der Stadtkirche eint die angrenzenden Häuser mit dem träge dahinfließenden Fluss, der besonders von Ruderern gern für ihre Zwecke genutzt wird. Ausgedehnte Spaziergänge auf der „Seufzerallee“ (Celler Jargon) an den Tennisplätzen vorbei oder auf dem „Eselsweg“ führen am Wasser entlang. Dort finden Sie auch „Thaers Garten“, das ehemalige Wohnhaus, Landschaftspark und landwirtschaftliches Mustergut des Arztes (erste Massen-Pockenimpfung in Celle) Albrecht Daniel Thaer, der, 1752 in Celle geboren, heute als Begründer der modernen Landwirtschaft gilt. Der Legende nach ließ dieser den Weg entlang auf einem Eselskarren Milch in die Stadt transportieren, daher der Name. Das Haus selbst, ein eindrucksvolles Herrenhaus, hat eine wechselvolle Geschichte: Es war neben Wohnhaus einst auch Kaffeewirtschaft, Gasthaus mit Bierausschank und Tanzsaal, SS-Quartier und Schulungsheim, Reservelazarett und schließlich wieder ein Wohngebäude. Seit 2010 ist „Thaers Garten“ Sitz der Niedersächsischen Gedenkstättenstiftung, die es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken und ihre Lebensgeschichten zu bewahren.
An „Thaers Garten“ vorbei gelangt man in die Obere Allerniederung, ein abwechslungsreiches Naherholungsgebiet, das sich von der Stadtmitte aus ungefähr vier Kilometer südwärts bis nach Altencelle erstreckt. Seit 1848 ist die ehemalige Weide, die Dammaschwiese („Danne“ = Schweineweide) entwässert und wird im Winter zur Freude aller Eislaufliebhaber komplett geflutet. Ganz Celle ist dann auf dem Eis, ein beinah paradiesisch schöner und völlig ungefährlicher Spaß für die gesamte Familie ist garantiert, da das Wasser unter dem Eis kaum kniehoch ist. Egal ob man seine Runde im Sonnenlicht drehen möchte oder abends den Eishockeyschläger schwingen will – untermalt mit Musik, die Stände mit kulinarischer Versorgung im Blick und die Fläche von der Sonne bestrahlt oder bei Dunkelheit mit Flutlicht beleuchtet, beim Eislaufen auf der Dammaschwiese wird ein Wintermärchen wahr.

16 Der Celler Dickstiel
Was ein Apfel mit dem Heilpflanzengarten zu tun hat
Als Expo-Projekt im Jahre 2000 erschaffen, ist den meisten Menschen in Celle der Heilpflanzengarten längst ein Begriff. Auf 7.000 Quadratmetern zwischen Dammaschwiese und Wittinger Straße gelegen, zeigt er von März bis November über 300 verschiedene Pflanzen aus aller Welt. Mit oder ohne Führung, es ist ein Genuss, die wunderbar vielfältige Flora zu entdecken oder die angebotenen Themenfeste zu besuchen. Ein Rundgang führt zu Duft-, Gewürz-, Färber-, Kräuter- und Aromapflanzen, man kann sich dabei von Gift- und „Zauber“pflanzen berauschen lassen, mit Farbbeeten auseinandersetzen, die Pflanzen der Kneippschen-, der Leisener- oder der Hildegard von Bingen-Lehren studieren und einen Besuch in Laden und Café „KräuThaer“ erwägen. Diese gehören beide zum Ausbildungskonzept der zweijährigen Fachschule Albrecht Thaer, benannt nach dem Begründer der modernen Landwirtschaft, der 1752 in Celle das Licht der Welt erblickte. Die Fachschule zählt zur traditionsreichen Landfrauenschule, aus der die einzige „Fachschule für Landtourismus und Direktvermarktung“ in Deutschland hervorging. Die angebotenen Produkte sind größtenteils von den SchülerInnen im praktischen Unterricht ausprobiert und hergestellt worden. Was jedoch kaum noch jemand weiß: Celle ist eine alte „Apfelstadt“ und im Heilpflanzengarten stand bis vor kurzem noch – wie in vielen Privatgärten immer noch heute Vertreter stehen – ein Baum der feinen Apfelsorte „Celler Dickstiel“. Der „Celler Dickstiel“, mancherorts auch „Woltmanns Renette“ oder „Krügers Dickstil“ genannt, wurde um 1850 in Mecklenburg aus der Taufe gehoben und kam von dort aus nach Celle. Der Apfelbaum wächst bis zu vier Meter hoch, die Früchte gelten als ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsäpfel mit weißem Fleisch und würzig-blumigem Aroma – sehr fein, sehr süß, sehr saftig. Die mittelgroßen, eher runden Äpfel habe eine grüngelbe, leicht marmorierte Schale, die auf der Sonnenseite gestreift ist. Sie sind ab Oktober genussreif und können bis März gelagert werden. Die Früchte lassen sich auch gut zu Apfelmus oder -saft weiter verarbeiten. Wer einen neuen Garten anpflanzen möchte, sollte sich vielleicht überlegen, ob diese Apfelbaumsorte nicht gut hineinpassen würde, ebenso wie der einst in Celle gezüchtete „Schieblers Taubenapfel“, siehe auch S. 104. Beide Sorten sind im Handel noch zu bekommen. Der „Celler Dickstiel“ war übrigens 2002 Apfel des Jahres. Und wer keinen Garten sein Eigen nennen kann, dem mag der Heilpflanzengarten für manche Spaziergänge oder Ausflüge genügen – ein wunderbarer Ort nahe der Aller, in dem alljährlich im Herbst auch ein Apfelfest stattfindet.
Читать дальше