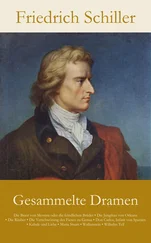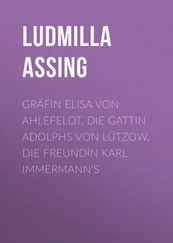»Werdet Ihr zurückkommen, mon capitaine? «
Tréville entging nicht die besondere Betonung, mit der d'Artagnan seinen alten Rang aussprach und beinahe hätte er flüchtig geschmunzelt. »Ich bin verbannt, in Ungnade.«
»Zu Unrecht!«
»Findet Ihr?«
D'Artagnan war zu aufgebracht, um auch nur kurz wegen der Frage in Zweifel zu geraten. »Ja! Mordieux , wer Euch als Verräter bezeichnet, ist selbst einer!«
»Achtet auf Eure Worte!« tadelte Tréville. »Das Haus mag menschenleer erscheinen, aber Ratten finden sich noch immer genug.«
»Sollen sie im Dreck wühlen und lauschen, ich fürchte sie nicht!«
»Dann seid Ihr dumm.« Der Hauptmann stieß sich vom Geländer ab, um der Treppe nach unten zu folgen. D'Artagnan zögerte, aber er war noch nicht von gleicher Melancholie gepackt wie Tréville. Mit wenigen, entschlossenen Schritten war er darum wieder an der Seite des Hauptmanns und sagte fest: »Es muss einen Weg geben, das zu verhindern.«
»Ihr werdet nichts unternehmen! Verstanden, monsieur le lieutenant? Das Wort des Königs ist Gesetz und Ihr habt noch immer eine glänzende Zukunft vor Euch.«
Die beiden Männer erreichten eine Nebenpforte, eine schmucklose Tür auf die Straße hinaus, vorgesehen für das Gesinde. Wie ein Dieb sollte sich der Hausherr nun also davonstehlen, Paris verlassen und nie mehr zurückkehren.
D'Artagnan wusste nichts mehr zu sagen. Alles wäre unangemessen und falsch gewesen, und so schwieg er bedrückt, während Tréville eine Kutsche bestieg. Eine Eskorte zu Pferd stand bereit. Sie würde sicherstellen, dass der Reisende sein fernes Ziel in der Gascogne erreichte.
»Viel Glück.« grüßte Tréville zum Abschied.
D'Artagnan murmelte der anfahrenden Kutsche ein: »Euch auch.« nach und blieb dann allein mit seiner glänzenden Zukunft zurück.
Der Herbst des Jahres 1640 hielt mit dunklen, trüben Aussichten seinen Einzug in Paris. Zäher Nebel kroch durch die Straßen, drang in jede Ritze, durch jeden Spalt und tastete mit klammen Fingern nach Mensch und Tier. Die Sonne hielt sich mit schweren Wolken bedeckt, kein Wind regte sich und so gesellte sich der ohnehin schon drückenden Stimmung noch der unausrottbare Gestank aus Pisspötten, Latrinen und dem Unrat auf den Straßen hinzu.
Die Seine führte nach einem heißen Sommer wenig Wasser, der Fluss war braun verschlammt und träge, Unaussprechliches trieb unter den Brücken dahin. Die ganze Stadt schien auf ein erlösendes Unwetter zu warten, das den Dreck, den Abfall und die Ratten endlich fortspülen würde.
Während die Wolkendecke über Paris grau drohte, ohne tatsächlich Regen zu bringen, ertrank der Kammerdiener Gustave Moraut in einem Trog. Mit den Händen suchte er Halt, rutschte ab, bäumte sich auf und wurde noch tiefer mit dem Gesicht ins Wasser gedrückt. Luftblasen stiegen auf, als er instinktiv in Panik schrie und sein Leben damit um wertvolle Sekunden verkürzte.
Plötzlich wurde er am Schopf zurückgerissen, spuckte Wasser und rang nach Luft. Auf den Knien liegend, den Kopf brutal in den Nacken gezogen, konnte er seine Peiniger nicht sehen. Nur kalte, dunkle Steinmauern, feucht, bemoost; seit Wochen sein Gefängnis.
Man herrschte ihn an: »Wo ist sie?!«
Er hustete, nässte sich ein und weinte. Wieder wurde sein Kopf in den Trog gedrückt. Dieses Mal dauerte es länger, denn jetzt schrie er nicht und sparte die Luft. Das machte es schlimmer, denn sie warteten, bis seine Lungen brannten und er Wasser atmete. Er starb, wurde gnadenlos ins Leben zurückgezerrt und erbrach sich.
Wieder ins Wasser, ohne eine Frage vorher. Morauts Körper wehrte sich noch immer, wollte um sich schlagen und sich befreien, wollte in Todesangst überleben. Der Schmerz stach bis tief in seine Brust, als man ihn zum unzähligen Mal kurz vor dem Ertrinken aus der Hölle riss.
»Ich weiß es nicht!« schrie er zur Kerkerdecke hinauf und man schlug ihn zu Boden. Vor den Stiefeln der Wachen, der Folterer, rollte er sich zusammen, spuckte Wasser, keuchte und wimmerte: »Weißesnicht, weißesnicht...«
*~*~*~*~*
»Gustave Moraut.«
Der Name stand in der ersten Zeile des Berichts. Rochefort kannte den Inhalt auswendig und fasste ihn jetzt für seinen Dienstherrn zusammen. »Bis vor wenigen Wochen einer der Diener hier im Palais Cardinal , jetzt im Gefängnis.«
»Ich erinnere mich, Graf.« Die Stimme des Ersten Ministers von Frankreich hatte etwas schneidendes, ungeduldiges. Einen Unterton, den sein Stallmeister selten bei Richelieu gehört hatte und der ihn hieß, sofort zum Kern des Berichts zu kommen.
»Auch nach der peinlichen Befragung weiß er nicht, wo sie ist.«
Der Kardinal zeigte mit keiner Regung, was er davon hielt. Ob ihn der Bericht überraschte oder ob er damit gerechnet hatte. Richelieu behielt seine Gedanken für sich, während er vom Fenster seines Arbeitszimmers aus hinunter auf den Cour d'Honneur , den Innenhof, blickte. Seine Miene war angespannt und bleich, die Wangen eingefallen und von Krankheit gezeichnet. Doch sein Blick war wach und durchdringend, der Geist trotzte dem geschwächten Körper. Er hatte die Hände hinter dem Rücken ineinander gelegt.
Als geübter Beobachter von Details bemerkte Rochefort die Tintenflecken an den Fingerspitzen des Kardinals. Auf dem Schreibtisch lag das Manuskript vom Politischen Testament. Klar verfasste Überlegungen, kein Wort, kein einziger Satz war durchgestrichen und von einer anderen Formulierung in der Entstehung ersetzt worden. Die letzten Federstriche trockneten noch, Richelieu hatte daran gearbeitet, als der Stallmeister das Kabinett betreten hatte.
Rochefort hatte die Denkschrift in den letzten Tagen oft dort liegen gesehen; wahrlich ein Testament, denn auch wenn der Erste Minister sich nichts anmerken ließ, sich nicht schonte, war es dieser Tage um seine Gesundheit nicht gut bestellt. Die Vernunft erhob er zur obersten Disziplin für einen Fürsten, vielleicht wuchs das Manuskript jetzt schneller auch unter dem Eindruck der letzten Wochen.
»Ihr werdet ihren Aufenthaltsort ausfindig machen, Rochefort! Junge Frauen verschwinden nicht spurlos, auch diese nicht. Nicht aus diesem Palais, direkt unter meinen Augen! Nicht ohne-« Plötzlich fasste sich Richelieu an die Brust, gequälter Miene. »Nicht-«
Ein Hustenanfall schüttelte den Ersten Minister, er wankte und weigerte sich zugleich, sich am Fensterbrett abzustützen.
Rochefort tat einen Schritt vor, zögerte dann aber, trotz seiner Besorgnis, selbst Stütze anzubieten. Richelieu hätte die Hilfe ausgeschlagen und keine Schwäche eingestanden. Also nahm Rochefort stattdessen den Becher mit angewärmten Wein vom Schreibtisch und reichte ihn an. Er hielt den Becher weiterhin fest, als Richelieu ihn mit zittrigen Fingern umschloss. Mit rasselndem Atem führte der Kardinal den Wein an die Lippen und trank, bis sich seine angegriffene Lunge beruhigt hatte.
Rochefort stellte den Becher zurück und nahm den Faden wieder auf, als sei nichts geschehen. »Sie muss noch einen oder mehrere Verbündete haben. Dieser Lakai, Moraut, ist es nicht.«
»Verbündete, Vertraute, Verehrer.« Richelieus Stimme klang noch brüchig und belegt. Aber seine rote Soutane war glücklicherweise nicht von gehusteten Blutflecken beschmutzt worden. »Was ist mit Fernand de Grinchamps?«
»Untergetaucht, wahrscheinlich noch in Paris.«
»Wahrscheinlich?«
»Ich werde es in Kürze genau wissen.«
Richelieu maß seinen Stallmeister lang und Rochefort hielt stand. Zu viele Jahre diente er schon dem Kardinal, hatte sich dabei mehr als eine Narbe eingefangen, mehr als eine Wunde davongetragen, um sich von einem abschätzenden Blick verunsichern zu lassen. Rochefort hatte seinen Verstand an den undurchsichtigen Ränkespielen des Hofs geschärft, aber die Gedanken des Ersten Ministers vermochte er dennoch selten zu lesen. Auch jetzt scheiterte er.
Читать дальше