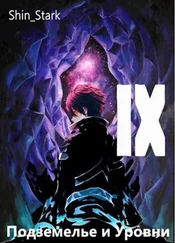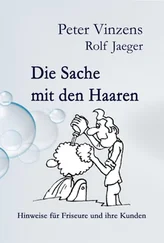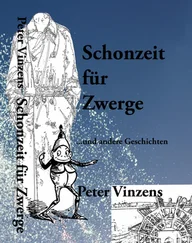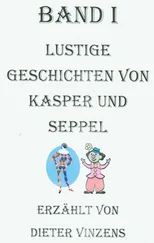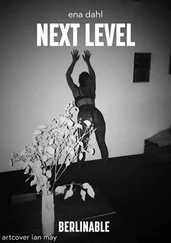Er lachte, zeichnete wohl vor seinem inneren Auge das Bild einer neuen Welt.
„Der Umbau ist dann später auch viel leichter! Neuen Chip in den Rechner und schon haben Sie ein neues Heim, eine neue Umgebung!“ Sein Blick schweifte in die Weite. „Aber da werden wir auch noch Lösungen finden.“
Es war gut, dass er eine Pause einlegte. Auch sein Zuhörer brauchte jetzt Zeit zum Nachdenken. Wieviel dieser Entwicklung war bereits Wirklichkeit? Was war bekannt, was noch geheim, oder einfach zu unauffällig in der Anwendung? Wer denkt heute noch an die Kuh, wenn er Milch trinkt, an Abfallberge, wenn er Flaschen fortwirft, beim elektrischen Rasieren an Verschwendung von Rohstoffen? Wer kennt überhaupt noch Ursachen und Wirkung? Gründe auch für eigenes Handeln?
Erklärungen bedürfen der Frage. Wird keine Frage gestellt, existiert auch keine Erklärung. Was hatte der verrückte Berliner noch vor wenigen Stunden auf dem Frankfurter Flughafen gemeint? Als Markoni die Radiowellen noch nicht entdeckt hatte, konnte auch niemand danach fragen. Wie aber könnten Erklärungen verlangt werden für Phänomene, die der Frager nicht kennen kann?
Die sanfte Stimme aus dem Lautsprecher teilte mit, dass soeben der Pol überflogen werde. Einige Passagiere sahen aus den Fenstern. Zu sehen war nichts. Wolken versperrten den Blick, eingetaucht in fahles Licht. Auch hier war der Überblick über das Ganze versperrt. Keine Möglichkeit Zusammenhänge erkennen zu können. Der Fluggast schlief. Alkohol und Anspannung hatten ihre Wirkung getan. Er schlief unruhig, zuckte, drehte sich, murmelte. „Alpträume reinigen die Seele“. So hatte eines der Yellow-Press-Blätter einmal einen Hellseher zitiert. Aber parapsychologische Themen waren offiziell für anerkannte Journalisten tabu. Handfest mussten die Fakten schon sein, und beweisbar.
Schon die Fahrt vom Flughafen in die Stadt war chaotisch. Übrigens, was heißt hier Stadt? Tokio ist keine Stadt. Tokio ist ein Land für sich. Aber im Gegensatz zu anderen Ländern herrscht für Nichtjapaner dort ein fürchterliches Durcheinander. Kleinere Straßen haben keinen Namen, wenn sie einen haben sollten, findet man keine Schilder. Häuser haben keine Nummern, nur Namen, aber die findet man auch nicht. Parkplätze gibt es überhaupt nicht, also, ein Fremder kann sie nicht finden. Hotels sind unbezahlbar, nur wer auf Spesen reist, kann geringe Hoffnungen haben. Die Bewohner des Landes sind sehr freundlich, aber entweder versteht man sie nicht, oder die notwendigen Verbindungsleute sind gerade nicht erreichbar. Tokio, zumindest glaubt das der Fremde auf den ersten Blick, ist eine große Familie. Eng zusammenlebend, großzügig im gegenseitigen Umgang, fest verankert in konfuzianischer Tradition und westlicher Geldgier. Nur ein vermeintlicher Gegensatz. Natürlich stimmt das alles nicht, aber dem Fremden bleibt der Einblick in die Gesellschaft verschlossen. Fremd sind alle, die anders aussehen als Japaner, und das ist der Rest der Welt. Lila Haare, oder Streifen a’ la’ Indianer im Gesicht sind überflüssig, denn Japaner haben eine eigene Physiognomie, eine eigene Gestalt, eigenes Verhalten. Sie sind halt anders. Da sie aber in der Mehrzahl sind, logischerweise, fallen alle anderen eben auf. Trotz des Gedränges, trotz der Hektik, trotz aller Freundlichkeit. Der Ausländer, der Eindringling, der Fremde bleibt draußen.
Japanern wird nachgesagt, sie seien hartgesottene Geschäftsleute, das ist zutreffend. Ihnen wird zugeschrieben, der Tradition eng verbunden zu sein, Tradition gehört zum japanischen Überleben. Lebensfreude wird großgeschrieben, aber sie findet, abgesehen von offiziellen Anlässen, nur unter ihresgleichen statt, unter Japanern und unter Mitgliedern der gleichen sozialen Klasse. Vergleiche zwischen Engländern und Japanern führen zu erstaunlichen Parallelen, wobei die Japaner die geschäftstüchtigeren sind. Das mag auch an den Glaubensrichtungen liegen, denn der Japaner toleriert jegliche Religion für sich und andere. Selbst Mischungen aus verschiedenen, für uns unvereinzubarenden Weltreligionen kommen vor. Japaner vereinen gründlichen Mangel an Dogmatismus mit innerer Abgeschiedenheit. Japan ist für uns eine fremde Welt. Unergründlich, kaum kalkulierbar. Madame Butterfly ist eine einfältige Erfindung eines kaum vorkommenden Phänomens. Japan und die japanische Gesellschaft ist das Arbeitsfeld eines Fernsehteams aus Frankfurt, Deutschland, Europa.
Mit dem Taxi durch die Stadt zu fahren, ist die einzig gangbare Methode für ein Team überhaupt etwas zu finden. Außerdem erledigt sich dabei die vergebliche Suche nach Parkmöglichkeiten. Das Studio Tokio der Fernsehanstalt kann ein wenig mit seinen Verbindungen helfen. Aber in Industriefirmen und Regierungsstellen einzudringen, erfordert die Unterstützung eines japanischen Kollegen. Die kosten natürlich Geld. Wie gesagt: Japaner haben viel vom ‚goldenen‘ Westen gelernt.
„Es ist ungeheuer schwierig, unseren Firmen in die Karten zu sehen. Insbesondere natürlich, auf so sensiblen Bereichen wie Computertechnik, Lasertechnik und damit verbundene Simulationen. Die Empfehlungen, die Sie von den Vertretern der europäischen TEC.TO.N bekommen haben, sind zwar hilfreich, aber, und das müssen Sie auch in geschichtlichem Zusammenhang sehen, Japan ist bei allem misstrauisch, was von außen kommt. Denken Sie doch nur wenige Jahrzehnte zurück, an den Anfang dieses Jahrhunderts. Da war es Europäern und Amerikanern ja noch fast verboten, unser Land zu betreten. Mit Waffengewalt wurden wir gezwungen, das zu ändern. Vergessen haben wir das nie. Oder warum, glauben Sie, war der Eintritt in den Krieg mit den Vereinigten Staaten von Amerika möglich?
Und heute? Zuerst wurde uns nachgesagt, ‚die klauen Ideen‘. Das traf zum Teil auch zu. Aber dann, also heute? Heute klauen die Anderen bei uns. Japan ist die führende Macht in der technischen Entwicklung. Darauf sind wir stolz. Das dürfen Sie nie vergessen! Darauf sind wir stolz.
Ich werde versuchen in Ihrem Sinne etwas vorzubereiten.“
3. Drehtag Tokio, Industriepark Nord, Japan
Das Ende der Halle ist nicht zu erkennen. Zwischen den hohen Anlagen laufen nur wenige Menschen umher. Wie Astronauten sind sie verkleidet. Eingepackt in Anzüge aus Kunststoff, Filter an den Atmungsöffnungen, Schuhe aus weichem Material. Nicht die Menschen müssen vor den Maschinen geschützt werden, sondern die Maschinen vor den Menschen. Für Nichtbeschäftigte: Zutritt zur Halle verboten! Aus Gründen der Reinheit. Von der verglasten Galerie allerdings sind Dreharbeiten freigegeben. In den Kontrollständen gelangweilte, äußerst höfliche Techniker. Sie überwachen die Anlage und die Beschäftigten. Auf Monitoren Details der Fertigung. Vollautomatische Herstellung elektronischer Bauteile, vollautomatische Montage, vollautomatische Qualitätskontrollen. Nur die überwachenden Techniker sind noch nicht vollautomatisch. Dafür aber der Computer, der die Techniker überwacht. Hier könnte alles Mögliche hergestellt werden: Satelliten, Unterhaltungselektronik, Kriegsgerät, Schaltungen für Bügeleisen. Die fertigen Produkte haben kein Gesicht. Elektronik, programmierbar für fast jeden Bedarf.
Ein kurzer Imbiss wurde gereicht. In einem Raum von dem man auf die Produktion hinuntersehen konnte. Ein einfaches Mahl, sehr schmackhaft, dazu viel schwarzen Kaffee. Auf dem Tisch standen offene Flaschen mit Wasser. Die japanischen Begleiter verdünnten den Kaffee. Es sei besser für die Gesundheit, sagten sie.
In Glaskästen unter den hohen Fenstern zur Außenseite, standen die Produkte der Firmengruppe. Frühere und jetzige. „Wir können auf unsere Produkte sehr stolz sein,“ der Firmenvertreter redete in englischer Sprache, das erste Mal, dass er sich nicht des Übersetzers bediente. „Unsere Produkte beherrschen den Weltmarkt und die meisten Leute in der Welt wissen es noch nicht einmal. Je kleiner unsere elektronischen Bauteile sind, desto wichtiger werden sie und umso weniger fallen sie auf. Die Miniaturisierung begann ja mit der Entwicklung der Raumfahrttechnik. Leicht mussten die Geräte sein und sie mussten mehr können als jemals zuvor. Das war die Zeit, in der ein Großrechner noch mehrere Stockwerke benötigte, Röhrenbetrieb. Die Messtechniker waren den lieben langen Tag unterwegs, um all die kleinen Krankheiten zu finden, die die Dinger dauernd hatten. So was konnte man weder im Weltraum, noch auf der Erde gebrauchen. Also haben wir angefangen wartungsfreie, schnelle Technik zu entwickeln. Heute ist sie überall, im Bügeleisen, im Telefon, im Fernsehgerät, überall. Nicht nur in Großrechnern. Die Entwicklungsstufen stehen hier und erfreuen unsere Besucher. Ich will Ihnen ein paar Beispiele zeigen.“ Er sagte etwas auf Japanisch, die Schränke wurden aufgeschlossen.
Читать дальше
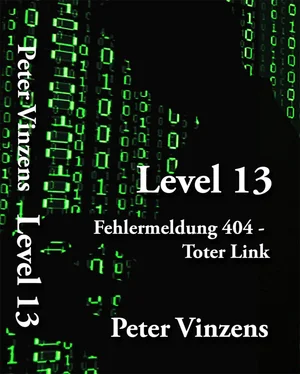
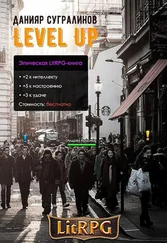
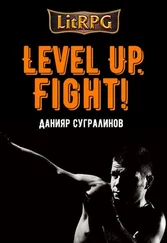
![Shin_Stark - В подземелье я пойду, там свой level подниму X [СИ]](/books/384602/shin-stark-v-podzemele-ya-pojdu-tam-svoj-level-po-thumb.webp)