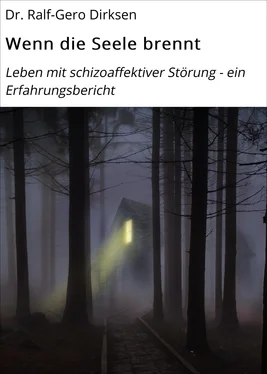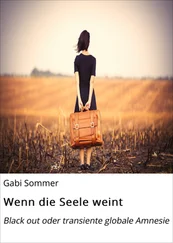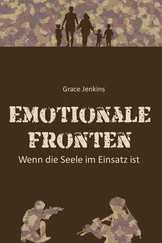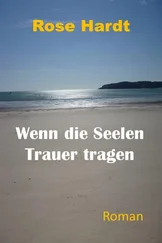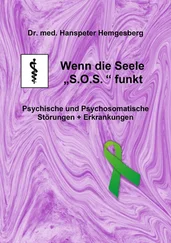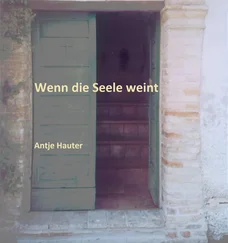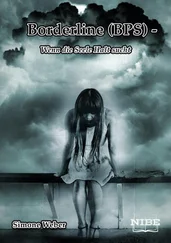Meine Eltern wollten zunächst aus einem gewissen Reintegrationsgedanken heraus, dass ich in eine Klinik in Kiel an meinem Studien- und Wohnort komme. Mein Vater brachte mich in die Psychiatrische Universitätsklinik in Kiel, aber die Aufnahmestation war so schrecklich – da waren keine Pfleger, sondern eher Aufseher oder Wärter, die ihren Dienst versahen. Ich flehte meinen Vater an, dass er mich wieder mitnehmen solle, was er nach einigem hin und her auch machte. Zurück in Schleswig wies mich eine niedergelassene Psychiaterin in die dortige Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie und Rehabilitation ein, wo ich von dem Ärztlichen Direktor behandelt wurde. Weil es damals keine explizit psychiatrischen Behandlungsangebote für junge Erwachsene gab, wurde ich auf einer offenen geriatrischen Frauenstation untergebracht, die auf Depression spezialisiert war. Seit diesem ersten Klinikaufenthalt wurde ich in der zehn Jahre andauernden Krankheits-Odyssee stationär und ambulant ganz überwiegend nach dem psychotherapeutischen Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt. Grundannahmen der sogenannten behavioristischen Therapie sind, dass psychische Störungen auf abnormes, gelerntes Verhalten zurückzuführen sind. Neue Lernprozesse können ungünstiges Verhalten verändern. Motive, Gefühle und innere Konflikte spielen bei der Behandlung von psychischen Störungen keine große Rolle. Ungünstige Gedankenmuster können Verhaltensstörungen verursachen und verstärken. Für jede psychische Störung wird ein spezifisches therapeutisches Vorgehen entwickelt. Ziele der Verhaltenstherapie sind Hilfe zur Selbsthilfe, Reduzierung der Symptomatik, Selbstregulation des Patienten, Psychoedukation.
Mein depressives Empfinden bestand körperlich darin, dass ich ein Spannungsgefühl rund um den Kopf hatte („belegte Stirn“) und allgemein die Motorik gestört war. Von der Kognition her war ich eingeschränkt. Ich konnte mich nur schwer konzentrieren. Seelisch betrachtet hatte ich große Angstzustände. Was mein soziales Verhalten anbelangte, zog ich mich, auch aufgrund der Beeinträchtigungen, immer mehr zurück. Ich lag in meinem Zimmer und starrte an die Decke. Vom Personal musste ich motiviert werden, an einem Gesellschaftsspiel teilzunehmen. Die Fachleute sprachen von einem neurotischen Depersonalisationssyndrom. Ich war meilenweit von dem Zustand des Studenten entfernt, so wie ich mich vorher kannte.
Fatal bei dieser Erkrankung ist, dass der Wunsch sich umzubringen, für den Kranken zu einer realen Option wird. Dabei verstellt die Krankheit tatsächlich einen realistischen Blick auf die eigenen vorhandenen Perspektiven. Ärzte und Therapeuten sollten diese Gefahr offen ansprechen, was eine enorme und wichtige Erleichterung für die Betroffenen darstellt, denn es ist in der Regel nicht der freie Wille des Betroffenen, aus dem Leben zu scheiden, sondern die Krankheit, das ablaufende Programm, das diese vermeintliche Möglichkeit eröffnet. Das können Gefühle sein, die zu Lebensmüdigkeit führen oder bei schizoaffektiven Formen auch Stimmen im Kopf, die imperativ dazu animieren: „Bring dich um!“ Das präsuizidale Syndrom des Psychiaters Erwin Ringel beschreibt drei Phasen: Die Betroffenen erleben ihre Situation zunächst als ausweglos und die seelischen Kräfte lassen nach. In der darauffolgenden Phase kommt es dazu, dass Aggressionen nicht ausgedrückt werden können und sich zunehmend gegen die eigene Person richten. In der dritten Phase denken Betroffene aktiv über einen Suizid nach oder Suizidgedanken drängen sich auf. Eine Restambivalenz kann bis zum unmittelbaren Vollzug bestehen bleiben. In der Entschlussphase kommt es nur noch auf indirekte Art zu Suizidankündigungen. Die fantasierte Erleichterung durch den Tod führt zu einer „Ruhe vor dem Sturm“. Angehörige und Pflegepersonal denken unter Umständen, dem Patienten würde es wieder besser gehen.
Man kann davon ausgehen, dass 2 % der Durchschnittsbevölkerung einen Suizidversuch unternimmt und fast jeder Mensch erlebt einmal im Leben Suizidgedanken. Zirka 10.000 Menschen nehmen sich jährlich in Deutschland das Leben, wobei rund Dreiviertel Männer und ein Viertel Frauen sind. Männer wählen häufig harte Suizidmethoden, während Frauen weiche Suizidmethoden bevorzugen, so dass die Zahl der nicht tödlich endenden Suizidversuche bei ihnen um das 2- bis 3-Fache überwiegt. In 40-60 % der Fälle von vollzogenem Suizid liegt eine Depression vor. In 10 % der Fälle liegt eine Schizophrenie vor.
Ich kann nur allen Erkrankten, die Suizidgedanken haben, zurufen bevor es zu Handlungen kommt: „Kehrt um, holt Euch Hilfe. Wenn es sein muss, auch hinter der geschlossenen Tür einer psychiatrischen Klinik. Man ist kein schlechterer Mensch, nur weil man krank ist und an Selbstmord denkt. Ihr seid die wahren Helden und werdet belohnt fürs Durchhalten.“ Die Möglichkeit eines Suizids sollte in der psychotherapeutischen Arbeit nicht verurteilt werden. Die Annahme der suizidalen Tendenz durch den Therapeuten führt zu einer Stärkung des Selbstwertgefühls und reduziert Schuldgefühle. Die Therapiestrategie sollte darauf ausgerichtet sein, mit dem Patienten herauszuarbeiten, welche bewussten und unbewussten Ziele er mit dem Suizid erreichen will. Es ist nach Möglichkeiten zu forschen, diese Ziele auch auf anderem Weg zu erreichen.
Ganz in der Nähe der Klinik und meines Elternhauses befindet sich ein Hochhaus, auf dem ich schon im 8. Stock stand und ein Bein über der Brüstung hatte, als eine Frau aus ihrer Wohnung kam und mich anherrschte: „Was machen Sie da?“ Ich bin geflüchtet. Diese Frau hat mir das Leben gerettet.
Heute sage ich auch, dass ich schon mehrere Leben gelebt habe, bei so unwahrscheinlich viel Glück, wie ich hatte.
Die Behandlung in der Fachklinik umfasste als Pharmakotherapie den Einsatz des Antidepressivums Saroten und des mittelpotenten Neuroleptikums Taxilan sowie Ergotherapie, was meiner künstlerisch-kreativen Ader sehr entgegenkam. In den Räumen der Beschäftigungstherapie fand ich auch wegen des unaufgeregten und gelassenen Leiters, der ruhigen Musik und der sanften Aktivität Entspannung. Ich habe vorwiegend getöpfert - aber nicht irgendwelche Aschenbecher, sondern kunstvolle Gefäße, die ich später an meine Freundinnen in Kiel verschenkte. Die Sporttherapie nahm mir die innere Unruhe. Die Physiotherapie unterstützte ebenfalls den Körper. Die Musiktherapie sorgte dafür, dass wieder etwas in mir schwingen konnte. Der Ärztliche Direktor hatte für mich als angehenden Akademiker eine besondere Therapie vorgesehen. Ich sollte in der Ärztlichen Bibliothek auf dem Klinikareal neue Bücher aufnehmen. Dazu hatte ich eine mechanische Schreibmaschine und Karteikarten zur Verfügung. Obwohl ich aufgrund meiner kognitiven und motorischen Einschränkungen immer wieder Fehler machte und von vorne anfangen konnte, versicherte man mir, wie wichtig meine Arbeit sei. Das fand ich aufmunternd und die Therapie half mit, den Tag zu strukturieren. Am wichtigsten waren aber die Gespräche mit dem Pflegepersonal. Es gab eine Schwester Roswitha, die mir aufgrund ihrer Expertise Hoffnung machte und sagte, dass es nicht mehr lange dauere, bis ich wieder mit meiner bekannten Persönlichkeit auftauche. Was Silke betraf, wich die unaussprechliche Wut einer nüchterneren und plausiblen Erklärung: irgendwie war sie auch krank. Sie litt unter ihrem Lebenswandel, wie sie mir angedeutet hatte. Mit dieser Erkenntnis hat sich bei mir ganz viel gelöst und ich konnte vergeben.
In der Klinik hatte ich Anja, eine junge Frau aus relativ prekären Verhältnissen kennengelernt. Sie hatte von früheren Missbrauchsfällen überall Narben am Körper, aber ein hübsches Gesicht. Ich freundete mich mit ihr an. Mit ihr lernte ich verwöhntes Bürschchen aus gutem Elternhaus auch den rauen Kern der Psychiatrie kennen, eine Welt, die mir bisher fremd war. Es gibt Menschen, die hatten in ihrer Kindheit und Jugend nicht so viel Glück wie ich. Außerdem hatte ich engeren Kontakt zu Gaby, einer Frau, die ihren Mann mit einer ihrer Freundinnen in flagranti im Bett erwischte und ihre Wut darüber nicht auf ihn projizierte, sondern sich selbst die Pulsadern aufschnitt. Nach der Behandlung in der Klinik besuchten wir uns auch gegenseitig in Flensburg und Kiel.
Читать дальше