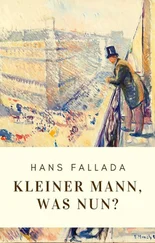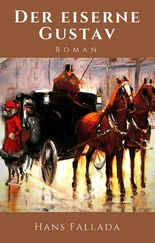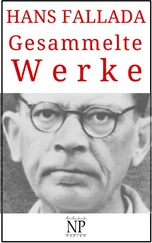Der Junge begriff das alles in den zwei oder drei Sekunden, die der Vater nach der Schnapsflasche grabbelte, und gerade als der Vater sie an den Mund setzen wollte, sagte er: Mich friert mächtig, Vater, laß mich auch einen trinken.
Der Vater behielt die Flasche weiter an den Lippen, aber er hob das Gesicht etwas gegen den Sohn. Er trank noch nicht, er fragte: Trinkst du jetzt Schnaps, Hannes?
Wenn mich so friert, sagte der Sohn trotzig.
Der Vater hatte die Schnapsflasche halb sinken lassen, der Sohn sah genau an seinem Gesicht, wie er sich mühte, nachzudenken. Er wartete darauf, dass der Vater zornig werden würde, denn dann war alles gut. Darum sagte er noch: Schnaps wärmt schön, Vater. Wieder das bemühte Nachdenken. Der Vater bewegte die Lippen, atemlos wartete der Sohn – da lachte der Vater plötzlich schallend los, hielt dem Jungen die Schnapsflasche hin und sagte: Na, nimm einen, Hannes.
Der erste Versuch war missglückt. Aber schon hatte Hannes einen zweiten Plan gefaßt: er musste dem Vater möglichst viel Schnaps wegtrinken. Der Junge wußte vom Geruch, von ein oder zwei Versuchen mit Gläserneigen her, dass Schnaps bitter und scharf, also schlecht schmeckte. Es gab darum nur ein Mittel für ihn, dem Vater möglichst viel wegzutrinken, er musste den Schnaps, so rasch es ging, in sich hineingießen.
Er legte also den Kopf zurück, setzte den Flaschenhals an die Lippen und goß den Schnaps hinter. Er war nur ein neunjähriger Junge, und es war ein richtiger achtunddreißigprozentiger Kornschnaps. Er brannte im Hals wie Feuer und fraß die Luft weg. Ein- oder zweimal verschluckte sich der Junge, Ekel und Übelkeit stiegen in ihm hoch, aber er kämpfte sie nieder, er musste doch den Vater, auf den er unverwandt während des Trinkens sah, von seinem Stein hochkriegen. Ihm kam es vor, als schluckte er schon stundenlang an diesem widerlichen Gift, ehe der Vater den Kopf hob und mühsam sagte: Laß mir auch was drin, Hannes.
Der Junge setzte die Flasche ab, er wollte sprechen, er wollte sagen – das hatte er sich überlegt –, dass ihn immer noch fröre und dass er darum weitertrinken wollte, aber er brachte nichts heraus wie einen heiser krächzenden Laut, seine Stimmbänder waren gelähmt.
Der Vater sah aufmerksamer hoch, der Sohn machte einen Schritt zurück, er setzte wieder die Flasche an und trank wieder. Nun war sein ganzer Schlund schon eine brennende Spur den Leib herunter. Der Magen war eine dumpfe, aufwärts stoßende Masse, in der ein schmerzhaftes Feuer brannte. Aber er sperrte einfach den Rachen auf und goß weiter Schnaps in sich.
Laß das! sagte der Vater scharf, es war beinahe der alte Stimmklang, wenn er böse war.
Hannes machte nur eine abwehrende Bewegung mit den Händen und trank weiter. Er glaubte, er könne es nicht mehr ertragen. Jetzt wurde sein Kopf schwindlig, er kämpfte mit einer schrecklichen Übelkeit, aber er trank doch.
Gib die Flasche her, rief der Vater böse und griff nach ihr. Hannes machte wieder einen Schritt zurück, um der Hand auszuweichen, der Vater stand auf, da rutschte Hannes aus und fiel, die Flasche loslassend, rücklings hin.
Er lag auf der Erde, er hatte sich weder erschreckt noch weh getan, aber da lag er und war sehr zufrieden, denn er hörte neben sich im Schnee die Flasche auskluckern.
Plötzlich verdunkelte sich der Himmel über ihm, es war sein Vater, der sich über ihn beugte und drohend fragte: Willst du gar nicht wieder aufstehen?
Doch, sagte er gehorsam und sprang so rasch auf, dass er gleich wieder hinfiel. Dies belustigte ihn so, dass er in ein lautes Lachen ausbrach, und trotz allen Drohens des Vaters wollte sein Lachen nicht enden. Dann wurde ihm wieder übel und sein Kopf drehte wie eine Mühle.
Sein Vater musste ihn hochgehoben und auf die Füße gestellt, musste ihn eine Weile geführt haben, denn plötzlich sah er sich und ihn auf der Chaussee nach dem Hof. Er hörte sich laut reden. Er erzählte von allem, was er im letzten Jahre verstanden hatte und was ihm das Herz schwergemacht hatte: von der verludernden Wirtschaft, der Mutter, die alles falsch machte, dem fremdtuenden Alwert, und wie die dreizehnjährigen Schuljungen mit den Schulmädchen richtig Mann und Frau im Stroh spielten. Zwischendurch hörte er den Vater mit einem Ton fast ingrimmig schreienden Schmerzes rufen: Hör damit auf! Laß das, Hannes, hör auf!
Zugleich merkte ein zweiter, scharfer Beobachter in ihm, dass sie nicht etwa gerade auf der Chaussee gingen, sondern bald auf der rechten, bald auf der linken Seite. Auch, dass sie oft beinahe in die Gräben gerieten, dass sie also genauso torkelten, wie der alte Säufer Timmermann im Kirchdorf, dem die Schuljungen so gern nachäfften. Der Gedanke, dass sein Vater und er wie der olle Timmermann hier auf offener Straße herumtorkelten, belustigte ihn derart, dass er zwischen seinen Schmähreden immer wieder in ein brüllendes Gelächter ausbrach. Er forderte seinen Vater auf, stehenzubleiben, damit er ihm im Schnee die Torkelspur beweisen könnte.
Dazwischen übertrug die zitternde, schweißnasse Hand seines Vaters ein sehr genaues Gefühl auf ihn von der zornigen Traurigkeit, der tiefen Verzweiflung, die den Mann erfüllten. Er dachte flüchtig daran, dass er mit dem Vater gleich nachher in der Stube richtig ernsthaft würde sprechen müssen und mit ihm ein großes Freundschaftsbündnis schließen zur Rettung des Hofes.
Während all dies – und noch viel mehr – in ihm vorging, waren sie doch schließlich von der Chaussee auf den Weg zum Hof abgebogen und näherten sich nun, immer stöhnend, schwatzend, torkelnd, den beiden gemauerten Torpfeilern, zwischen denen der Weg auf die Hofstätte führte. Im Windschutz eines dieser Pfeiler hatte Schwester Frieda auf die beiden gewartet. Sicher hatte sie schon längst den Lärm gehört, das Torkeln gesehen und trat zornig auf sie zu. Pfui, Vater! Pfui, Hannes!
Dabei zerrte sie an der Hand ihres Bruders, um ihn vom Vater loszureißen. Sie hatte nicht wissen können, welch plötzliche Bewegungen ihr Bruder in seinem jetzigen Zustand machte, auf wie schwachen Beinen er stand. Als sie ihn loshatte, taumelte er mit sechs, acht raschen, torkelnden Schritten gegen die Wegkante nach der Dungstätte hin, Frieda mit sich reißend. Ehe der Vater noch auf sie zukonnte, fielen die beiden, rollten die Böschung vom Wege hinab auf die Dungstätte, einen Dunghaufen hinunter und fielen auf das Eis der tiefen gemauerten Jauchengrube, das unter ihnen zerbrach. Hannes schrie noch gellend auf, ehe der Dreck ihm den Mund stopfte, Frieda versank lautlos. Der Vater stand ohne Bewegung, starrte in das dunkle Loch und schrie. Und schrie. Im Hause wurde es hell. Knechte kamen gelaufen, die Mutter weinte aus einem Fenster. Frieda war tot, aber Johannes lebte. Dass er am Leben geblieben und nicht Frieda, quälte viele Jahre noch sein Gewissen, peinigte ihn im Traum, führte ihn immer wieder zurück auf den Windmühlenhügel und stellte ihn von neuem vor den Stein. Dass er den Schnaps getrunken, um den Vater zu retten, das war richtig gewesen, aber warum musste nun dadurch Frieda sterben?
Das war nicht zu verstehen. Und dann war auch noch die Geschichte mit Alwert, dem hochmütigen, einzelgängerischen Alwert nicht zu verstehen, der etwa zwei Jahre darauf abhanden kam. Das konnte man ja nun einsehen, dass nach diesem Ereignis der Vater den Johannes mied und den Alwert vorzog. Aber warum musste Alwert wieder durch dieses Vorziehen zugrunde gehen, verschwinden, ausgestrichen werden aus der Liste der lebenden Gäntschowschen Kinder?
Das war so gekommen (aber zu verstehen, was da geschehen war, war es erst viele Jahre später): Mitten in der Silvesternacht sagte der Vater: Nun komm.
Alwert schlich hinter dem Alten aus dem lärmenden Haus über die Hofstatt zum Kuhstall. Es fror leicht, die Sterne funkelten. Der Vater zog die Tür auf und sie kamen in warmes Dunkel.
Читать дальше