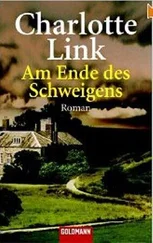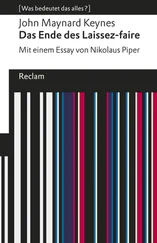Kerstin? Hieß so das Mädchen aus der Parallelklasse, das über Jahre hinweg immer wieder von ihren Mitschülern und Schülern anderer Klassen drangsaliert wurde? Ich weiß nicht mehr, ob ich in der fünften oder sechsten Klasse war, aber ich kann mich an den Wintertag erinnern, an dem es nach Tagen endlich wieder angefangen hatte zu schneien; der erste Schnee des neuen Jahres, rein und weiß tanzten seine Flocken durch die Luft. Auf dem Boden lag noch der des alten und dort – vor dem Schulgebäude, denn die Schule hatten wir für den Tag bereits hinter uns – lag auch Kerstin. Auf ihr saßen drei oder vier andere, Jungen und Mädchen, hatten Kerstin die Jacke aufgerissen und stopften Schnee und Eisstücke unter ihren Pullover, in ihre Hose, in ihren Mund und in ihre Haare. Ihre Schultasche lag offen, Hefte und Bücher waren herausgezerrt und durchnässt oder schon vom Schnee, der vorher in ihre Tasche gestopft worden war, aufgeweicht. Um die Gruppe herum stand ein erster Kreis von Anfeuerern und dahinter ein – stiller lachender – zweiter, auch ich. Kerstin wehrte sich nach Kräften und ich frage mich noch heute, woher sie nach all den Jahren noch die Kraft und die Hoffnung nahm, die man braucht, wenn man sich zur Wehr setzen will. Plötzlich aber waren von einem Augenblick auf den anderen keine Hoffnung und keine Kraft mehr da, so abrupt, dass fast alle plötzlich inne hielten und fast nur noch Kerstins Weinen zu hören war, anders, verzweifelter und endgültiger als bis dahin. Sie war zusammengesunken und fragte sich und uns immer wieder: Warum denn immer ich? Warum denn immer ich? Warum denn immer nur ich? Ich weiß nicht, wie oft ich in den vergangenen Jahren an diese Szene habe denken müssen. Jedes Mal muss ich dabei mit Scham und Tränen kämpfen und jedes Mal erscheinen sie mir angemessen und gerecht. Hörst du mich, Kerstin? Es tut mir leid, hörst du? Ich wünschte, ich könnte ungeschehen machen, was damals passiert ist, ich wünschte, ich hätte eingegriffen und mich nicht lustvoll darüber gefreut, dass du statt meiner so im Schnee liegen musst.
Hab’ ich dir je davon erzählt, wie wir an jenem Wintertag Kerstin gequält haben? Und davon, welche Angst ich hatte vor meiner Lust an ihrem Leid? War all das irgendwann Thema während unserer Sonntagnachmittage, an denen wir im Wohnzimmer deiner Eltern Kuchen essend und Fernsehen guckend beieinandersaßen und es uns gut gehen ließen und uns gemeinsam in unsere schöne Zukunft träumten? Und weißt du von meinen Sonntagen ohne dich?
Am schlimmsten waren die Sonntage.
Jeder der Tage war auf seine Art schlimm, aber hätte er sich entscheiden müssen, Maximilian würde den Sonntag gewählt haben. Die Sonntage waren still. Niemals friedlich, wie seine Eltern die Atmosphäre beschrieben, die sie gegen das Streiten Maximilians und seiner Schwester zu verteidigen suchten. Nie beschaulich, wie die Eltern Jörgs, seines besten Freundes, zu dem sich Maximilian an Sonntagnachmittagen flüchtete, den Zustand ausmalten, der einen Sonntag ausmacht und nach ihrer Meinung ausmachen sollte. Nein, sie waren still. Eine müde machende Stille, die doch nie zur Ruhe führte. Jedenfalls nicht bei ihm. Diese Stille war wie die Stille vor dem Klingeln zum Stundenende, bevor er wieder durch die enge Gasse der Neuntklässler musste, war wie die Stille vor dem Klatschen einer Hand oder, wie er sich vorstellte, wie die Stille vor einem Erdbeben. Aber es gab hier keine Erdbeben, noch nie gab es eines, und es war nicht damit zu rechnen, dass dieser Sonntag eine Ausnahme machen würde. Genauso wenig, wie der Bus ihn versehentlich nicht zur Schule fahren oder man auf dem Schulhof eine Bombe finden würde.
Es gab auch eine Stille vor Krankheiten, eine andere Stille; soweit es Maximilian betraf, eine freudige. Vor allem an den Sonntagen horchte er tief in sich hinein, ob es nicht etwas gab, was sich nicht normal anfühlte. Dann waren die Montage allein zu Haus wie Ferien.
Ferien …Aber bis dahin waren es noch sechs Wochen. Maximilian rechnete, ohne rechnen zu müssen: Noch sechs Wochen bis zu den Sommerferien, dreißig Tage Schule, fünf Sonntage, fünf Samstage, eigentlich achtundzwanzig Tage, weil es noch eine Exkursion geben würde und der Tag der Zeugnisausgabe zählte ja schon nicht mehr. Und dann …
Dann würde er in die sechste Klasse kommen. Noch fünf Jahre also. Wie viele Wochen, wie viele Tage waren das und was konnte man wegstreichen?
Das Mittagessen war gerade vorbei, ein ganzer Nachmittag lag noch vor ihm, der aber, obwohl er die Hausaufgaben wie immer schon früh am Morgen hinter sich gebracht hatte, doch nicht ihm gehörte. Er gehörte schon dem Montag und dem, was dieser mit sich brachte.
„Ich geh’ zu Jörg“, sagte Maximilian leise ins Wohnzimmer hinein.
„Ist gut, Süßer, und“, mit ebenfalls gedämpfter Stimme, „sei leise, Papa schläft.“
Die Schule ist schon von weitem zu sehen. Sie steht direkt am Altonaer Platz, der weit über die Stadt hinaus für die Vielzahl der zu ihm führenden Wege bekannt sein soll, ein roter trutzburgartiger Bau, der alles verdunkelnde Schatten wirft, sobald sich nur ein wenig Sonne am Horizont zeigt.
Wie immer sieht Koops mich zuerst:
„Na, auch wieder hier?“ So beginnen Montage.
„Klar, konntest du's auch nicht erwarten?“
„Hör bloß auf, ich hab' das ganze Wochenende Geschichte korrigiert, fünfundzwanzig Mal derselbe schlechte Text, der mich bereits bei der ersten Klausur unendlich gelangweilt hat. Und selbst? Wie war dein Nostalgiebesuch an den Stätten vergangener Tage?“
„Sagen wir, er war beschaulich.“
„Sag bloß, du hast jemanden dabei gehabt?“
„Niemanden, bloß meine zwei Dutzend Ichs und die Geister der Vergangenheit. Und bevor du fragst: Ich hatte keinen Sex, nicht mal mit mir allein.“
Koops Gesicht weiß noch nicht, ob es sich für ein Lächeln oder für Nachdenklichkeit entscheiden soll, wählt aber schließlich das Letztere. Vielleicht kennt er mich besser, als ich dachte. Er war quasi der Erste, der mir damals an meinem ersten Tag hier über den Weg lief und dabei ist es dann schließlich geblieben. Wie ich unterrichtet er Deutsch und Geschichte, allerdings mit wesentlich mehr Enthusiasmus, als es mir möglich ist. Würde ich nach dem überzeugendsten und überzeugtesten Lehrer gefragt, den unser Gymnasium zu bieten hat, käme ich auf ihn. Es spricht nicht gegen Koops, dass er das ganz anders sieht.
Nach ihm treffe ich unvermeidlich auf die anderen, das Lehrerzimmer flirrt in der Hektik des Wochenanfangs, die Wiederholung des ewig Gleichen. Papenow, sicher auch heute der erste, sitzt an seinem Platz und durchblättert die „Frankfurter Allgemeine“ mit altgedienter Souveränität, Zeller klappert bereits im benachbarten Chemiesaal und auch der übliche Papierstau im Kopierer wird bereits fluchend kommentiert. Heute hat es Schönberg erwischt. Wie immer bin ich knapp in der Zeit und gehe gleich und ohne auf Vertretungsplan und Mitteilungsbuch geachtet zu haben in den Klassenraum der 10b, in dem mich Tonio Kröger und 25 müde Schüler erwarten. Falls ich etwas vorbereitet habe, habe ich es vergessen, der Unterricht schleppt sich dahin und ich mich mit ihm, trotzdem geht es irgendwie, eine Erfahrung, die wohl maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass Unterrichtsvorbereitungen in meinem Lehrerleben mittlerweile eine eher untergeordnete Rolle spielen.
So hat das Drama an diesem Vormittag noch mehrere Aufzüge, ohne den Tod des Helden zu erleben, dann ist der offizielle Teil des Tages auch schon beendet. Zusammen mit Koops lasse ich die Schule für heute hinter mir, im „Maybach“ gibt es montags meist Fisch und der soll nicht an uns vorüber ziehen.
Читать дальше