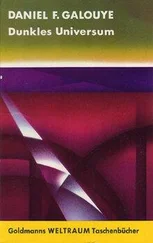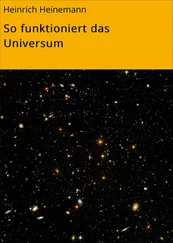Es war anfangs nicht leicht, meine Argumente für diese Entscheidung durch zubringen. Die allermeisten Professoren und Mitstudenten verwiesen auf die reiche, jahrtausendealte Kultur Japans, meine vielversprechende Zukunft als angehende Japanologin und auf cineastische Meisterwerke wie „Die sieben Samurai“, „Die letzten Glühwürmchen“ oder „Twenty-four Eyes“ aus dem Jahr 1954. Meine Freundin und Mitbewohnerin Heike schrieb eine lange Liste mit europäischen Filmen, die es in Sachen Blutverlust und Horror mit „Battle Royale“ aufnehmen konnten und mich davon überzeugen sollten, dass es überall auf der Welt Menschen gab, die schreckliche Filme produzierten. Meine Eltern ließen mir kommentarlos einen Ordner mit Kontoauszügen und Abbuchungsbelegen der Universität, des Studentenheimes und eine Aufstellung meiner monatlichen Taschengeld-Zuwendungen während der Studienzeit zukommen, die – zusammengerechnet - eine erkleckliche Summe ergaben. Sie sprachen elf Wochen lang kein einziges Wort mit mir, obwohl wir uns auch weiterhin zwei Mal wöchentlich zum Essen im familiären Kreis trafen. Während die Abende vor meinem Studienabbruch immer eine Art Höhepunkt der Woche für mich waren, verliefen sie von da an immer gleich eintönig: Ich parkte mein Auto vor dem Haus, stieg aus, sah meine Mutter, die vom Fenster weghuschte und den Vorhang zuzog, drückte den Klingelknopf an der Haustür, wartete mindestens zehn Minuten. Drückte ein zweites Mal. Wich zurück, weil mein Vater schwungvoll die Tür aufriss, sah in sein beleidigtes Gesicht, grüßte, zog meine Schuhe aus, legte meine Jacke auf die Kommode, folgte dem Vater ins Esszimmer und traf dort auf Mutter, die mich mit wehleidigem Blick wortlos auf meinen Sitzplatz verwies. Wir aßen, wortlos. Tranken, wortlos. Ich dankte artig, schob meinen Stuhl bei Seite, trug den Teller in die Küche, verabschiedete mich. Ging. Anfangs hatte ich noch versucht, meinen Eltern die Gründe für meine Entscheidung darzulegen. Ich hatte ihnen ausdrucksvoll geschildert, wie traumatisch diese cineastische Erfahrung für mich gewesen war. Und welche moralischen Hürden sich dadurch für mich aufgetan hatten, die ich, beim besten Willen, zu Beginn meines enthusiastisch begonnenen Studiums, nicht erkennen hatte können. Meine Eltern blickten mich nur stumm an. Mein Vater, bereits kränklich, ächzte und stöhnte auf seinem Platz: „Sag mal Liebes, weißt Du, wo ich die lila Blutverdünner hingelegt habe. Du weißt schon, die dicken Brummer, die mir Dr. Matzkind verschrieben hat?“. Er verwickelte meine Mutter immer in ein Gespräch über seine Arzneimitteleinnahmen und die Beschaffenheit seiner Ausscheidungen, sobald ich auch nur Luft holte um etwas zu sagen. Deshalb beließ ich es irgendwann. Mit meinen Erzeugern offen und ehrlich über den eigentlichen Grund meines vermeintlichen Scheiterns zu sprechen, über meine Angst davor, erfolgreich zu sein, war völlig ausgeschlossen. Also tat ich das, was sich anbot. Ich blieb stumm. Die Sprachlosigkeit war das lauteste in diesem Raum, in dem wir saßen. Was mich traurig machte, zumal ich von meinem Vater wusste, dass diese beiden Menschen, die sich als meine Eltern ausgaben, irgendwann ganz anders gewesen sein mussten, als sie es heute waren.
Während also meine Eltern meinen Studienabbruch als persönlichen Affront werteten, konnte ich alle anderen von meinen Beweggründen überzeugen. Man hielt mich sogar für besonders mutig! Schließlich hatte ich es mittlerweile zur Meisterschaft darin gebracht habe, abgebrochene Projekte als etwas Gutes, Sinnvolles oder Verständliches zu verkaufen. Um im sozialen Gefüge nicht allzu sehr aufzufallen und anzuecken war ich es gewohnt, meinen „Defekt“ gut zu verstecken. Zumindest war ich wie die meisten von uns der Überzeugung, dass ich nach außen hin einen völlig normalen Eindruck mache. Wenn man ganz genau hinschaut, sich auf einen Menschen richtig einlässt, gut zuhört und feine Antennen hat, dann findet man trotzdem recht schnell heraus, welche Eigenarten das Gegenüber pflegt. Aber wer nimmt sich schon Zeit für so viel Empathie? Meistens gibt es eine Art stille Übereinkunft, an die wir uns alle halten: Wir nehmen uns zusammen und versuchen, ein Bild zu wahren, das dem entspricht, was gesellschaftlich anerkannt ist. Wie hatte es vor ein paar Tagen meine Zahnärztin so treffend auf den Punkt gebracht, nachdem der Geschäftsführer eines Mittelstandsunternehmens im Nachbarort innerhalb von wenigen Stunden sich und seine gesamte Familie buchstäblich pulverisiert hatte? Mit einer Extraportion Gas aus der Leitung und einem klitzekleinen Streichholz? Weil die Frau in wegen häuslicher Gewalt vor den Kadi bringen wollten, nachdem er begonnen hatte, nicht nur ihr, sondern auch den beiden Kindern regelmäßig taubeneigroße Hämatome zu verpassen: „Gibt es nicht jede Woche so einen anderen vermeidlichen Gutmenschen? Einen, den wir vielleicht sogar als freundlich und unauffällig, fast ein wenig bieder beschreiben würden, der sich im Verein, in der Suppenküche oder für den Tierschutz engagiert. Um nach dem geselligen Abend im Vereinsabend heimzugehen und dort genüsslich Frau und Kinder windelweich zu prügeln?“
Wenn mein Vater mir als Kind an seinen guten Tagen davon erzählte, wie er und meine Mutter sich kennen gelernt hatten, wurde seine Stimme ungewohnt weich und sein Blick bekam etwas jungenhaftes, ungeheuer entspanntes. Seine ansonsten tief zerfurchende Denkerstirn, wie meine Mutter das hügelige Ensemble an Falten unterhalb des Haaransatzes gerne nannte, glättete sich wie von Zauberhand und sein fahler, etwas gräulicher Teint wurde rosig und lebendig. Der ganze Mensch schien wie von neuen Lebenssäften durchdrungen und zu keinem Zeitpunkt liebte ich ihn inniger und ehrlicher, als dann. Deshalb ließ ich ihn oft und ausführlich erzählen, wie der junge Friedrich die noch jüngere Anna kennen gelernt hatte. So lange, bis meine Mutter dazwischen ging und seine Erzählungen mit einem „jetzt ist es aber genug, Friedl“ oder „Mila, stör deinen Vater nicht weiter, er muss sich ausruhen. In zwei Stunden beginnt schon seine nächste Schicht“. Nie hätte ich gewagt, zu widersprechen. Und auch mein Vater, der eben noch mit strahlendem Gesicht in ihrer gemeinsamen Vergangenheit war, kommentiere ihre Kommentare ausnahmslos mit einem schwachen Nicken und fiel in sich zusammen, wie ein Luftballon, dem man das Ventil öffnet.
Aber so lange es anhielt und wir zusammen saßen, wie eine kleine verschworene Gemeinschaft, ganz eng aneinandergedrückt, so dass wir voneinander die Körperwärme und jede Bewegung spüren konnten, so lange fühlte ich mich wie Alice im Wunderland. Wie jemand, der über einen Zaun springt oder eine Tür aufstößt oder einen Geheimgang entdeckt und dahinter eine neue, völlig unbekannte Welt. Eine, die bunt war, von den Farben meiner Mutter. Exotisch, laut, voller Lachen und voller Erlebnisse, die es so bei uns in der Familie nie gegeben hatte. Ich liebte die Geschichte des ersten Zusammentreffens und erhielt als Belohnung für meine Begeisterung von meinem Vater jedes Mal ein neues Detail präsentiert, dass er so in einer vorangegangenen Version weggelassen oder vergessen hatte. „Damals war ich frisch vom Studium in dieses kleine Kreiskrankenhaus gekommen. Die großen Stadtkliniken waren mir zu voll. Offen gestanden hatte ich auch ein wenig Angst davor, mein theoretisch erworbenes Wissen an richtigen Menschen anzuwenden. So schien es mir eine gute Idee, fast 100 km von meiner Universität entfernt meine Laufbahn als Arzt zu beginnen.“ Dieser Teil der Geschichte war fast immer gleich. Dennoch war ich begeistert zu hören, dass es im Leben meines Vaters etwas gegeben hatte, wovor er Angst hatte und, was noch viel wichtiger war, dass er sich freimütig eingestand. Der Teil, der dann kam, war etwas langatmig und ich musste mich zusammenreißen, um nicht zu drängeln. Schließlich verstand ich, dass es für ihn wichtig war zu erzählen, wie freundlich man ihn in der chirurgischen Abteilung aufgenommen hatte, dass ihm die Oberschwester gleich am ersten Tag zugezwinkert hatte und ihn „Spoatzl“ nannte, mit ihrem derben, österreichischen Dialekt, den sie selbst nach Jahren in ihrer neuen Heimat nicht abgelegt hatte. Er nahm, so kam es mir vor, innerlich Schwung, wenn er von seinen ersten Operationen im neuen Klinikum schwärmte und davon, dass ihn sein Vorgesetzter ob seiner hervorragenden Nähte lobte.
Читать дальше