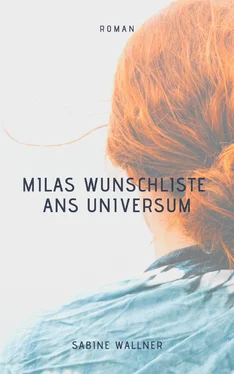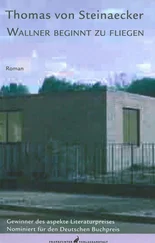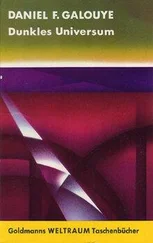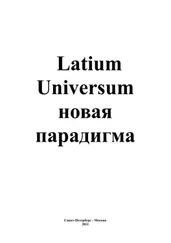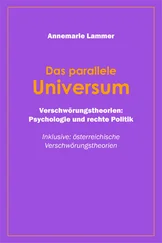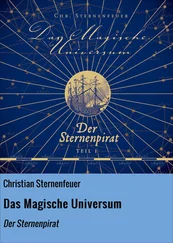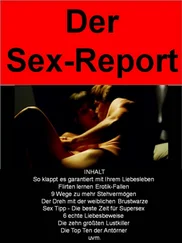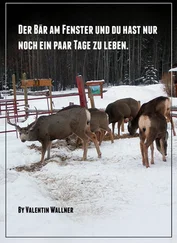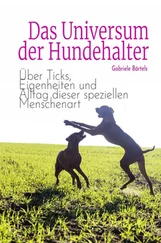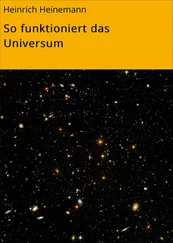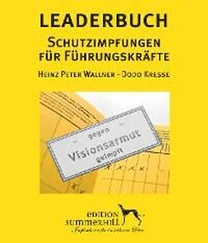Mir fiel beim besten Willen nicht ein, was ich mit dem Zeugnis und meiner Volljährigkeit anfangen sollte. Was meine Mutter zum Anlass nahm, die Fäden in die Hand zu nehmen und sich für mich um einen Studienplatz zu bewerben. Während sie vor vier Jahren, in der Zeit, als Isa nach Frankreich ging, noch frankophil war und alles kopierte, was aus Paris zu uns schwappte, war sie nun in ihrer Asia-Phase angekommen. Sie züchtete neuerdings Bonsai, trug lange Seidenkimonos und kochte ständig asiatisch. Zudem trank sie literweise Tee aus Sri Lanka an Stelle von Filterkaffee, was sie damit begründete, dass die Gerbstoffe ihr besser bekamen, als alles andere. Asien als Reiseland hatte es ihr angetan und nachdem mein Vater in den Nachrichten gehört hatte, dass die Handlungsbeziehungen zu Japan ausgebaut werden sollen, befanden sie gemeinsam, dass ihre jüngere Tochter Japanologin werden würde. Ich hatte mich noch nie mit diesem Studienfach auseinandergesetzt, im übrigen auch mit keinem anderen. Aber die Begeisterung meiner Eltern übertrug sich allmählich auch auf mich und im Laufe der Semester stellte ich erstaunt fest, dass ich tatsächlich auch eine Begabung für das Fach hatte. Ich mochte die Kultur, die Schriftzeichen und vor allem die Sprache, die ich nach knapp vier Jahren fließend sprach. Mein Selbstbewusstsein wuchs mit meinem Vokabelschatz. Vielleicht aber auch deshalb, weil meine Haut mittlerweile sehr ebenmäßig war, meine roten Haare glänzend und voll über meine Schulten fielen und mein Körper sich gestreckt und durchaus ansehnlich geworden war. Ich hatte nicht die glatte Schönheit meiner Schwester Isa, aber eine exotisch-attraktive Ausstrahlung, die mich zusammen mit meinem seltenen Studienfach zu einem beliebten Gast auf jeder Verbindungsfeier machten. Mein Leben war von einem Tag auf den anderen fast perfekt. Ein Jahr blieb mir noch bis zur Abschlussarbeit. Meine Eltern liebten mich neuerdings, ich hatte Freunde, Sex und Perspektiven. Dieses Mal würde alles gut werden!
Wie sich sehr bald herausgestellt hatte, hatte ich mich in Bezug auf die Erfolgsaussichten hinsichtlich meines in greifbare Nähe gerückten Studienabschluss verkalkuliert. Woran das liegt? Die wenigsten Menschen, denen ich bisher begegnet bin haben verstanden, dass ich mit meiner „Dreiviertel-ist-genug“-Meise in meinem bisherigen Erwachsenenleben tatsächlich noch nichts wirklich zu Ende gebracht habe. Seit ich mit zwölf Jahren unfreiwillig wieder den Weg von der Baumkrone nach unten auf den harten Boden der Tatsachen angetreten habe, ist das so. Es war also nur konsequent, dass ich auch das Studium der Japanologie, das ich auf Wunsch meiner Eltern begonnen hatte, abbrach. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass ich gar keine andere Wahl gehabt hätte.
Aber vielleicht muss ich ein wenig ausholen? Mir ist selbst klar, dass jeder von uns Neurosen oder netter ausgedrückt – Spleens hat, die man, auch wenn man sich derer bewusst ist, gar nicht so einfach wieder los wird. Ich war davon natürlich nicht ausgenommen. Kein Mensch auf der Welt ahnt etwa, dass ich beim Urinieren immer das Wasser laufen lasse, damit Menschen, die möglicherweise an der WC-Tür lauschen, nichts von meinem Plätschern auf der Kloschüssel mitbekommen. Oder dass es mir lange Zeit eine diebische Freude macht, auf dem Spielplatz liegen gebliebene Sandformen einzustecken und mit nach Hause zu nehmen. Zuhause stapelten sich die bunten Förmchen auf meinem Balkon und immer im Winter pflanzte ich Kresse-Samen darin, was hübsch aussah. Natürlich hatten diese Angewohnheiten, die ich mir im Alltag gönnte, kaum negativen Einfluss auf mein Leben, meine Gesundheit oder mein Auskommen. Dagegen war meine Unfähigkeit, etwas zu vollenden, ein ganz anderes Kaliber. Das leuchtete sogar mir ein, ich konnte nur nichts dagegen tun.
Während ich die meiste Zeit des Studiums genossen und sogar selbst an ein reguläres Ende geglaubt hatte, stieg meine Anspannung im letzten Jahr an der Universität drastisch an. Ich war einem erfolgreichen Abschluss bereits beängstigend nahe gekommen. Ich konnte mich schlecht von der Brücke stürzen, um dem Abschluss zu entkommen, also musste ich mir etwas anderes einfallen lassen. Die Lösung kam dann schneller als erhofft, verpackt in einen geselligen Filmabend. Mit Freunden aus dem Abschlussjahrgang plante ich zur Feier der bevorstehenden letzten Studienwochen einen japanischen Abend. Wir verabredeten uns zur traditionellen Teezeremonie, hatten während dessen buddhistische Ritualgesänge gelauscht und uns alle unseren traditionellen Hakama angezogen. Ein Hakama ist ein japanisches Beinkleid, das es für Männer, ebenso wie für Frauen gibt. Wunderbar bequem im Übrigen, weil es in der Regel weit geschnitten ist und durch seinen Schnitt jede Problemzone verdeckt. Wir fanden den Hakama angemessen, nachdem das Kleidungsstück in Japan in Kombination mit dem Kimono auch bei Abschlusszeremonien eine große Rolle spielt. Schließlich waren wir angehende Japanologen und hatten den Abschuss so gut wie in der Tasche. Unseren Abend sollte neben Tee, Musik und kleinen, landestypischen Gerichten auch ein echter japanischer Film bereichern. Die Auswahl dafür traf Mike, ein schlaksiger, pickeliger Mann dessen Vater im Auswärtigen Amt ein kleiner Beamter war und ihn unbedingt im diplomatischen Dienst sehen wollte. Mike war an sich eine sensible Seele, ein Feingeist und Liebhaber schöner Dinge. Als er herausfand, dass er sich zu Männern hingezogen fühlte, begann er bei einem amerikanischen Therapeuten mit zweifelhafter Zulassung eine so genannte Reparativtherapie. Vereinfacht gesagt ging es dabei darum, aus dem homosexuellen Mike einen heterosexuellen Mike zu machen. Obwohl „schwul sein“ in unseren Kreisen genauso normal war wie „in Therapie“ oder „Kind geschiedener Eltern“, wollte Mike ganz klassisch um jeden Preis die Ansprüche seines Vaters erfüllen und sich als Mitglied seiner ehrbaren Familie skandallos in die Gesellschaft integrieren. Natürlich schlug die Therapie fehl. Und natürlich begehrte Mike seine Mitstudenten mehr als denn je. Das erfuhren wir aber erst viel später, nachdem jemand nach seinem Selbstmord – er hatte sich auf die Gleise gelegt und sich vom Schnellzug den Kopf vom Rumpf trennen lassen - seine erschütternde Klageschrift ins Netz stellte.
Jedenfalls hatte Mike, zu diesem Zeitpunkt noch quicklebendig aber schwer depressiv das dystopische Werk „Battle Royale“ von Kinji Fukasaku ausgesucht. Der Film stand auf allen schwarzen Listen und hatte keine FSK-Freischaltung erhalten, war im Gegenteil in Europa als bedenklich eingestuft. In Japan erhielten Darsteller und Drehbuch dagegen hochdekorierte Auszeichnungen. Und das reichte für Mike aus, um „Battle Royal“ für die richtige Wahl als authentischen Beitrag zu unserem Abschlussabend zu halten. Rasch zeichnete sich für uns anderen ab, worum es bei „Battle Royale“ im Wesentlichen ging: Um ein Spiel, an dem Schulklassen teilnehmen müssen, um sich gegenseitig zu töten. Der Film spielt in Japans Zukunft, wo die Arbeitslosigkeit riesig und der Verdruss enorm ist und es besser ist, einen Menschen bzw. Mitkonkurrenten am Arbeitsmarkt zu verlieren als ihn am Leben zu halten. Das Grauen nahm seinen Lauf, Blut spritzte und Japans Drehbuchautoren zeigten uns in schneller Reihenfolge und in erbarmungslosen Nahaufnahmen einen Abriss sämtlicher möglichen Tötungsarten. Die Jugendlichen metzelten sich nieder mit Pistolen, Messern, mit bloßen Händen, spitzen Gegenständen, durch Prügel oder Stürze aus großer Höhe. Mike und ein paar Kommilitonen, die sich von ein paar Metern Zelluloid nicht unterkriegen lassen wollten, bestanden darauf, den Film zu Ende zu schauen. Die meisten von uns waren danach schockiert, andere einfach nur erleichtert, dass es vorbei war. Ich hingegen war in meinen Grundfesten erschüttert. „Ein Land, das derartiges Gedankengut hervorbrachte und es in diesem Maße glaubwürdig auf die Leinwand brachte, hatte meine Aufmerksamkeit nicht verdient“, würgte ich heraus. Am nächsten Tag sprach ich im Sekretariat des Dekans vor. Und wurde aus der Liste der Studierenden gestrichen.
Читать дальше