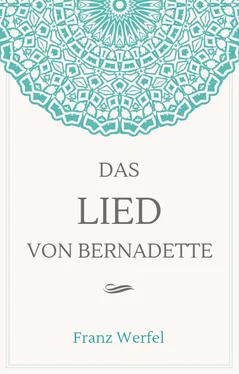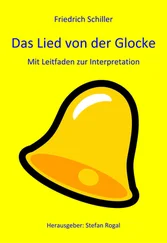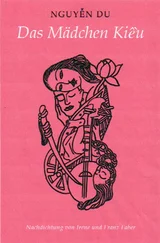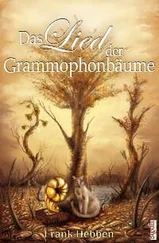Bernadette bricht plötzlich ab und geht schneller. Auf keine der neugierigen Fragen von Jeanne Abadie gibt sie mehr eine Antwort. Am östlichen Fuß des Bergleins, dort wo man das prächtige Sägewerk von Lafite sieht, wirft sie sich jäh ins Gras:
»Ich bin so entsetzlich müd ... Ruhn wir aus!« Sie drückt den Kopf fest an die nasse Erde. Möge die gefürchtete Erkältung kommen, Husten, Schnupfen, Halsschmerz, Atemnot. Ihr ist's gleich. Fast wünscht sie sich die Krankheit. Die beiden andern setzen sich neben sie auf den Boden und betrachten erstaunt ihr leidenschaftliches Gesicht. Nach einer Weile stößt sie hervor:
»Haltet mich fest! Ich möchte zurück nach Massabielle ...«
»Glaubst du vielleicht, dass deine Dame dort auf dich warten wird?« zwinkert die Abadie.
»Ich weiß es«, sagt Bernadette.
Kapitel Neun. Frau Soubirous gerät außer sich
Die Soubirous hat keinen leichten Tag gehabt an diesem elften Februar. Mehr als eine Stunde musste sie bei der Nachbarin Croisine Bouhouhorts zubringen. Es ist immer wieder dieselbe Geschichte. Unbegreiflich, warum der gütige Himmel sich dieses elenden, ganz und gar lebensuntauglichen Geschöpfes nicht erbarmt! Freilich, dieser zweijährige Junge ist das einzige Kind der Bouhouhorts, und wie alle unglücklichen Mütter fällt sie schreiend dem Tod in die Arme, anstatt ihn gottergeben gewähren zu lassen. Das Kind Bouhouhorts wird niemals auf die Beine kommen. Diese Beine sind übrigens nicht dicker als der Daumen eines Mannes und verkrümmt dazu. Alle drei oder vier Wochen kommt einer jener schrecklichen Krämpfe über das Kind, wie gerade heut. Die Krämpfe gehen vom Gehirn aus. Dann zieht es die Knie hoch, beinah bis zum Kinn, verdreht die Augen nach oben und verliert das Bewusstsein.
Louise Soubirous steht, wie alle Schwestern Casterot (allen voran die kluge Bernarde), im Ruf einer besonderen medizinischen Tüchtigkeit. Nicht nur die Bouhouhorts ruft sie zu Hilfe, sondern so manche andre Frau der Rue des Petites Fossées. Croisine jedenfalls, ein ziemlich schwächliches und unerfahrenes Weib, könnte ohne Louisens Beistand gar nicht auskommen. Sie verliert sofort den Kopf. Mutter Soubirous hat mit großem Eifer ihre bewährten Mittel angewandt. So arm sie selbst ist, sie hat mit ihrem eigenen Krankenöl nicht gespart und den ganzen Körper des Kindes damit eingerieben. Dann hat sie den Kleinen fest in heiße Tücher gepackt und ihm mit großer Mühe ein paar Tropfen eines bestimmten Tees eingeflößt. Zuletzt ist sie mit ihm eine gute halbe Stunde lang durch die Stube getanzt, das starre Körperchen unaufhörlich schüttelnd, damit sein Blut in Bewegung komme. Die Folge dieser Kur war, dass der kleine Juste sich erbrach und ihr Kleid beschmutzte. Zugleich mit dieser Katastrophe aber war auch der Krampf überwunden.
Louise Soubirous kehrt schweißübergossen und atemlos in den Cachot zurück. Zu ihrem größten Mißvergnügen gewahrt sie, dass inzwischen alle Vögel ausgeflogen sind. Jean Marie und Justin, diese Gassenjungen, haben unverschämterweise ihr strenges Verbot mißachtet und Reißaus genommen. Noch schlimmer aber erscheint es ihr, dass sich auch der Mann François davongemacht hat, ohne ihre Rückkunft abzuwarten. Es steht sehr zu befürchten, dass er »nur auf einen Sprung« bei Vater Babou eingekehrt ist, trotz des Schwurs der Enthaltsamkeit, den er ihr zum prächtigen Weihnachtsgeschenk gemacht hat. Louise sinkt erschöpft auf einen Stuhl und seufzt bewußtlos das Lied ihres Lebens, das sie so oft am Tag zu wiederholen pflegt:
»Praoubo de jou ... ich arme Frau ...«
Schon aber bindet sie sich wieder das Kopftuch um. Es fällt ihr nämlich ein, dass Madame Millet ihren Waschtag manchmal abzusagen und zu verschieben pflegt. Der Waschtag im Hause Millet ist eine geheiligte Prozedur, die unter Oberaufsicht der genauen und frommen Witwe abgehalten wird. Gegen Ende der Woche aber fährt Madame Millet dann und wann nach Argelès, um die dortigen Latapies zu besuchen. Elise Latapie, ihr heiß geliebtes Adoptivkind, vor einigen Monaten verstorben, gehört zu diesem Zweig der weitverbreiteten Familie. Wenn Madame Millet nach Argelès fährt, entfällt der Waschtag. Für Louise Soubirous entfallen damit dreißig Sous, das warme Mittagessen, das Vesperbrot und allerlei kulinarische Zuwendungen, die ihr die Hausfrau oder die Köchin für die Kinder einpackt. Sie hat die bestimmte Empfindung, dass heute ein ungünstiger Tag ist, an dem alles schiefgeht und somit vermutlich die Absage der freitägigen Wäsche erfolgen werde.
Heftig wirft sie die schwere Tür des Cachots hinter sich zu. Onkel Sajou, der Steinmetz und Hausbesitzer, hockt auf dem oberen Treppenabsatz und raucht feierlich seinen Knaster. Madame Sajou duldet nämlich nicht, dass er »den Salon verstinkt«. Im Gegensatz zu den Soubirous, die nur aus Gnade und Barmherzigkeit das Gefängnis bewohnen dürfen, nennen die Sajous drei kleine Räume ihr eigen, von denen einer, mit ererbten Möbeln angefüllt, als Salon, das heißt als Kapelle der Bürgerlichkeit, geschont und verehrt wird.
»Lieber Vetter André«, sagt Louise gehetzt. »Ich springe nur auf drei Minuten zu Madame Millet ... Gleich bin ich wieder zurück ...«
André Sajou krümmt müde den linken Zeigefinger zum Zeichen, dass er begriffen habe. Die Steinbildnerei ist ein wortkarges Handwerk, gelten doch Granit und Marmor, vorzüglich zu Grabkreuzen verarbeitet, als Sinnbilder des Schweigens. Den Soubirous gegenüber pflegt aber Onkel Sajou sein Schweigen noch zu übertreiben, man ist zwar verwandt – in Lourdes ist alles miteinander verwandt –, der Mißerfolg jedoch zwingt zur Vorsicht wie eine ansteckende Krankheit. Man tut seine Christenpflicht, hält aber womöglich Abstand, um nicht mitverwickelt zu werden in die Misere.
Das Haus von Madame Millet liegt an der Ecke der Rue Bartayrès. Es ist eins der stattlichsten Häuser Lourdes'. Als Monseigneur Bertrand Sévère Laurence, Bischof von Tarbes, auf seiner letzten Diözesanreise nach Lourdes kam, stieg er weder bei dem Dechanten Peyramale im Pfarrhaus noch auch im Konvent der Schwestern von Nevers ab, sondern bei der steinreichen Witwe, wo seitdem ein eigenes Appartement für ihn bereitgehalten wird. Frau Millet hat sich diese Auszeichnung durch die kirchliche Obrigkeit wohl verdient, denn sie ist nicht nur eine fromme, sondern auch eine streitbare Katholikin. Monseigneur, der scharfsinnig praktische Mann, findet zwar die Zimmer von Madame Millet mit ihrer Überschwemmung von Gardinen, Vorhängen, Überzügen, Spitzendecken recht muffig. Die Betten gleichen beklemmenden Aufbahrungen. Sie schrein gewissermaßen danach, dass man in ihnen sterbe. Selbst die dicke Kerze auf dem Nachttisch ist ein Kirchenlicht. Überdies bezeigt die gute Millet für den Geschmack des Kirchenfürsten eine allzu fürwitzige und allzu oberflächliche Neugier für jenseitige Angelegenheiten. Es ist schon die reinste Geisterseherei, welche sich nach dem Tode der Nichte Elise Latapie, die sie an Kindes Statt angenommen, ins Unerlaubte gesteigert hat. Andrerseits aber – und das ist für Monseigneur maßgebend – leben soundso viele Organisationen von den Unterstützungen der vermögenden Rentnerin. Man denke nur an den Verein der Marienkinder, dem man nicht nur prächtige Feste alljährlich, sondern auch zahlreiche Werke der Caritas verdankt. Und dies ist bloß einer von sieben Vereinen.
Louise Soubirous setzt den altmodischen Türklopfer in zaghafte Bewegung. Der ehrwürdige Philippe, Madame Millets Diener, öffnet ihr höchst persönlich. Der Anblick dieses makabren Philippe, das Bild des dunklen Vorsaals, den ein Hauch von Naphthalin und Tod durchweht, erfüllt das Herz der Soubirous jedes Mal mit erschauernder Ehrfurcht. Wie in allen Räumen dieses Hauses, so herrscht auch hier der Horror Nudi, der Abscheu vor dem Nackten, darum sind alle Wände mit ganz dunklen Bildern zugeklebt und alle Gegenstände mit zahllosen vergilbten Spitzendecken belegt, die Louise sehr genau aus der Wäsche kennt. Sie werden immer gelber.
Читать дальше