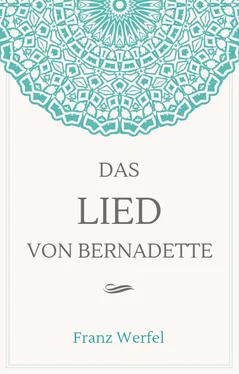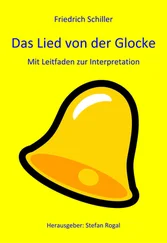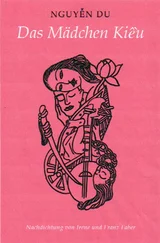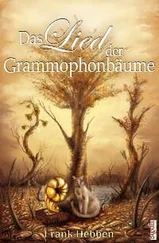Kapitel Zehn. Bernadette darf nicht träumen
Knapp nach dieser häuslichen Szene treten ein paar bescheidene Ereignisse ein, die auf eine günstige Wendung im Geschick der Familie hinzudeuten scheinen. Tante Sajou ist eine gutmütige Person. Die gellende Stimme der Soubirous hat sie vorhin erschreckt. Es sind doch sonst recht stille Leute, diese Soubirous, falls man nicht gerade an die beiden Knaben denkt. Wenn Louise Casterot, die so eingebildet ist auf ihre Herkunft, sich gehen lässt, dann muss das Wasser ziemlich hoch stehen. Madame Sajou besitzt einen üppigen Vorratsschrank. Sie öffnet ihn mit einem Seufzer, der ihrer eigenen Güte gilt. In Gottes Namen! Sie schneidet von ihrem Butterkoloß ein Eckchen ab und ein Stück von ihrer Speckseite. Weil aber nicht nur im Wohltun, sondern auch in der Überwindung des Geizes ein Stachel der Wollust steckt, so legt sie noch sechs schmale Scheiben der guten Bauernwurst auf den Teller, für jeden eine. Mit diesen Gaben in der Hand, klopft sie an der festen Tür des Cachots an.
Die Soubirous, die am Herde steht, lässt vor Erstaunen den hölzernen Kochlöffel in die Wassersuppe fallen, die sie aufs Feuer gesetzt hat.
»Oh, meine liebe Cousine, Euch sendet die Allerseligste Jungfrau selbst, weil ich sie heute auch recht fleißig angerufen hab ...«
Da das Reisigfeuer allzu lustig brennt und die Sajou über ihre eigene Güte recht bewegt ist, ruft sie ihrem Mann ins Stiegenhaus zu, er möge einen Arm der trockensten Holzklötze herunterbringen. Ehe aber der gehorsame Ehegatte, der so wortunlustig ist, dass er seiner Alten niemals widerspricht, diesen Befehl ausgeführt hat, schneit ein neues Geschenk in den Cachot. Croisine Bouhouhorts hat Besuch aus dem Dorf Viger bekommen. Es ist eine alte Bäuerin, eine Tante, die ihr alljährlich um diese Zeit ein Faschingspräsent zu bringen pflegt. Diesmal sind es zwei Dutzend Eier. Kaum ist der Besuch aus dem Haus, rennt die Bouhouhorts mit dem Eierkorb schnurstracks zu den Soubirous herüber. Sie ist, wie immer, gehetzt und atemlos:
»Ihr müßt mir die große Freude machen, liebe Nachbarin, und diese Eier annehmen. Meinem Kleinen habt Ihr doch heute das Leben gerettet ...«
Louise Soubirous ziert sich nicht sehr. Auch sie ist überzeugt davon, dass Croisinens Unglückswurm ohne ihr Geschüttel nicht mehr am Leben wäre. Während sie sich die Hände wischt und den Korb mit Dankesworten in Empfang nimmt, berechnet sie, dass sie aus zehn Eiern und der Butter eine höchst ansehnliche und mit Speckscheiben gefüllte Omelette herstellen könne. Die Augen tränen ihr vor wildem Appetit bei diesem Gedanken. Endlich wird man etwas Anständiges in den Magen bekommen. Wer weiß, ob ihre Kinder all den Unfug mit wunderschönen Damen nicht nur deshalb ersinnen, weil sie schon seit Tagen nicht satt geworden sind. – Das Gesetz der gehäuften Zufälle aber will es, dass neben diesen flüchtigen Aufbesserungen jetzt noch eine dauerhaftere Gunst des Schicksals eintritt. Und zwar tritt sie leibhaftig ein in der Gestalt Louis Bouriettes.
Louis Bouriette ist, gleich François Soubirous, ein Gelegenheitsarbeiter. Ein ehemaliger Steinklopfer wie Onkel Sajou, hat er es aber nicht so weit gebracht wie dieser. Für sein Unglück macht er den Splitter verantwortlich, der ihm die Hornhaut des rechten Auges verletzt hat, so dass er auf diesem Auge nichts mehr sieht. Bouriette ist ein selbstbewußter Invalide. »Ich bin ein Blinder«, sagt er täglich zwanzigmal, »und was kann man von einem Blinden wollen?« Auch ihn beschäftigt der Postmeister Cazenave fallweise als Boten und Briefträger. Cazenave hat Bouriette jetzt zu Soubirous geschickt. Folgendes nämlich ist vorgefallen. Der Kutscher Cascarde, der den Postomnibus nach Tarbes lenkt, ist durch einen Huftritt ziemlich stark zu Schaden gekommen. An seine Stelle rückt der Pferdewärter Doutreloux auf. Die Stelle dieses Pferdewärters und Hilfskutschers ist nun für Soubirous frei. Ein Müller weiß, nach Cazenaves Erfahrungen, auch immer gut mit Pferden umzugehen. Der Postmeister bezahlt für diese Stellung zwei Franken täglich und das Mittagessen. Wenn Soubirous einverstanden sei, so möge er morgen um fünf Uhr früh seinen Dienst antreten. Louise faltet die Hände. Der Hausvater aber steht nachdenklich da in seiner hochgeschlossenen Würde und scheint das Für und Wider dieses überraschenden Angebots reiflich zu erwägen.
»Es war ausgemacht zwischen Cazenave und mir«, sagt er endlich selbstbewußt, »dass er mich haben will, wenn etwas frei wird bei ihm. Schließlich sind wir alte Kameraden vom Militär. Als Mühlenbesitzer bin ich freilich andere Arbeit gewöhnt. Wenn man aber so viele Kinder hat, so hat man auch keine Wahl, heutzutage. Ich werde auf dem Posten sein, morgen früh ...«
Und er wischt sich den Schweiß, dessen Ausbruch er trotz seiner tadellosen Haltung nicht verhindern kann. Dann blinzelt er im Kreis umher. Eine schlaue Vergnügtheit breitet sich über seine Züge. Der Südfranzose erwacht. Eine noble, große, prahlerische Gebärde: »Unsere Verwandten und Freunde hier, die uns mit Geschenken überhäufen, sind eingeladen, uns die Ehre zu geben heute abend bei unserm bescheidenen Diner. Es wird eine saftige Omelette zubereitet werden, wie ich die Meinige kenne ...«
Allgemeiner Protest. Auch Louise würde am liebsten protestieren. Der Leichtfuß opfert an einem Abend alle Eier auf, von denen die Familie drei Tage lang leben könnte. Die Soubirous ist aber immer schwach gewesen den Schwächen ihres Mannes gegenüber. So oft hat sie ihn gewähren lassen wider ihren eigenen besseren Instinkt. Ohne seine großmännische Ungenauigkeit hätte man wahrscheinlich weder die Boly-Mühle noch die Escobé-Mühle und schließlich auch die Bandeau-Mühle nicht aufgeben müssen. Nur um als überlegener Spendierer dazustehen, hat er die knauserigsten Kunden mit Wein und Imbiß traktiert. Die Folge war, dass diese Bauern und Bäcker, die jeden Sou dreißigmal umdrehen, Mißtrauen faßten gegen den verschwenderischen Müller. Mit Leichtsinnigen macht man nicht gern Geschäfte. Leider aber ist die Soubirous nicht nur schwach gegen die Schwächen ihres Mannes, sondern besitzt sogar eine ausgesprochene Schwäche selbst für viele dieser Schwächen. Wenn er bei der geringsten Glücksfügung von einer Minute zur andern das Elend abschüttelt wie ein Hund die Regentropfen, wenn er unternehmend dasteht wie jetzt, als ein Einlader und großer Herr, da gefällt er ihr, der alte Müllerbursch François, da muss sie laut auflachen selbst nach diesem Tag. (Von wem hat's die Bernadette, mit ihrer Märchenerzählerei?) Louise wiederholt die Einladung, nicht etwa zögernd, sondern mit wohlgesetzten Worten, denn sie ist bekanntlich gut erzogen:
»Man wird es mir doch nicht antun, meine Omelette zurückzuweisen. Man wird doch wenigstens kosten davon. Auch unsereins will einmal ein bisschen Fasching feiern ...«
Das Wort »kosten« baut eine Brücke. Wer kostet, der stillt nicht seinen Hunger. André Sajou macht seiner Frau den Vorschlag, das eigene Abendessen mit dem der Soubirous zusammenzulegen. Der Steinmetz, dessen erwachsene Kinder längst nicht mehr zu Hause sind, ist ganz froh, einen Abend in Gesellschaft verbringen zu können, und sei es auch nur im Cachot. Er stellt einen großen Krug seines eigenen Weins auf den Tisch. Inzwischen beginnt die große Omelette schon zu duften. Während die Soubirous sie auf der Pfanne herumwirft, schickt sie ein Dankgebet zur Jungfrau, weil für die nächsten Wochen der Hunger gebannt ist. Bouriette, der Glücksbote, will sich empfehlen. Soubirous hält ihn mit beiden Armen zurück. Die Erwachsenen nehmen am Tisch Platz, so gut es geht. Die ausgehungerten Kinder setzen sich dicht gedrängt auf die schmale Bank, die in der Nische steht zwischen Kamin und Fenster, Bernadette neben Justin, Marie neben Jean Marie. Die Mutter lässt es sich nicht nehmen, ihren Kindern das Essen zuerst zu geben, einen Anteil der Omelette, die Suppe und die Wurst aufs Brot. Tante Sajou bringt jedem ein Glas des dunklen, guten Weins. Man hat wahrhaftig ein Faschingsfest.
Читать дальше