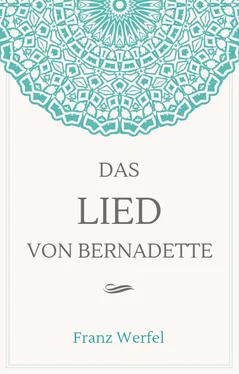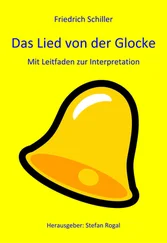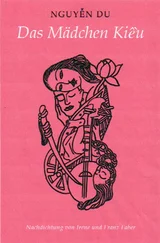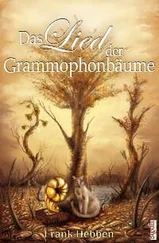Das Auffälligste aber bemerkt Bernadette zuletzt. Die junge Dame geht bloßfüßig. Die schmalen kleinen Füße wirken elfenbeinern, ja fast alabastern. Nicht das geringste Rot oder Rosa ist ihrer Blässe beigemischt. Es sind völlig ungebrauchte Füße. Sie bilden einen merkwürdigen Gegensatz zu der sonst so lebendigen Körperlichkeit des zierlichen Mädchens. Das Verwunderlichste aber sind die goldenen Rosen, die über den Wurzeln der langen Zehen an beiden Füßen angebracht sind, man sieht nicht wie. Man erkennt auch nicht, von welcher Art diese beiden Rosen sind, ob feinste Bijouterie oder stark aufgetragene Malerei.
Zuerst empfindet Bernadette einen kurzen zuckenden Schreck und dann eine lange Furcht. Es ist dies aber keine Furcht, die ihr bekannt ist, keine Furcht, die einen zwingt aufzuspringen und davonzurennen. Es ist eine weiche Umklammerung der Stirn und der Brust, von der man wünscht, sie möge dauern und dauern. Später löst sich diese Furcht in etwas auf, wofür dieses Kind Bernadette keinen Begriff hat. Am ehesten könnt es Trost heißen oder Tröstung. Bernadette hat bis zu diesem Augenblick nicht gewusst, dass sie trostbedürftig sei. Sie weiß ja gar nicht, wie schwer ihr Leben ist, dass sie Hunger leidet, dass sie im finstern Loch des Cachots mit fünf Menschen zusammen haust, dass sie nächtelang um Atem ringen muss. Das war seit je so und wird wahrscheinlich immer so sein. Es ist die nackte Selbstverständlichkeit. Jetzt aber ist sie mehr und mehr eingehüllt von diesem Trost, der keinen Namen hat, der eine heiße Flut von Erbarmen ist. Hat sie Erbarmen mit sich selbst? Ja! Aber das Selbst dieses Kindes ist jetzt so aufgesprengt, so weltenweit, dass die Süßigkeit des Erbarmens seinen erschauernden Körper durchdringt bis in die Spitzen der jungen Brüste.
Während aber die Wellen dieser liebeerschütterten Getrostheit Bernadettens Herz überspülen, bleiben ihre Augen unablässig, frei und fest auf das Antlitz der jungen Dame gerichtet. Diese ist ihrerseits damit beschäftigt, ihr Antlitz dem Mädchen darzubieten, darzubringen. Obwohl es ruhig dort in der Nische verweilt, scheint es immer näher zu kommen, je mehr Bernadettens Blick sich daran festsaugt. Sie könnte die Schläge der Wimpern zählen, die dann und wann, sehr selten, das herrliche Weiß und Blau der Augen verdecken. Der Teint ist trotz seiner Makellosigkeit so lebendig, dass man an den leicht geröteten Wangen die Frische des Wintertags ablesen kann. Die Lippen sind nicht etwa feierlich zusammengepresst, sondern stehen ein wenig offen, wie unbewusst, und lassen den jugendlichen Schmelz der Zähne durchschimmern. Bernadette aber bemerkt gar nicht die einzelnen Elemente dieser Lieblichkeit, sondern schaut und schaut das Ganze.
Es kommt ihr gar nicht der Gedanke, sie habe es hier mit etwas Himmlischem zu tun. Bernadette kniet nicht im Dämmer einer Kirche. Sie sitzt auf einem Steinblock, nah an der Mündung des Savy-Bachs in den Gave, in dieser kahlen, klaren Februarwelt und hält ihren Strumpf in der schlaffen Hand. Nichts Andres ist ihr bewusst als die nie erträumbare Schönheit dieses Frauenbilds, von der sie trunken ist, unersättlich. Die Schönheit der Dame ist die erste und letzte Macht, die das Kind der Soubirous nicht freigibt.
In der Lähmung ihres Entzückens besinnt sich Bernadette plötzlich, dass ihr Benehmen unstatthaft sei. Sie sitzt, und die Dame steht. Auch geniert es sie, dass ihr rechter Fuß unbekleidet ist und der andre einen Strumpf trägt. Was tun? Schuldbewußt erhebt sie sich. Die Dame lächelt befriedigt. Dieses Lächeln ist eine weitere Auflichtung ihrer Holdseligkeit. Bernadette vollführt nun das linkische Kompliment der Schulmädchen von Lourdes, wenn sie einer der Lehrschwestern, dem Abbé Pomian oder gar dem Herrn Pfarrer Peyramale auf der Straße begegnen. Die Dame beeilt sich, diesen Gruß zu erwidern, bei weitem nicht so herablassend wie die genannten Autoritäten, sondern voll freier Kameradschaftlichkeit. Sie nickt mehrere Male, und ihr Lächeln wird noch um einen Grad heller. Der Gruß schafft eine neue Lage. Die Beziehung hat sich angesponnen. Zwischen der Beglückten und der Beglückenden entsteht und wogt hin und her ein Strom der freudigsten Sympathie, des ältesten Verbundenseins, ja das Innewerden einer herzbewegenden Mitverschworenheit. Jesus und Maria, denkt Bernadette, sie steht und ich stehe. Damit ein verehrender Unterschied sei zwischen ihrer Haltung und der der Dame, kniet sie aufs Ufergeröll nieder, das Gesicht voll der Nische zugewandt.
Wie um zu beweisen, dass sie die Absicht des Mädchens verstanden habe, macht die Dame mit ihren alabasternen Füßen, auf denen die goldenen Rosen erglänzen, ein Schrittchen aus dem Portal auf den äußersten Rand des Felsens. Weiter kann oder will sie nicht kommen. Dann öffnet sie ein wenig die Hände, eine umfangende oder emporziehende Gebärde andeutend. Die Hände gleichen den Füßen an Schmalheit und Blässe. An ihren Innenflächen ist kein Rot oder Rosa zu bemerken.
Es geschieht nun längere Zeit nichts. Die junge Dame scheint vielleicht gezwungen, oder besser, willens zu sein, Bernadette die ganze Initiative zu überlassen. Diese aber hat längere Zeit keinen Einfall mehr, sondern kniet nur und schaut und schaut und kniet. Dadurch breitet sich zwischen beiden eine sanfte Verlegenheit aus, die das Mädchen ein wenig bedrückt, das im Gefühl seiner dienstbaren Unwürdigkeit der Dame die Begegnung mit aller Kraft erleichtern möchte.
Zugleich aber beginnen in dem verzückten Geiste Bernadettens kleine Wachheiten aufzubrechen, spitze Punkte erwägender Bewusstheit. Woher ist die Dame gekommen? Aus dem Innern der Erde? Kann etwas Gutes aus dem Innern der Erde kommen? Das Gute, das Himmlische kommt von oben. Es benützt Wolken und Sonnenstrahlen als Fahrzeuge, um sich herabzusenken, wie die Bilder in den Kirchen es darstellen. Wer aber immer die junge Dame ist und woher sie auch auf ihren bloßen Füßen gekommen sei, ob auf natürlichem, ob auf nicht natürlichem Wege, eines bleibt unverständlich: warum hat sie sich gerade Massabielle ausgesucht, die schmutzige Felsenhöhle, diesen Ort des Hochwassers, der angespülten Knochen, des Gerölles, der Schweine, der Schlangen – einen Winkel, den alle Welt verabscheut?
Bernadettens Argwohn nimmt sich selbst nicht sehr ernst. Ihr ganzes Wesen jubelt über die Schönheit der Dame. Es gibt keine Schönheit, die rein körperlich wäre. In jedem Menschengesicht, das wir schön nennen, bricht ein Leuchten durch, das, obwohl an physische Formen gebunden, geistiger Natur ist. Die Schönheit der Dame scheint weniger körperlich zu sein als jede andere Schönheit. Sie ist das geistige Leuchten selbst, das Schönheit heißt. Überwältigt von diesem Leuchten und ein bisschen auch, um sich über die Wesensart der Dame zu vergewissern, will Bernadette ein Kreuz schlagen.
Die Bekreuzung ist ein sehr probates Mittel gegen die tausend Ängste der Seele, die Bernadette seit ihrer Kindheit verfolgen. Da sind nicht nur die ungeheuerlichen Träume der Nacht. Auch am helllichten Tage sind ihre Augen mit der Gabe gesegnet, in alle Dinge wie in Rahmen Bilder hineinsehen zu müssen. Die Wände des Cachots strotzen von großen, feuchten Flecken. Wenn man im Winkel hockt oder morgens schlaflos die Mauern anstarrt, nehmen diese Flecken im raschen Wechsel die unglaubwürdigsten Formen an. Diese Formen sind zumeist dem dämonischen Bereich des Verzerrten und sinnlos Zusammengesetzten entsprungen. Auch spielt Orphide, der große bärtige Ziegenbock der Bäuerin Laguès in Bartrès, unter diesen Gesichtern eine häufig wiederkehrende Rolle. Einst hat das bösartige Tier die kleine Hirtin mit eingelegten Hörnern über eine Wiese gejagt. (Oh, warum muss gerade sie, die das Süße liebt, das Reizende, Niedliche, Gefällige, so oft scheußlichen Phantomen ausgesetzt sein?)
Bernadette, den Blick auf die blutlosen Füße der Dame geheftet, will die Hand heben, um ein Kreuz zu schlagen. Es ist unmöglich. Der Arm hängt schwer und lahm herab wie eine fremde Last. Nicht einen Finger kann sie rühren. Auch diese Lähmung ist ihr nicht unbekannt aus Angstträumen, wenn gegen den Andrang des Teuflischen Muskeln und Stimme versagen, um den Beistand des Heilands anzurufen. Jetzt und hier aber scheint ihre Ohnmacht, den Arm zu heben, einen besonderen Grund zu haben. Vielleicht hat die Dame ihre abwägenden Gedanken erraten und will sie bestrafen dafür. Vielleicht aber hat Bernadette selbst, mit dem Versuch sich zu bekreuzen, die gute Sitte verletzt und einen unverzeihlichen faux pas begangen. Denn was das Kreuz anbetrifft, so gehört zweifellos der Dame dort der unbedingte Vorrang.
Читать дальше