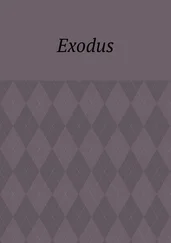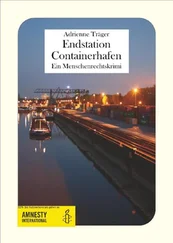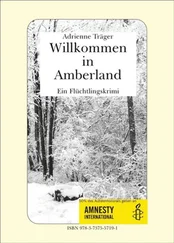Statt einer Antwort hatte die „Tante“ ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Wer sie eigentlich glaube, dass sie sei? Man sei schließlich so gut zu ihr, dass man sie als fremdes Kind bei sich wohnen lasse, ihr etwas zum Essen und zum Anziehen gebe und das, obwohl man selber wenig habe. Und das sei immerhin keine Selbstverständlichkeit. Vier Säcke Reis habe die Familie als Vermittlungsgebühr bezahlt, damit ein dahergelaufenes Mädchen aus den Bergen ein anständiges Zuhause bekam. Plus die Kosten, die sie täglich für ihren Unterhalt verursachte. Da wäre es das mindeste, dass sie der Familie etwas zurückgab und arbeitete.
Sie hatte sich daraufhin in ihr Schicksal gefügt und es weitestgehend akzeptiert. Was blieb ihr auch für eine andere Wahl? Sie war alleine, ihre Familie war weit weg und für ihre eigene Familie wäre sie vermutlich auch nur eine Belastung, sonst hätte sie sie nicht weggegeben.
Das hatte sie zumindest gedacht, bis sie neulich die Frau aus Europa am Brunnen getroffen hatte. Sie wusste nicht, wo Europa war und was eine Hilfsorganisation ist. Aber die Frau war so nett zu ihr gewesen, dass sie ihr vertraut hatte. Sie hatte ihr sogar geholfen, den schweren Wasserkanister bis fast nach Hause zu tragen. Dabei hatte sie ihr erzählt, dass es viele Kinder wie sie gäbe, doch das an sich war nichts Neues für sie. Sie kannte viele dieser Kinder, traf sie sie doch jeden Tag am Brunnen, wenn sie Wasser holte. Die Frau hatte sich für sie interessiert, sie gefragt, wo sie herkomme und wie sie zu ihrer „Gastfamilie“ gekommen sei. Sie wollte auch wissen, ob die „Tante“ sie schlage. Nun ja, manchmal schon, aber dann hatte sie es meistens wohl auch verdient, weil sie schlecht gearbeitet hatte. Die Frau war daraufhin stehen geblieben, hatte sie sehr ernst angesehen und ihr erklärt, kein Kind verdiene es, geschlagen zu werden, egal wofür, denn auch Kinder hätten Rechte, darunter auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Sie hatte das Mädchen auch gefragt, ob sie einmal mit der „Tante“ reden solle, doch das hatte die Kleine nicht gewollt. Sie hatte Angst, dass die „Tante“ sie wieder schlagen würde, wenn sie erführe, dass sie mit jemanden über ihre Situation gesprochen hatte.
Die Frau hatte sie mehrfach an dem Brunnen abgepasst und mit ihr gesprochen. Sie hatte ihr erzählt, dass sie mit anderen Leuten ihrer Hilfsorganisation ein Kinderheim gebaut habe. Dort könnten Kinder wie sie ein normales Leben führen. Sie könnten spielen und zur Schule gehen und müssten nicht mehr arbeiten. Wenn sie es wollte, könnte sie mitkommen. Und die „Tante“? Sie erklärte ihr, dass die „Tante“ kein Recht habe, ihr vorzuschreiben, dass sie bei ihr bleiben müsse, denn sie sei keine Verwandte und das, was die „Tante“ mit ihr mache, sei nicht rechtens, denn, wie gesagt, auch Kinder hätten Rechte, zum Beispiel das Recht, zur Schule zu gehen und zu spielen.
Darüber dachte sie in dieser Nacht nach, als sie auf der zerschlissenen Matte im Hof lag und die funkelnden Sternbilder betrachtete. Das Leben in den Bergen war arm gewesen, aber nicht so erbärmlich, wie das Leben hier. Viel schlimmer konnte es anderswo auch nicht sein. Langsam aber sicher reifte in ihr ein Entschluss.
Am nächsten Tag traf sie die Frau am Brunnen wieder. Sie begrüßte sie und fragte, ob sie dieses Heim für Kinder einmal sehen könne. Aber natürlich. Die Frau führte sie zu einem Auto. Sie stiegen ein und fuhren gemeinsam ans andere Ende der Stadt. Dem Mädchen gefiel es. Alles war bunt, die Kinder hatten sogar einen richtigen Spielplatz mit einer Rutsche und einer Schaukel. Die Frau zeigte ihr auch die Zimmer. Auch hier war alles bunt und es gab richtige Betten, die sehr bequem aussahen. Und sie müsste hier auch wirklich nicht arbeiten? Nein, arbeiten würden hier nur Erwachsene. Und die Schule? Die Frau zeigte ihr einen Gebäudeteil, in dem sich Klassenzimmer befanden. Ob es ihr gefalle? Ja, das tat es. Sie willigte ein, zu bleiben. Eine freundliche Frau gab ihr schöne, neue Sachen zum Anziehen, sie wurde den anderen Kindern vorgestellt und bekam ein Zimmer zugeteilt, das sie sich mit drei anderen Mädchen teilte. Dieses Mal gab es am nächsten Morgen kein böses Erwachen wie beim letzten Mal. Es war ganz genau so, wie die Frau es ihr versprochen hatte. Hin und wieder sah sie sie noch mal, wenn sie neue Kinder in das Heim brachte.
Eines Tages wurde sie gefragt, ob sie Lust hätte, in die Berge zu ihrer Familie zu fahren. Man habe sie ausfindig gemacht und wenn sie wollte, könnte sie sie besuchen. Mittlerweile war es fünf Jahre her, dass sie ihre leibliche Familie das letzte Mal gesehen hatte. Sie war sich nicht sicher, ob sie ein Wiedersehen wollte. Sicherlich hatten die Eltern es nur gut gemeint, als sie sie damals dem Mann mitgaben, damit sie als Restavek in den Slums der Stadt wohnte. Die Eltern waren naiv gewesen und konnten nicht wissen, dass sie ihre Tochter für zwei Säcke Reis in die Leibeigenschaft verkauft hatten. Doch irgendwo tat es ihr weh, dass die Eltern sie überhaupt weggegeben hatten. Arm oder nicht – sollten Eltern nicht für ihre Kinder da sein? Was war schon Reichtum gegen die Liebe und Geborgenheit, die die eigene Familie einem geben konnte? Sie wusste nicht, ob sie sie zu diesem Zeitpunkt wiedersehen wollte. Sie musste darüber nachdenken.
Artikel 5 Verbot der Folter
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
„Also, wenn Sie mich fragen, dann hat irgendetwas dem Mann die Sprache verschlagen. Sie sollten ihn einem Traumaspezialisten vorstellen.“ Der Arzt verabschiedete sich von den Mitarbeitern der Flüchtlingsunterkunft und ging. Die Mitarbeiter hatten ihn geholt, weil bei dem Neuzugang bald die Anhörung für das Asylverfahren anstand. Doch bis heute hatte der Mann kein einziges Wort gesprochen. Zunächst hatten sie gedacht, er sei taub. Da er aber auf Geräusche in seiner Umgebung reagierte, konnte es das nicht sein. Dann hatten sie gedacht, er verstehe sie nicht und mehrere Dolmetscher hinzugezogen. Er hatte einem von ihnen mit Gebärden deutlich gemacht, dass er Zettel und Stift haben wollte und hatte seine Personalien aufgeschrieben. Sie deckten sich mit den Angaben in seinem Pass. Auf die Frage, warum er nach Deutschland gekommen sei, schüttelte er nur stumm den Kopf. Überhaupt wirkte er ständig geistesabwesend. Die Sozialarbeiter waren mit ihrem Latein am Ende. Immer wieder versuchten sie, dem Mann mit Hilfe eines Dolmetschers klar zu machen, dass bald seine Anhörung stattfinden würde. Man würde ihn nur einmal anhören und wenn er dort keine Angaben machte, würde man ihn zurückschicken. Er nickte und bedeutete ihnen, dass er sie verstanden hatte, doch er sagte nichts.
Der Arzt hatte Recht. Es hatte ihm in der Tat die Sprache verschlagen. Man hatte ihn einst mit Gewalt zum Reden gebracht und er hatte geredet, bis er nichts mehr zu sagen gehabt hatte. Dann war er verstummt und seit dem war er auch stumm geblieben.
Die Mitarbeiter rätselten, was ihm passiert sein konnte, dass er nicht reden wollte. Sie hatten schon gemerkt, dass er panische Angst vor Hunden hatte; dass er, sobald das Licht im Schlafsaal gelöscht wurde, seine Taschenlampe einschaltete, um nicht im Dunkeln zu sein; dass er ein Problem in kleinen, geschlossenen Räumen hatte; dass Wasser ihm unangenehm war und dass er um die Verschläge, in denen die Mülltonnen untergebracht waren, immer einen extra großen Bogen machte. Erklären konnten sie sich dieses Verhalten nicht.
Er nahm es ihnen nicht übel. Sie konnten nicht wissen, was er in seinem Heimatland alles erlebt hatte. Und er konnte es ihnen nicht erzählen. Alleine die Vorstellung, das, was man ihm in seiner Heimat angetan hatte, in Worte zu fassen, ließ Panik in ihm aufsteigen. Ganz davon abgesehen, dass ihm schon die bloße Erinnerung daran die Kehle zuschnürte, war es ihm unmöglich, Worte zu finden, die die Schrecken, die er erlebt hatte, in ihrer Gänze hätten wiedergeben können. Und selbst wenn das möglich gewesen wäre, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass die Menschen, denen er es hätte erzählen können und wollen, verstanden hätten, welche Qualen er durchlitten hatte. Folter musste man selbst erlebt haben, um nachfühlen zu können, wie sie einen zerbrach. So glaubte er zumindest. Auch er hätte es nicht verstanden, hätte er es nicht am eigenen Leib erlebt. Auch er hatte früher bei dem Wort „Folter“ an das Mittelalter gedacht. An Praktiken einer längst vergangenen Zeit, die mit unserer modernen Welt nicht viel gemein hatten. An Objekte, die man sich im Museum ansah und die man mit einer Mischung aus Neugier und Entsetzen bestaunte, während man darüber nachdachte, was für ein perverser Geist unsere Vorfahren wohl beseelt haben musste, dass sie sich solche Dinge einfallen ließen, um sie anderen Menschen anzutun. Unwirklich war es gewesen und sehr weit weg. Nie hätte er gedacht, dass diese Perversion der Vergangenheit auch in unseren modernen Zeiten existierte, dass es Menschen gab, die Techniken optimiert hatten, um effizienter foltern zu können und dass noch nicht einmal ausgefeiltes Gerät notwendig war, um den Willen und den Lebensgeist eines Menschen zu brechen. Denn wer das möchte, der findet Mittel und Wege es so zu tun, dass es keine sichtbaren Spuren hinterlässt, damit man ihm nicht nachweisen kann, dass er es getan hat.
Читать дальше