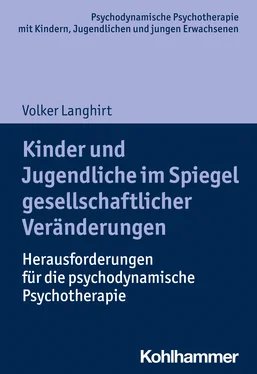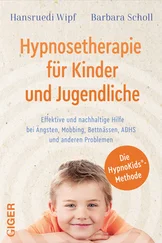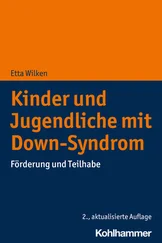Literatur zur vertiefenden Lektüre
Günter, Michael (2015): Das schwierige Verhältnis der Generationen: Angst, Neid und Dankbarkeit. In: Kinderanalyse 23 (2), S. 129–150.
Hohl, Joachim (1989): Zum Symptomwandel neurotischer Störungen. In: Keupp, Heiner, Bilden, Helga (Hrsg.), Verunsicherungen. Das Subjekt im gesellschaftlichen Wandel. Göttingen: Hogrefe, S. 103–124.
Lenz, Karl, Schefold, Werner, Schröer, Wolfgang (2004): Entgrenzte Lebensbewältigung. Jugend, Geschlecht und Jugendhilfe. Weinheim: Juventa.
Schröder, Achim (2006): Bewältigungen in der Adoleszenz und Entgrenzung der Jugendphase. Was bleibt und was sich wandelt. In: Deutsche Jugend, Bd. 2, S. 74–80.
Stierlin, Helm (1980): Eltern und Kinder. Das Drama von Trennung und Versöhnung im Jugendalter. 8. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Walter, Heinz (Hrsg.) (2012): Das Väter-Handbuch. Theorie, Forschung, Praxis. Gießen, Lahn: Psychosozial.
Wolffheim, Nelly (1927): Vom Gegensatz der Generationen. In: Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik, Heft 7,8,9, S. 239–244.
Die Werke von Hans Hopf und Inge Seiffge-Krenke, die auch im Literaturverzeichnis dieses Buches angegeben sind, liefern vielfältige Einblicke in die Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen.
Weiterführende Fragen zur Selbstreflektion
• In welcher Weise sollte sich künftig die Kinderanalyse familiärer Dynamik widmen und diese in die Behandlung einbeziehen?
• Wird die Kinderanalyse aktuellen gesellschaftlichen Themen wie z. B. den Folgen wachsender Armut gerecht?
• Wie wirkt sich das Generationenverhältnis in der Beziehung zwischen Kinderanalytiker und Patientin aus?
• Worin könnte ein entscheidender Beitrag der Kinderanalyse zum Verständnis von kindlich/jugendlichen Bedürfnissen in der gesellschaftlichen Diskussion bestehen?
• Inwiefern sind in der Kinderanalyse, zum Beispiel bei den Rahmenbedingungen einer psychotherapeutischen Behandlung, die Tendenzen der Entgrenzung spürbar, die sich vielerorts in der Gesellschaft zeigen?
Ich möchte die äußerst interessanten Darstellungen von Salge (2014) und Bonaminio (2016) kurz skizzieren:
Salge moniert in seinem Artikel, dass Psychoanalytiker sich bisher bezüglich der Digitalisierung und Veränderung der Lebenswelten wenig zu Wort gemeldet haben. Seine Überlegung, ob dies in Zusammenhang mit der in letzter Zeit geringen Beachtung der Kulturtheorie der Psychoanalyse stehe, kann ich nachvollziehen (ebd., S. 238). So mahnt er vor allem Psychoanalytiker an, sich diesem Phänomen als Experten für innerseelische Zustände zuzuwenden. Er legt dar, dass das Übertreten ins Erwachsenenalter für die Adoleszenz neue Herausforderungen schafft, eben andere, als die Elterngeneration leisten musste.
»Gerade die Perspektive der Elterngeneration auf die Neuen Medien ist somit immer von der Gefahr des geleugneten Neides geprägt und von der Gefahr begleitet, sich im Dickicht projektiver Hilflosigkeitsdiagnosen zu verfangen.« (ebd., S. 239f)
Er sieht einen erheblichen Einfluss durch die Digitalisierung auf die seelische Entwicklung des Einzelnen und damit auf die Etablierung von bestimmten Krankheitsbildern. Der Autor versucht am Beispiel der Übergangsphase der Spätadoleszenz zum Erwachsenenalter und ihres krisenhaften Verlaufes die Wirkung digitaler Medien als Reparationsleistung und ihrer pathogenen Wirkung zu verdeutlichen. Durch seine klinische Erfahrung der letzten Jahre sieht er eine Veränderung der Störungsbilder, von klassischen Neurosen hin zu Borderline-ähnlichen Störungsbildern (ebd., S. 243). Salge nennt dies ein »pathologisches Lebensarrangement« (ebd., S. 243). Nicht die neuen Medien stellen für ihn das Problem dar, sondern deren Zusammentreffen mit individuellen Entwicklungsdefiziten. Einen Fokus seiner Arbeit richtet er auf die Funktion von Tagträumen, die heute zunehmend mit der virtuellen Welt in Verbindung stehen. Tagträume können als Probehandeln zur Stabilisierung des inneren Gleichgewichtes genutzt werden, um sich den Überforderungen und Ungewissheiten der Realität zunächst zu entziehen. Hier bieten die neuen Medien fatale Kompensationsmöglichkeiten, deren vielfältige Optionen einen besonderen Reiz für die Verleugnung der bedrohlichen Realität darstellen. Das Eintauchen in die virtuelle Welt erlaubt das Probehandeln im exzessiven Maße und führt zum Scheitern in der Auseinandersetzung mit der eigenen Realität.
Die 20-jährige Patientin wird von ihrem Psychiater überwiesen, der sie aufgrund ihrer depressiven Entwicklung behandelt. Im Laufe des mittlerweile dreijährigen Psychotherapieprozesses entzieht sich die Patientin zunehmend dem realen Leben und taucht in ihren Tagträumen, wie auch in den entsprechenden medialen Rollenspielen, in eine Traumwelt ein. Einerseits gibt es ihr die Möglichkeit, ihre Sehnsüchte zu erproben und zu erforschen, andererseits wird die Wirklichkeit zur Bedrohung, der die Patientin in zunehmendem Maße nicht mehr gewachsen ist. Sie scheitert an ihren Entwicklungsaufgaben, taucht immer mehr in ihrer virtuellen Welt ab. Auch in der Therapie ist sie kaum noch zu erreichen, zieht sich zurück und klagt über die Belastungen ihres Alltags. Sie erscheint in eine Welt versunken und von dieser auch besessen, sofern sie von ihren Fantasien, die nun als Rollenspiele im Netz verwirklicht werden, spricht. Die Therapie, ihr letzter Fels in der Brandung, wird überspült, sie bricht sie ab. In der Reflexion stellt sich die Frage, ob ich die Patientin nicht verstehen konnte, da unsere Welten zu gegensätzlich erschaffen waren. Ich spürte ihr völliges Abtauchen, dass ich verhindern wollte, was mir jedoch nicht gelang. Vielleicht hätte ich intensiver mit eintauchen sollen, um die virtuellen Träume meiner Patientin nachzuvollziehen.
Bei näherer Betrachtung, sofern man sich für diesen Kontext interessiert, erscheinen viele Jugendliche im Umgang mit den neuen Medien konturiert und besitzen ein realistisches Einschätzungsvermögen. Dies wird jedoch von vielen Erwachsenen bezweifelt. Die Jugendlichen möchten ihrer Gruppe angehören oder von sich auch etwas präsentieren. Zugehörigkeit und Positionierung waren schon immer Indikatoren für die Gleichaltrigengruppe, die sozialen Medien sind ein alltägliches Kommunikationsmedium dieser Altersgruppe. Im Gegenzug ist jedoch festzuhalten, dass sich subtile Ausgrenzungsmechanismen durch diese Form der Beziehungsprozesse eklatant vervielfältigt haben. Einzelne, die nicht »passen«, werden aus Chat-Gruppen hinausgeschmissen oder öffentlich gebrandmarkt. Dieses Cybermobbing wird an späterer Stelle in diesem Buch aufgegriffen. Das narzisstische Geltungsbedürfnis hat in unserer Gesellschaft eine besondere Bedeutung gewonnen. In den letzten Jahren erlebe ich zunehmend, dass eine regelrechte Angst und auch Selbstentwertungen auftreten, sobald der Jugendliche als durchschnittlich betrachtet werden könnte. In einer Gesellschaft mit Selbstoptimierung wird eine Zuordnung zum Durchschnitt bedrohlich, ein Gefühl von Minderwertigkeit stellt sich ein. Das Ideal zeichnet sich dem gegenüber vor allem in Form einer künstlichen Attraktivität ohne Makel aus, wenn beispielsweise schon Minderjährige sich ästhetisch-chirurgisch behandeln lassen oder Erwachsene ihr Leben vollständig auf eine erfolgreiche Karriereleiter nach oben ausrichten. Wer sich dem nicht zu- oder unterordnet, steht schnell außerhalb der Norm. Meine Patienten berichten im Praxisalltag inzwischen häufig von Freunden, die in entfernten Städten oder gar im Ausland wohnen. Früher spürte ich bei meinen jugendlichen Patienten dagegen nicht selten ein Gefühl von Peinlichkeit, wenn sie mir berichteten, dass sie im Internet jemanden kennengelernt hatten. Heute wird es mehr und mehr zur Gewohnheit, soziale Kontakte über das Internet zu knüpfen, auch allgemein sozial zurückgezogene Jugendliche sind hier aktiv.
Читать дальше