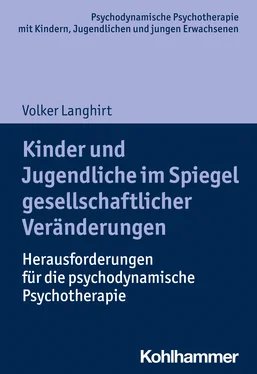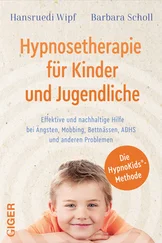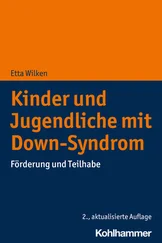Adrian, acht Jahre, wird in der Praxis vorgestellt, da seine Eltern, insbesondere seine Mutter der Meinung sei, er falle durch sehr impulsives Verhalten auf. Adrian und seine Mutter sind ständig im Kampf, Grenzen werden verletzt. So werde er manchmal tätlich gegenüber seiner Mutter, raste regelrecht aus. Adrians Mutter berichtet, dass sie aus einer Familie komme, indem es vor allem an emotionaler Zuwendung fehlte. Sie selbst sei ständig mit ihren Schuldgefühlen beschäftigt, fühle sich oftmals dann als schlechte Mutter. Adrians Vater ist im Hintergrund, hält sich zurück. Im Elterngespräch berichtet er, dass er kaum Möglichkeiten habe, mit seinem Sohn in einen klärenden Dialog zu treten. Seine Frau lasse dies nicht zu, sie befürchte, dass er und sein Sohn die Grenzen überschreiten.
Adrians Impulsivität lässt sich als eine verzweifelte Suche des Kindes nach Begrenzungen interpretieren. In seiner Familie fehlt es an Grenzen, da beide Eltern solche sehr schnell als Zwang oder Bevormundung interpretieren. Beide Eltern berichten, dass sie in ihren Erwartungen als Eltern und ihrer Vorstellung von Familie äußerst vorsichtig, teilweise hilflos seien, da sie mit ihrem Sohn ein »ausgewogenes Verhältnis« haben möchten. Dieser Begriff ist für mich zwiespältig, denn, was heißt in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern »ausgewogen«?
Julian, acht Jahre, wird in der Praxis aufgrund seiner Unruhe von seiner alleinerziehenden Mutter angemeldet. Die Schule macht der Mutter Druck, ihren Sohn unbedingt auf ADHS testen zu lassen. Obwohl die Mutter nicht der Überzeugung ist, dass Julian unter einer solchen »Störung« leide, wird er künftig medikamentös behandelt. Ihr als Mutter falle es schwer, dies zu akzeptieren, massive Schuldgefühle plagten sie. Sie befürchte, die Schule werde ihren Sohn hinauswerfen, wenn er sich nicht anpasse. Sie erlebt sich völlig hilflos, überfordert und seitens der Schule gezwungen.
Hier wird eine Grenzverletzung seitens staatlicher Sozialisationsinstanzen deutlich, die eine Forderung nach Konformität im Sinne des gesellschaftlichen Idealbildes repräsentiert. Dabei handelt es sich um eine äußerst grenzverletzende Situation: Die Schule übt in ihrer Funktion als Erziehungsinstanz und Bildungseinrichtung Druck auf den Einzelnen aus, dieser muss sich um jeden Preis anpassen. Das gesellschaftliche Dilemma zwischen Schule als System der Optimierung und Weichensteller für das weitere Leben und ihrem Versagen als soziale Einrichtung und Begegnungsstätte ist ständig präsent.
Frau K. befindet sich mit ihrem neunjährigen Sohn Florian in psychotherapeutischer Behandlung. Frau K. ist in psychiatrischer Behandlung, da sie an einer Psychose erkrankt ist. Florian passt sich sehr dem mütterlichen Verhalten an, ist zeitweise auch überfordert, im Stich gelassen. Zur Vorgeschichte ist zu erwähnen, dass Florians Vater während der Schwangerschaft seiner Frau verstarb. Florian wird in einer Pflegefamilie untergebracht, da seine Mutter stationär behandelt werden muss. In der Pflegefamilie fühlt er sich nicht wohl, vertraut sich seinem Therapeuten an. Die Besuchskontakte zwischen Florian und seiner Mutter werden seitens des Jugendamtes sanktioniert, abhängig vom Verhalten der Mutter. Die Pflegemutter avanciert zur Kontrollinstanz, muss ständig dem Jugendamt Meldung erstatten. Aufgrund der psychischen Erkrankung von Florians Mutter ergeben sich vielfältige Konfliktebenen. Mithilfe der therapeutischen Behandlung unternimmt die Mutter den Versuch, nach ihrem Klinikaufenthalt das Pflegeverhältnis zu beenden und ihren Sohn mit entsprechender Unterstützung zu sich zu nehmen. Abermals wird ihr gedroht, sollte sie nicht den Vorstellungen und Erwartungen des Mitarbeiters entsprechen, würde Florian ihr wieder entzogen.
Ein Fall, der zutiefst betroffen macht. Er illustriert die Gefahr, dass die Helfersysteme ohne die intensive Reflexion des Geschehens ebenfalls in pathogene Interaktionen verstrickt werden. Dies wäre der Beginn einer psychodynamischen Interpretation, jedoch fokussiere ich hier den Eingriff staatlicher Institutionen in die Freiheit und Autonomie des Einzelnen. Selbstverständlich bedarf Florians Mutter entsprechend einfühlsamer fachlicher Unterstützung, die es tatsächlich bereits vielerorts für psychisch kranke Elternteile gibt. Im vorliegenden Fall ist jedoch in auffälliger Art und Weise eine massive Verletzung der persönlichen Grenzen Florians und seiner Mutter gegeben. Es geht mir hier nicht darum, aus der Distanz pauschal das Handeln des Jugendamtes anzuprangern. Allerdings möchte ich auf bestimmte Phänomene aufmerksam machen, denen sich heute der Einzelne trotz der Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten stellen muss.
Aufgezeigt wurden oben verschiedene alltägliche Fallbeispiele, die allesamt die Verletzung von Grenzen darstellen: Grenzen zur Wahrung der Integrität des Einzelnen. Aber diese Grenze wird zunehmend von einer unscharfen Kontur geprägt. Grenzen zu respektieren oder zu akzeptieren entzieht sich allmählich dem gesellschaftlichen Wertekodex, die individuelle Ausgestaltung persönlicher Räume scheint in Zeiten der Kurzlebigkeit und schneller Lösungsstrategien widerstrebende Impulse auszulösen. Die Psychoanalyse als Therapieform, konkret in der Errichtung innerer Strukturen, ist diesen Strömungen seit längerer Zeit ausgesetzt. Insgesamt mehren sich die Fälle, in denen Grenzen des Individuums überschritten werden. Auch die Wahrnehmung dieser Übergriffe verändert sich, einhergehend mit gesellschaftlichen Veränderungen. Die öffentliche Diskussion bezüglich Übergriffe auf Kinder, psychisch oder physisch, scheint sich in den letzten Jahren vermehrt auf die Veränderung des Strafrechts in Bezug auf die Täter zu erstrecken und kaum die Lebensräume der Kinder und unsere Verantwortung zu hinterfragen. Grundsätzlich wäre es wünschenswert, gesellschaftlich intensiver über das Recht der Kinder, ihre Unversehrtheit und damit auch über ihre gleichberechtigte Stellung in der Gesellschaft nachzudenken. Kindheit ist heute ein Stadium, das sehr schnell unsere frühere Vorstellung der kindlichen Entwicklung verändert. Begrenzte Räume, frühzeitige Anforderungen, schwierige Entwicklungen in der Elementarpädagogik und früher Einstieg in das Schulsystem spiegeln aktuell gesellschaftliche Wandlungsprozesse wider, denen Kinder sich stellen müssen. Eltern sind verunsichert, klare Begrenzungen, die früher als Halt für die weiteren Entwicklungen dienten, gibt es nicht mehr.
Eine andere Sicht hierzu nimmt Schröder (2006) ein. Schröder beschreibt in seinen Artikeln die veränderten Bedingungen heutiger Adoleszenz. Die Vorgaben der Gesellschaft für Jugendliche waren in früheren Zeiten sehr klar und gaben wenig Spielraum. Heute ist der Übergang dagegen individualisiert, die Rituale haben sich verändert. Schröder betrachtet dies nicht als aktuelles Problem, sondern weist darauf hin, dass diese Phänomene schon in den 1960er Jahren beschrieben wurden (ebd., S. 75). Die emotionalen Befindlichkeiten in der Adoleszenz können heute offener ausgelebt werden. Auch er beschreibt die Adoleszenz als eine Lebensphase, deren Beginn mit der frühen Adoleszenz im neunten Lebensjahr und mit der späten Adoleszenz bis zum 30. Lebensjahr endet (ebd., S. 75). Er erkennt eine hohe Ambivalenz der geschlechterspezifischen Trennung, einerseits das Streben um Gleichberechtigung, andererseits die starke Akzentuierung weiblicher und männlicher Attribute. Zunehmend verschwinden klassische Themengebiete, die die Jugendphase von der Erwachsenenwelt trennen, beide verschmelzen miteinander im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen.
Die Familie ist vielfältigen Veränderungen unterworfen, Kinder und Erziehung sind massiven Anpassungsprozessen ausgesetzt. Die Thematik der »fehlenden Väter« besteht trotz Liberalisierungsprozessen der letzten Jahre nach wie vor. Armut wird zunehmend ein tabuisiertes Thema, dass sich im psychotherapeutischen Prozess mit Kindern und Jugendlichen widerspiegelt. Eltern sind in ihrer Rolle verunsichert, dem notwendigen Prozess des familiären Wachstums wird kaum noch Zeit und Raum gegeben. Das Generationenverhältnis ist ebenfalls Veränderungsprozessen unterworfen. Die Erfahrung der älteren Generation wird mit dem Wissensvorsprung der jüngeren Generation bezüglich der Digitalisierung konfrontiert, das zu einem veränderten Diskurs zwischen den Generationen führt. Auf den kinderanalytischen Alltag überträgt sich diese Dynamik und setzt eine intensive Reflexion des Kinderanalytikers auf die sich verändernden Rahmenbedingungen in Gang. Grenzen werden in unserer Gesellschaft zunehmend diffuser, Kinder und Jugendliche können sich kaum noch an Vorgaben orientieren. Auch im familiären Kontext zeichnet sich dieses Phänomen ab. Leitideale der Gesellschaft wie zum Beispiel demokratische Aushandlungsprozesse zwischen Eltern und Kinder drängen in die familiäre Interaktion. Zunehmend begründen Grenzverletzungen in vielfältiger Ausformung die Anmeldungen in psychotherapeutischen Praxen. Auch die Entwicklungsphasen, wie beispielsweise die der Adoleszenz, sind nicht mehr klar voneinander abgegrenzt. In Zeiten der Entgrenzung ergeben sich jedoch auch vielfältige und neue Spiel- und Erprobungsräume für Kinder und Jugendliche.
Читать дальше