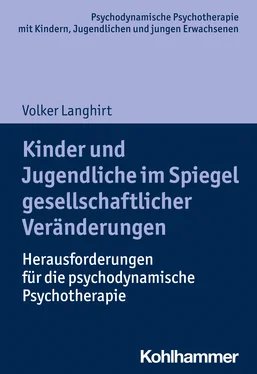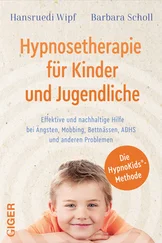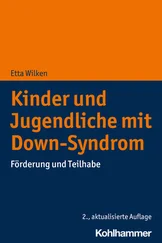Volker Langhirt - Kinder und Jugendliche im Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen
Здесь есть возможность читать онлайн «Volker Langhirt - Kinder und Jugendliche im Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kinder und Jugendliche im Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kinder und Jugendliche im Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kinder und Jugendliche im Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kinder und Jugendliche im Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kinder und Jugendliche im Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ich möchte dieses Beispiel anführen, um zu zeigen, wie unterschiedlich psychische Krankheit bewertet wird. In der Familie wird Christa als unmotiviert wahrgenommen, die es nicht gelernt hat, den Regeln oder Pflichten des Lebens nachzukommen. Auch in der Fachwelt gibt es, wie Christas Beispiel zeigt, keine eindeutige Diagnostik, sie ist scheinbar abhängig von Profession, Kenntnisstand und persönlicher Bewertung. Die Frage der Auffälligkeit oder der Normalität nimmt auch in der Fachwelt ideologisch gefärbte Beschreibungen an, das Beispiel des ADHS-Störungsbildes bestätigt dies. In einer Zeit der Individualisierung erscheint im Gegenzug die Individualität des Kindes mehr als ein Phänomen der Grenzenlosigkeit, der übersteigerten Emotionalität und der Gefahr, den Erwartungen der Gesellschaft nicht mehr entsprechen zu können. Anscheinend ist heute mehr denn je die Befürchtung der Ausgrenzung und des Versagens vorherrschend. Keupp (2007) verdeutlicht den Zusammenhang zwischen dem Ideal der Autonomie und dem Zwang der Konformität. Göppel (1989) stellt in seinem Buch die kindlichen Auffälligkeiten vor dem Hintergrund der Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts dar. Ausgehend von den Geschichten des Struwwelpeters versucht er eine Linie des auffälligen Kindes durch die Geschichte der letzten Jahrhunderte zu zeichnen.
»Jederzeit und jede Gesellschaft bringt ihre eigenen Widersprüche und Belastungen hervor, die das gedeihliche Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen gefährden. Jede neue Generation entwickelt ihre eigenen Probleme, Widerstände und Störungen in Auseinandersetzung mit den kulturellen Gegebenheiten und Forderungen, die sie vorfindet.« (ebd., S. 8)
Maria, 18 Jahre, bestach durch ihre ausgezeichneten Leistungen in der Schule. Je näher das Abitur rückte, umso mehr löste sie ihre bisherigen Beziehungen auf. Ihr Wunsch war ein Studium, dessen Zugangsvoraussetzungen vom Notendurchschnitt des Abiturs das schwierigste Studienfach darstellte. Erfolg und Attraktivität durch ihre besonderen Leistungen waren die Maxime ihres Lebens. Zusehends erlebte sie ihre Umwelt als Hemmschuh ihrer persönlichen Entwicklung, Freundschaften wurden aufgekündigt, um des eigenen Zieles willen. Maria hatte einen Abiturdurchschnitt von 1,0, Begeisterung und Idealismus fehlte in ihrer Reaktion. Ihre Beziehungen prägten sich jedoch zunehmend, gewissermaßen oberflächlich. Sie spürte für Momente ein Gefühl der Einsamkeit, stets durch ein maskenhaftes Auftreten kaschiert. Sie befand sich in einem massiven Konflikt. Maria brach ihre Psychotherapie ab, da sie auch ihren therapeutischen Prozess als Hindernis ihrer Leitidee, um jeden Preis souverän und erfolgreich zu sein, erlebte. Sehnsüchte nach Geborgenheit und Halt, die Suche nach der eigenen Identität und ihres Kontinuums in der Lebensgeschichte wurden von ihr abgewehrt.
Marias Fall zeigt eine Schattenseite unserer heutigen Zeit. Beziehungen, in denen gemeinsame Lebenswege reflektiert werden können und sich der Einzelne der geschützten Betrachtung von außen unterziehen kann, treten in den Hintergrund. Wir würden diesen Fall heute den narzisstischen Störungsbildern zuordnen.
Das soziale Umfeld in seiner Bewertung von Krankheit und in der Beteiligung krankheitsverursachender Faktoren stellt ein sehr komplexes Thema dar, das den Rahmen hier sprengen würde. Ich möchte dies zur Vereinfachung am Beispiel ADHS skizzieren. Die Diskussion um dieses Störungsbild spaltet die Öffentlichkeit grundsätzlich in Gruppen, die jeweils die Wahrheit für sich reklamieren. Besonders interessant erscheint die Bewertung und Interpretation dieses Störungsbildes über die Jahrzehnte hinweg, dessen sich Göppel (1989) angenommen hat. Kritisch an diesem Krankheitsmodell ist die mittlerweile inflationäre Einbettung von Auffälligkeiten in die ADHS-Diagnostik zu sehen, die es mit sich bringt, kindlich/jugendliches Verhalten zunehmend als abweichend und störend zu bestimmen. Lebensgeschichtliche Faktoren finden in der Regel keinen Eingang in die Diagnostik, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wie z. B. die Reduktion des Kindes in der Schule ausschließlich auf seine Leistung oder die Veränderung traditioneller Familienformen (z. B. der fehlende Dritte), sind bei der Diagnosestellung im herkömmlichen Sinn nicht relevant.
Zusammenfassung
Der kulturelle Kontext prägt unsere Zuschreibungen von Normalität und Krankheit, die entsprechend den jeweiligen gesellschaftlichen Realitäten variieren. Kindliches Verhalten tritt zunehmend als Störungsmodell in den Fokus. In den letzten Jahren gewinnt diese Thematik insbesondere in der Diagnostik, Behandlung und Medikalisierung der ADHS an Gewicht. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die bei der Entstehung entsprechend »neuer Störungsbilder« beteiligt sind, sind dagegen nicht im öffentlichen Diskurs zu finden.
Literatur zur vertiefenden Lektüre
Finzen, Asmus (2018): Normalität. Die ungezähmte Kategorie in Psychiatrie und Gesellschaft. Köln: Psychiatrie Verlag.
Göppel, Rolf (1989): »Der Friederich, der Friederich …«. Das Bild des »schwierigen Kindes« in der Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts. Würzburg: Edition Bentheim.
Weiterführende Fragen zur Selbstreflektion
• Stehen bestimmte Krankheitsmodelle im Zusammenhang mit dem erhöhten Anpassungsdruck gesellschaftlicher Leitideen?
• Welche Position kann in diesem gesellschaftlichen Diskurs die Kinderanalyse einnehmen?
1.2 Veränderte Lebenswelten für Kinder und Jugendliche
Kindliche und jugendliche Lebenswelten scheinen in unserer Zeit schwierigen Anpassungsprozessen unterworfen zu sein.
Ein Beispiel: Der Tageszeitung »Kölner Stadtanzeiger« vom 14.03.2017 ist zu entnehmen, dass ein italienischer Restaurantbesitzer Familien mit braven Kindern einen finanziellen Bonus beim Besuch seines Restaurants einräumt. Eine Anpassungsbereitschaft unserer Kinder und Jugendlichen wird allgemein gefordert. Der kritische Dialog im Generationsverhältnis findet nicht mehr statt, jugendliche Proteste, wie wir sie aus früheren Zeiten kennen, sind verklungen. Der fehlende Dialog zwischen den Generationen zeigt sich in unzähligen Beispielen unserer Zeit. Während ich dieses Buch schreibe, ist in der öffentlichen Diskussion die Friday for future - Bewegung Ansatzpunkt von Kritik. Kinder/Jugendliche reagieren öffentlich mit ihrem Protest auf die Hinterlassenschaft der älteren Generation und fordern ein Umdenken, im Sinne einer besseren Zukunft. Sofort präsentieren sich Politiker, Lehrerverbände und andere, um darauf hinzuweisen, dass die jugendlichen Demonstranten ihren Platz in der Schule und nicht auf Kundgebungen einnehmen sollten. Die Zunahme psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sollte in diesem Zusammenhang deutlicher in den Blick des Interesses kommen. Ich möchte mich in den folgenden Kapiteln den Veränderungen der Sozialisationsinstanzen von Kindern und Jugendlichen widmen.
Die Diskrepanz zwischen den Generationen wächst: Flexibilisierung und Digitalisierung fördern die unterschiedlichen Erfahrungsbereiche. Diese münden kaum in einen Dialog zwischen den Generationen, insbesondere die »Unbeholfenheit« der älteren Generation im Umgang mit den digitalen Medien erschwert das Generationenverhältnis. Jugendlicher Protest, schon immer Ausdruck und Ansatz veränderter Rahmenbedingungen, entzieht sich zunehmend der Auseinandersetzung zwischen den Generationen.
1.3 Familie
Familiäre Lebenswelten sind heute vielfältigen gesellschaftlichen Delegationen unterworfen. Zusätzliche Belastungen wie der Arbeitsmarkt, Schule und auch Freizeitgestaltung verändern das Familienklima. Der Wunsch nach einem Kind tritt heute in Konkurrenz mit der beruflichen Karriere beider Eltern oder auch in Abhängigkeit der familiären ökonomischen Verhältnisse. Kinder stellen zunehmend einen Risikofaktor ökonomischer Überlegungen dar. Die Einelternfamilie ist, zumindest im erlebten Alltag, nahezu Standard geworden, in geringerem Maße erleben Kinder heute noch ein gemeinsames Elternpaar. Berufstätigkeit, sowohl bei Vater wie auch Mutter, mütterlicher Spagat zwischen Kindererziehung und beruflicher Eigenständigkeit, fehlende väterliche Funktionen, Flexibilität und damit weite Arbeitswege, extrafamiliäre Betreuung der Kinder, veränderte Freizeitgestaltung und vieles mehr müssen in den familiären Alltag integriert werden. Eine schwierige, teilweise unlösbare Aufgabe. Der »fehlende Vater« ist nach wie vor eine Realität, die Kinder in den kinderanalytischen Praxen beschreiben. Zepf und Seel (2017) beschreiben einen hohen Zeitaufwand von Vätern außerhalb der Familie und einen verschwindend geringen in gemeinsamen Aktivitäten mit ihren Kindern. Dies wird im Kontext der 1980er Jahre aufgezeigt – hat sich die Situation zwischenzeitlich wesentlich verändert? Zusätzlich gestalten sich die heutigen Familienformen sehr vielfältig. Patchwork-Familien, Einelternfamilien, gleichgeschlechtliche Elternteile, Pflegefamilien, Familien mit Migrationshintergrund, um nur einige zu nennen. Familien sind durch die heutigen gesellschaftlichen Ideale einerseits massiven Zwängen unterworfen, müssen sich andererseits jedoch nach außen als selbstbestimmt, verantwortungsvoll und souverän beweisen. Scheitert die Familie oder der Einzelne an gesellschaftlichen Erwartungen und Vorgaben, treten Stigmatisierungsprozesse in Gang. Unsicherheiten im familiären Beziehungsgefüge folgen, Eltern empfinden sich hilflos und inkompetent. Brisch (vgl. Holzapfel, 2013) berichtet von seinen langjährigen Erfahrungen in der Babysprechstunde, in der Eltern ihre Sorge äußerten, ihr Kind zu verwöhnen. Der Spielraum für Erfahrungen, Experimentieren und elterliche Intuition scheint abhandengekommen zu sein. Hohl (1989, S. 118) sieht Verunsicherungen beim Erziehungsverhalten der Eltern in Zusammenhang mit grundsätzlichen Veränderungen psychischer Strukturen. Eine sich durch die Generationen vermittelte und durch Erfahrung speisende Elternfunktion ist unter heutigen Bedingungen schwer zu etablieren, Elternschaft strebt entsprechend gesellschaftlichen Vorgaben einem Idealbild entgegen. Hohl (ebd., S. 119) veranschaulicht Veränderungen in den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Das Individuum ist wesentlich auf sich bezogen, narzisstisch getönt, frühere Werte und Normen sind längst nicht mehr die Vorgaben, an denen sich Eltern orientieren. Triebkontrolle und Selbstdisziplinierung sind nicht mehr Standard, ein partnerschaftliches Verhältnis zum Kind ist der Trend der Zeit und führt maßgeblich zu einer Irritation in den Interaktionen. Eltern befürchten, falsche Entscheidungen zu treffen. Aushandlungsprozesse innerhalb der Familie münden ins Absurde und überlassen die Entscheidung dem Kind.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kinder und Jugendliche im Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kinder und Jugendliche im Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kinder und Jugendliche im Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.