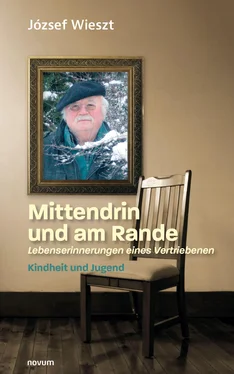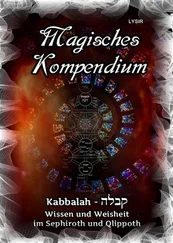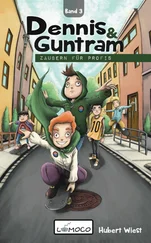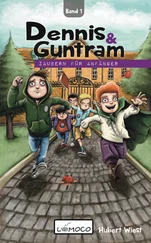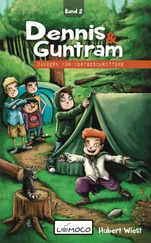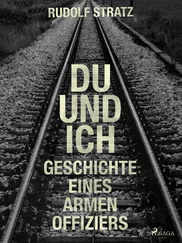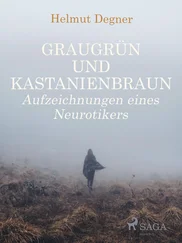Einer der Einwanderer war Georg Wiest. Er ist der Urahn aller in der Umgebung von Budapest lebenden Mitglieder der Wiest-Sippe Sie haben sich durch Binnenwanderung (Heirat, Arbeitssuche etc.) in den deutschen Dörfern des Ofener Berglandes angesiedelt. Die folgende Mitteilung dazu hat mir Frau Milbich-Müntzer zugesandt:
Unser Urahn Georg Wiest
Wiest (WÜST), Georg
Im März 1691 aus dem Hohenzollerschen Land entlassen (Morlock). „Wiest, Georg, Weilheim, Frau Kdr, 106 fl (Florentiner Gulden)33 x, (Kreuzer)) ‚außer Landes‘ (Gleichzeitig mehrere Entlassungen nach Ungarn). 24.3.1691“ (Hacker Auswanderungen aus Hohenzollern, 2158)
Als die Einwanderer nahe der Gemeinde Alt Ofen (Óbuda) ihre Zille verließen und erstmals ungarischen Boden betraten, wurden sie von Fuhrwerken ihrer künftigen Grundherren abgeholt und in ihre vorgesehenen Wohnorte gebracht. Von diesen waren kaum mehr als ihre alten Namen bekannt, gegebenenfalls waren noch ein paar Mauerreste vorhanden. Während der Türkenherrschaft (einhundertfünfzig Jahre) wurden sie entvölkert, verödeten und zerfielen. In den Heimatbüchern wird davon berichtet. Unsere Vorfahren wurden auf verwildertem Grund abgeladen. Die versprochenen Baumaterialien trafen nicht oder nur sehr zögerlich ein, Zugvieh und landwirtschaftliches Gerät ebenfalls. Die versteppten und versumpften Flächen mussten mühsam von Hand mit Hacke und Spaten wieder als Felder hergerichtet werden. Zugtiere und Pflüge waren noch nicht vorhanden. Unser Kopp-Opa wusste aus der familiären mündlichen Überlieferung von Perbál zu berichten, dass unsere Vorfahren im Sommer das Schilf in den versumpften Gebieten abmähten und verbrannten. Die heiße Sommersonne verdampfte das Wasser. Auf diese Weise wurden die Sümpfe entwässert. In den trockenen Gebieten rodeten sie, soweit vorhanden, Bäume und beseitigten dichtes Buschwerk. Das Holz der Bäume schlugen sie zu Balken und nutzten sie zum Bau einfacher „Häuser“ und Schuppen, um sich vor den Unbilden der Witterung (heiße Sommer, kalte, schneereiche Winter) und vor den wilden Tieren (Wölfe, Bären) zu schützen. An eine Ernte war unter diesen Umständen zunächst nicht zu denken. Selbst wenn sie von dem Grundherrn einige Lebensmittel (Getreide, Brot, Kartoffeln) erhielten, was nicht sicher war, litten sie, vor allem im Winter, an Hunger und Kälte. Viele erkrankten und starben – im Sommer am Sumpffieber, im Winter an Erkältungskrankheiten und Entkräftung. Die Kindersterblichkeit war unter diesen Bedingungen besonders hoch.
Georg Wieszt wurde also mit seiner Familie nach Werischwar gebracht. Er überlebte die schwere Zeit des Anfangs und findet sich in einer „Conscription“2 der Bevölkerung in Werischwar im Jahre 1696“ wieder: Georg Wüst mit zwei Söhnen und zwei Töchtern und – vermutlich ein erwachsener Sohn von ihm – ein Conrath Wüst mit zwei Söhnen. Wüst ist eine ursprüngliche Schreibweise von Wiest. Der Name stammt nach früheren Quellen aus dem Bodenseegebiet. Die ursprüngliche Bedeutung weist auf Tätigkeit der Menschen dieses Namens hin. Sie kultivierten unbebautes, wüstes Land. Damit waren sie in Ungarn sozusagen wieder an ihren Wurzeln angelangt.
Werischwar (Vörösvár)
Fogarasy-Fetter schreibt im „Werischwarer Heimatbuch“, dass im März 1691 vier Familien aus dem „Hohenzollerschen Land“ nach Werischwar kamen. „Mit ihnen kam aus Weilheim bei Hechingen Georg Wiest mit Frau und Kindern (namentlich bekannt Michael, Konrad, Franz), von dem die im Ofener Bergland weit verzweigte Familie Wiest ihren Ursprung nahm. Als seine Frau starb, heiratete er 1697 Barbara Wingert aus Finningen in Schwaben. Georg Wiest starb 1727 mit 60 Jahren in Werischwar.“ Nach Werischwarer Heiratsmatrikeln von 1697 war Georg Wiest von Beruf Wagner. Er gehörte damit einer Minderheit unter den Einwanderern an, die überwiegend Bauern und Winzer waren Der Name Wiest ist bis heute in Werischwar/Pilisvörösvar relativ häufig vertreten. Da viele Werischwarer nach dem Zweiten Weltkrieg im Bergbau arbeiteten, wurde der Ort von den Vertreibungen überwiegend verschont. Ähnliches widerfuhr auch weiteren Dörfern, die den neuen Machthabern aus anderen Gründen unentbehrlich schienen. Amüsantes aus der Geschichte der Wiests in Werischwar findet sich im Kapitel „Necknamen Spitznamen“: „Ein Zweig der Familie Wiest wurde wegen des Bauchumfangs der männlichen Familienmitglieder mit dem Necknamen die ‚Waumbadn‘ (Wamme: oberdeutsch ‚Bauch‘, wammig, ‚bauchig‘) von den dünnen Wiests unterschieden.“3
Die in Zsambék residierenden Grafen von Zichy (gesprochen Sitschi) waren zu dieser Zeit die Grundherren. Sie förderten die Einwanderung aus Deutschland. Ihr schönes Schloss in Zsambék existiert heute noch.
Perbál
Mein Geburtsort Perbál liegt nur wenige Kilometer westlich davon. Im Heimatbuch der Gemeinde Perbál, meinem Geburtsort, wenige Kilometer von Pilisvörösvár entfernt, findet sich eine Kopie der Visitationsakte von 1747. Sie gibt den Stand von 1745 wieder. Auf der Liste befinden sich ein Andreas Wiest (Frau Rosalia, Kind Katharina, Knecht Martin Stomher) und ein Mathias Wiest (Frau Barbara, Kinder Mathias, Michael, Martin, Leopold, Gregor, Georg, Elisabeth). In den Urbariallisten4 der Gemeinde Perbál von 1770 stehen ein Andreas Vieszt, und ein Mathias Vieszt.5 Das V wird im Ungarischen wie W gesprochen. Beide Männer dürften mit denen, die 25 Jahre zuvor eingetragen wurden, identisch sein oder waren deren Söhne.
Erstmals tauchen in den Listen von 1770 auch ein Gregorius Khop und ein Laurentius Khop auf. Damit ist zu dieser Zeit auch schon der Name Kopp in Perbál vertreten. Von der Kopp-Linie stammt unsere Mutter ab. Diese Kopps könnten unsere Vorfahren von der Mutterseite sein.
Ein Franciscus Köpp, und dann als Franz Kopp, taucht aber schon bei der Landeskonskription von 1720 in Jenö (Budajenö) dem Nachbardorf von Perbál auf. Der Name Kopp ist demnach bereits 50 Jahre früher in der Perbáler Gegend vertreten. Die Perbáler Khops von 1770 könnten durchaus auch Nachfahren des Jenöer Franz Kopp sein. Ein Christian Kopp steht auch in der Urbariallisten von 1770 im Nachbarort, der Gemeinde Jenö. Für diese Annahme spricht, dass zwischen den Dörfern Heiraten stattfanden, und, wie erwähnt, auf diese Weise eine Binnenwanderung stattfand.6
In dieser Liste findet sich ebenfalls ein Jakob Wüest. (Die Schreibweise Wüst, Wüest und Wiest, taucht anfangs parallel auf, später Wiest und Wieszt sowie Viszt und Vieszt. Das „Z“ kam erst durch die ungarische Schreibweise in unseren Namen.
Für mich ist damit erwiesen, dass die Familien unserer Vorfahren (Vater Wiest) seit 1691 in Pilisvörösvár bzw. (Mutter Kopp) seit Beginn des 18. Jahrhunderts in Perbál oder seiner unmittelbaren Nachbarschaft lebten. Sie gehörten mit einzelnen Ausnahmen nicht zu den reichen Bauern. Objektiv betrachtet, sind sie nicht dauerhaft in diese Schicht aufgestiegen. Sie blieben entweder stets kleine Bauern und Händler oder verloren durch widrige Umstände oder Fehlentscheidungen ihr Vermögen wieder. Es war aber nicht so, dass unsere Eltern mit ihrem Schicksal haderten und sich als arme Leute ansahen. Sie waren stolz auf das, was sie sich erarbeitetet haben. Strebsame Leute waren sie, die ihre Selbstachtung nicht zuletzt von ihrem durch fleißige Arbeit erworbenen Besitz herleiteten. Jedoch hätte unsere Mutter gern mehr davon gehabt. Ständig haderte sie mit unserem Vater, weil er nicht mehr verdiente. Aus der familiären Überlieferung wusste unser Vater Folgendes zu berichten:
Familiäre Überlieferung
Unser Vater berichtete: „Von den ersten Einwanderern ist in Perbál/Zsambék nur einer übrig geblieben. Er heiratete eine Ungarin aus Zsambék. Neue Kolonisten kamen in diese Orte. Auch von ihnen starben viele. Erst von der dritten Einwanderungswelle überlebten die meisten.“ Folgender Spruch ist in den ungarndeutschen Familien heute noch bekannt. „Den Ersten der Tod. Den Zweiten die Not. Den Dritten das Brot.“ Es dauerte Generationen, bevor aus diesen ersten behelfsmäßigen Ansiedlungen die schmucken „Schwabendörfer“ in einem Ring um Budapest herum entstanden.
Читать дальше