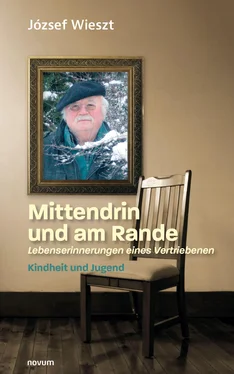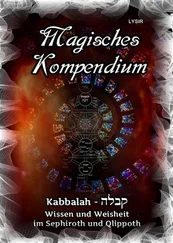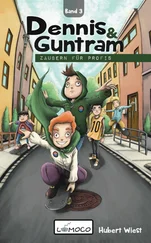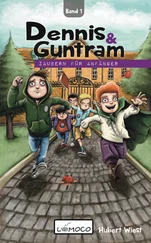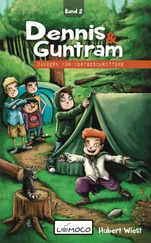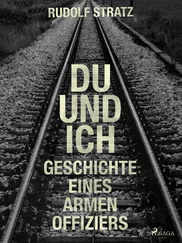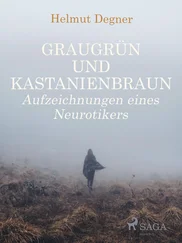József Wieszt - Mittendrin und am Rande – Lebenserinnerungen eines Vertriebenen
Здесь есть возможность читать онлайн «József Wieszt - Mittendrin und am Rande – Lebenserinnerungen eines Vertriebenen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mittendrin und am Rande – Lebenserinnerungen eines Vertriebenen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mittendrin und am Rande – Lebenserinnerungen eines Vertriebenen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mittendrin und am Rande – Lebenserinnerungen eines Vertriebenen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mittendrin und am Rande – Lebenserinnerungen eines Vertriebenen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mittendrin und am Rande – Lebenserinnerungen eines Vertriebenen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ein turbulenter Rundflug 582
Studienreise nach Marseille 585
Leo Lagrange 585
Chateau d’If 586
Bouillabaisse 586
Ein Bischof stört 588
„Das Herbertsche“ 589
Showdown der Revolte 591
Lederjacken 591
„Einige Tote, und der Spuk hat ein Ende“ 592
RAF, „Rote-Armee-Fraktion“ 593
KPD/ML 594
Mao Tse-tung 595
Dissertation und Abschied 597
Übergang 600
Schulung oder Teamarbeit 600
Ein Seminar in Schotten 602
Studenten und Arbeitsdirektoren 603
Wieder auf dem Dorf 605
Jugend- und Erwachsenenbildung 605
Hier soll ich wohnen? 606
Slowenien 1976 608
Wieder zu den Schneebergen meiner Kindheit 608
Aber welch ein Unterschied zu damals 609
Krainburg, Kranj 610
Ein Kollege erzählt von Faschismus und Krieg 610
Exkursionen 611
Bled 612
Nach der Reise 613
Seminare: Themen, Ziele und Methoden 614
Internationale Jugendbegegnungen 616
Danksagung 617
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-025-9
ISBN e-book: 978-3-99131-026-6
Lektorat: Mag. Elisabeth Pfurtscheller
Umschlagfoto: Mark Aplet, Svetlana Larina | Dreamstime.com;
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: József Wieszt
www.novumverlag.com
Statt eines Vorworts: Erinnern
Erinnerung kommt ungerufen, bleibt aus trotz großer Mühe, sie herbeizuzaubern. Sie ist mir nicht dienstbar, handhabbar, wenn ich sie dringend brauche. Bei Namen überwiegend lässt sie mich im Stich. „Wie hieß denn der noch, du weißt schon, der mit …?“ Aber meistens tut sich nichts. Wie eine Ahnung, schwaches, dämmriges Wehen ist der Name in mir, entflammt aber viel zu selten zu seiner vollen Gestalt. Später, wie zum Trotz, in unpassenden Zusammenhängen ist er dann da, drängt sich zwischen anderes, zu ihm nicht Gehöriges, stört mitunter, lenkt ab.
Erinnerung drängt sich mir nicht auf, eher schon ihre dunkle Schwester, das Vergessen: der Mangel an Einzelheiten, Gefühle, Empfindungen, Kleinigkeiten, Zeichen, Gesten, Blicke, Verstecktes. Wie soll da leicht ein Bild entstehen, eine Situation, ein Gemälde, Wortbild, Wortsituation, Wortgemälde?
Wann wurde mir abgewöhnt, auf das Kleine zu achten, wann fing ich an, es zu verachten, verachte ich es? War es, weil ich so lange im Kleinen war? Was ist das Leiden der Kreatur vom Standpunkt der Weltgeschichte aus gesehen, war es das? Solch einen Unsinn habe ich einmal gedacht. Z. B. erhob ich das Proletariat zu historischer Größe und liebte nicht die Proletarier. Und doch war ich zu Hause im Milieu der kleinen Leute, wenn ich überhaupt gelegentlich irgendwo zu Hause war. In mir war immer meine Sehnsucht, dazuzugehören, nicht am Rande zu stehen. Und dennoch war gerade der Rand, das Zusehen von außen, mein gewöhnlicher Ort. Meine Tätigkeit, mein Handeln nahmen vom dort ihren Ausgang. Am Rand war ich zwar und dennoch mittendrin.
Die Ahnen
Seit dem Sieg der Osmanen über das Heer Ludwig II. bei Mohács 1526 war Ungarn dreigeteilt und Mittelungarn von den Türken besetzt. Die Burg von Ofen (Buda) war das Verwaltungszentrum des türkischen Teils. Dieser Teil war weitgehend menschenleer, die Dörfer zerstört und verlassen, das Land verwüstet und verödet. So blieb es bis zur Rückeroberung Ofens durch ein christliches Koalitionsheer im September 1686 und der gänzlichen Vertreibung der Türken aus Mittelungarn in der zweiten Schlacht bei Mohács 1687.
Ein Resultat dieses Sieges war, dass der Habsburger Kaiser Leopold I. und seine Nachfolger als erbliche Könige von Ungarn durch die ungarische Aristokratie anerkannt wurden. Die kaisertreuen Magnaten erhielten ihre früheren Besitzungen vom Kaiser zurück, oder sie wurden mit anderen Gütern belehnt. Sehr schnell erkannten diese Herren, dass ihnen die seit vielen Jahrzehnten nicht bearbeiten, verödeten und versteppten Güter nur Vorteile brachten, wenn der Boden rekultiviert wurde. Sie brauchten Menschen, die das konnten: Bauern und Handwerker. In Ungarn gab es davon bei Weitem nicht genügend. Es mussten also Siedler, Kolonisten aus dem Ausland geholt werden, die diese große und schwere Aufgabe übernehmen würden. In der Umgebung von Buda hatten die Grafen von Zichy ausgedehnte Güter mit kaum besiedelten oder ganz verlassenen Dörfern. Sie begannen unverzüglich, Siedler aus den deutschen Ländern, aus dem Elsass und aus Lothringen ins Land zu rufen. Das geschah zunächst aufgrund privater Initiative. Später erst wurde eine regelrechte Einwanderungspolitik vonseiten der staatlichen Verwaltung des Kaiserreichs betrieben.
Auswanderung nach Ungarn
1691 bereits erreichte der von den gräflichen Emissären verbreitete Ruf die Gemeinde Hechenheim in Württemberg, unterhalb der Burg Hohenzollern gelegen. Der dort ansässige Georg Wiest entschloss sich, nach Ungarn auszuwandern. Er stellte zunächst einen Antrag auf einen Freibrief, d. h. auf Freilassung aus der Leibeigenschaft. Dafür musste er eine erkleckliche Summe auf den Tisch des Grundherrn legen. Er erhielt die Genehmigung zur Ausreise. Danach verkaufte er seinen restlichen Besitz und machte sich mit seiner Frau, vier Söhnen und drei Töchtern auf den langen und gefährlichen Weg nach Ungarn. Verwandte und Bekannte begleiteten ihn bis zum Dorfrand, Tränen flossen, Segenswünsche wurden erteilt, Warnungen und gute Ratschläge folgten, der eine oder andere steckte ihnen noch ein Heilkraut oder eine Tinktur zu. Dann sprach man mit dem Pfarrer noch ein gemeinsames Gebet, erhielt den Reisesegen, und dann entfernte sich die kleine Gruppe zusammen mit zwei anderen Familien in Richtung Ulm. Was würde sie ihnen bringen, die Reise ins Ungewisse?
Versprochen hatte ihnen der Werber glänzende Aussichten, verglichen mit den damaligen Lebensbedingungen in Hechenheim. Zuteilung von ausreichend Ackerboden, sechs Jahre Abgabenfreiheit, Bereitstellung von Vieh, landwirtschaftlichem Gerät und Material zum Hausbau. Er hatte auch ein Papier vorgewiesen, in dem das alles schriftlich festgehalten war, aber welcher Bauer konnte damals schon lesen? Auf dem Weg nach Ulm hatten sich ihnen noch weitere Auswanderer angeschlossen. In Ulm angekommen, mussten sie ihre Papiere überprüfen lassen und die Hälfte der Reisekosten an die Schiffseigner bezahlen. Eine Unterkunft galt es zu finden und dort so lange zu warten, bis ein Schiff abfuhr, auf dem sie mitfahren konnten, donauabwärts, zunächst bis Wien. Ulm war damals eine reiche Handelsstadt und stand in geschäftlichen Verbindungen mit einer Reihe anderer Städte. Eine der bekanntesten von ihnen war das durch größte Anstrengungen vor der Eroberung durch die Türken gerettete Wien. Die Schiffe der Ulmer, Zillen genannt, fuhren mit ihrer Fracht flussabwärts. Es waren flache Kähne, die entweder am Zielort verkauft wurden, um das Holz zu verwerten, oder sie wurden mit neuer Fracht beladen und flussaufwärts von Pferden gezogen. Man nannte das „treideln“.
Ulmer Schachteln
Für die Auswanderer wurden diese Zillen mit kastenähnlichen Aufbauten versehen, die den Menschen und ihren wenigen Gepäckstücken Schutz gegen Wetterunbilden boten. Wegen dieser Aufbauten wurden die Auswandererschiffe auch „Ulmer Schachteln“ genannt. Sie wurden von der Flut der Donau angetrieben und durch zwei sehr lange Ruder gesteuert, die auf dem Dach der „Schachtel“ postiert waren. Dabei galt es, Strömungen und Stromschnellen zu meistern und Untiefen zu vermeiden. Die Abfahrt von Ulm war ein öffentliches Ereignis. Viele Schaulustige versammelten sich, aber auch nachgereiste Verwandte und Bekannte kamen zu einem letzten Lebewohl. Eine Musikkapelle spielte auf und die Auswanderer gingen in Gruppen an Bord, etwa 30 bis 40 Personen pro Zille. Selbstverständlich wollten die Familien zusammenbleiben und auch Mitreisende, mit denen man während der Wartezeit Freundschaft geschlossen hatte, sowie bekannte Ausreisewillige aus Nachbardörfern, die man in Ulm getroffen hatte, sie alle versuchten, jeweils auf einem Schiff unterzukommen. Denn: In Gemeinschaft reist es sich leichter und in der Not kann man sich gegenseitig helfen. Das Wichtigste aber war, dass man in der neuen Heimat mit Bekannten zusammen ankommen und dort neu beginnen wollte. Als nach vielen Zurufen, Gedrängel und Geschiebe die verschiedenen Interessen befriedigt worden waren, oft auch durch ein Machtwort der Schiffsmannschaft, konnte die Reise beginnen. Die Fahrt bis Wien dauerte je nach Jahreszeit und Wetterlage ein bis zwei Wochen. In Wien kamen Kontrolleure der Kameralverwaltung, die die Auswanderung überwachten, an Bord der Schiffe und kontrollierten, ob nicht verbotener Weise verstecktes Geld oder sonstige Wertgegenstände mitgenommen und verheimlicht worden waren. Fand sich dergleichen bei jemandem, wurden die Sachen konfisziert und der „Übeltäter“ bestraft. Er konnte – nach vielem Bitten – froh sein, wenn er die begonnene Reise überhaupt fortsetzen durfte. Nachdem diese Angelegenheiten geregelt waren, musste die zweite Hälfte des Reisegeldes bezahlt werden. Bei diesem Aufenthalt wird vielen zum ersten Mal der Gedanke gekommen sein, dass die erwartete große Freiheit so groß vielleicht gar nicht werden würde. Nach einem Tag Aufenthalt, an dem die Auswanderer auch an Land gehen und Einkäufe machen konnten, ging die Reise weiter, wenn nicht Unvorhergesehenes dazwischenkam. – Es kam nichts dazwischen, kein Unglück, kein Überfall. Alle sind heil in Ungarn angekommen. Sie wurden in Werischwar/Pìlisvörösvár angesiedelt. Den Namen hatte der Platz von einer „Roten Plankenburg“, einer kleinen von den Türken errichteten Festung. Ein Dorf im üblichen Sinn war nicht mehr vorhanden. In einem Bericht an die Hofkammer in Wien von 1688 heißt es: „Werischwar ist ein von langen Jahren her ganz ruiniert und ödes Dorf, allwo die Türken einen Balanken gehabt.“ Ein Kenner der damaligen Situation bemerkte zu Werischwar Folgendes: „Wo die Menschenhand abgeht, dort gibt es auch keine Bodenkultur. Spuren davon wird man hier oder dort noch bemerkt haben. Im Allgemeinen dürfte das Gebiet keinen besseren Anblick geboten haben als die vielen anderen verwüsteten Gegenden des Landes.“1
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mittendrin und am Rande – Lebenserinnerungen eines Vertriebenen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mittendrin und am Rande – Lebenserinnerungen eines Vertriebenen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mittendrin und am Rande – Lebenserinnerungen eines Vertriebenen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.