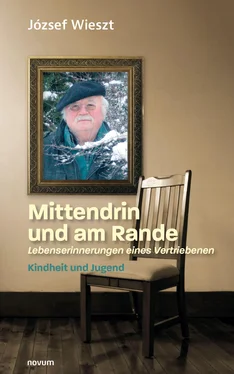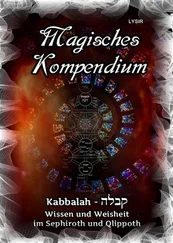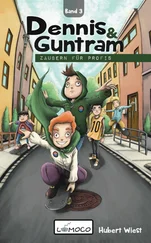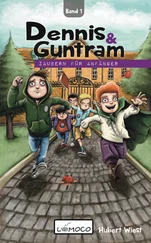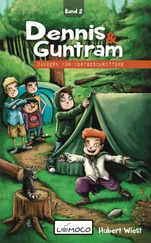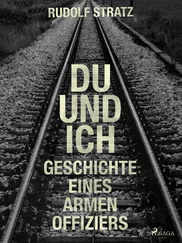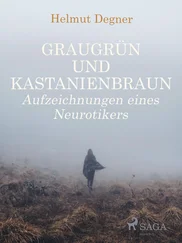Im Dorf gab’s nur eine Dreschmaschine
Im Dorf gab es eine Dreschmaschine, die vermutlich der Raiffeisen-Genossenschaft gehörte. Die Bauern mieteten diese Maschine. Sie wurde nach einem vorher festgelegten Plan auf die Bauernhöfe gebracht und dort aufgestellt. Die Dreschmaschine wurde mit Starkstrom betrieben. Die Kraftübertragung erfolgte mittels Transmissionsriemen. Sie wurde von oben mit den Getreidegarben beschickt und warf auf der Vorderseite schwere Strohbündel aus, während hinten in angeklemmten Jutesäcken die Getreidekörner aufgefangen wurden. War ein Sack voll, wurde der Auslauf mit einem Schieber geschlossen und ein neuer Sack angeklemmt. Es hingen immer drei oder vier Säcke gleichzeitig an der Maschine.
Ein voller Sack wurde auf einen Aufzug gestellt und damit so hochgezogen, dass die Träger ihn leichter schultern konnten. Für die Sackträger war das eine schwere Arbeit. Sie nahmen den offenen Sack auf den Rücken, trugen ihn drei Treppen hoch bis zum Getreideboden unter dem Dach des Wohnhauses, kippten ihn dort aus und gingen wieder zur Maschine, um den nächsten zu holen. Diese Arbeit leisteten sie stundenlang. Als ich erstmals Säcke auf den Speicher trug, war ich fünfzehn Jahre alt. Wir wohnten zu dieser Zeit nicht mehr bei Giebels, halfen aber dennoch bei der Ernte mit. Dafür erhielten wir einen halben oder ganzen Sack Getreide,
Das Dreschen war für die Familien im Dorf eine freudige Angelegenheit, wurde dabei doch ein Teil des Ertrages ihrer Jahresarbeit offenbar. Damit man die Maschine nicht zu lange mieten musste, halfen auch Verwandte und Nachbarn beim Dreschen mit. Die Frauen kochten zu Mittag einen kräftigen Eintopf und die Männer bekamen einen Schnaps – manchmal auch zwei. Wenn abends die Maschine weggebracht und Hof und Scheune aufgeräumt waren, gab es noch ein gutes Abendessen, ein Bier und einen Schnaps. Man blieb noch eine Weile beisammen und erzählte sich vom Verlauf des Tages. Dabei wurde auch gelacht.
Gab es neben dem Getreide noch andere Körnerfrüchte zu dreschen, wie Hirse und Linsen, so wurden getrockneten Pflanzen mit ihren Früchten auf dem Boden der Scheune ausgelegt und mit Dreschflegeln gedroschen. Die Flegel bestanden aus einem Stiel, an dessen oberen Ende mit einem Lederband ein flaches Holz von etwa 60 cm Länge angebracht war, dem Schlegel. Mit ihm schlugen drei Männer auf die trockenen Pflanzen auf dem Boden ein uns lösten so die Körner aus ihrer Umhüllung. Für mich war es faszinierend anzusehen, wie die Männer diese Arbeit in stets gleichbleibendem Takt erledigten.
Otto, der Imker
Noch interessanter aber war die Imkerei, die Otto betrieb. Er hatte ca. zwölf Bienenstöcke, die in einem Schuppen im Garten aufgestellt waren. Otto erklärte uns, dass die verschiedenen Farben den Bienen die Orientierung gaben, immer zu ihrem Volk zurückzufinden. Er zeigte uns auch, wie sich die Bienen mit Tänzen gegenseitig informierten, wenn sie mit kleinen Klümpchen Pollen an den Hinterbeinen von der Nahrungssuche zurückkehrten. Wir konnten zusehen, wie der Imker im Frühjahr vorgefertigte Rähmchen mit Waben in die Kästen hängte, die er im Herbst voll mit Honig wieder herausnahm. Otto entfernte zunächst die kleinen Wachsdeckel von den Waben. Danach spannte er die Rahmen in eine Zentrifuge. Zunächst vorsichtig und dann immer schneller schleudert er die Rahmen, sodass der Honig aus den Waben herauslief und sich in einem Gefäß sammelte. Danach wurde dieses flüssige Gold in Gläser mit Deckeln umgefüllt und verschlossen. Die Rahmen mit den Waben wurden danach wieder in die Bienenkästen eingehängt. Im Winter erhielten die Bienen Zuckerwasser als Nahrung.
Wir staunten sehr, dass Otto diese Arbeiten ganz ohne Schutz durchführte, wussten wir doch, wie weh Bienenstiche taten. Er erklärte uns aber, dass die Bienen nicht stechen, solange man sie nicht reizt. Bei manchen Gelegenheiten zog er sich doch einen großen Hut mit Netz über und rauchte eine große qualmende Pfeife aus Blech. Das geschah meistens, wenn eine neue Königin herangewachsen war und ein Volk sich teilte. Die kleinere Hälfte der Bienen eines Stockes folgte der ausfliegenden jungen Königin, die sich auf einem Ast niederließ, wo sie von den sie umschwärmenden Drohnen befruchtet wurde. Um diese neue Königin sammelten sich die mit ihr ausgeschwärmten Arbeitsbienen.
So entstand ein neues Bienenvolk. Der Imker wusste schon bald, wann ein Volk geschwärmt war. Er zog sich dann die erwähnte Schutzkleidung an, hielt einen Behälter unter das neue Volk, das wie ein großer summender Klumpen von dem Ast herunterhing, und schüttelte es dort hinein. Danach wurde es in einen vorbereiteten neuen Bienenkasten getan, der seinen Platz neben oder auf dem schon vorhandenen fand.
Wie die Arnolds lebten
Die Familie Arnolds hatte es mit ihrer kleinbäuerlichen Existenz nicht leicht. Sparsamkeit gehörte zu ihren obersten Grundsätzen und auch die Einstellung, dass jedes Familienmitglied etwas zum Unterhalt beitragen musste. Dies war umso wichtiger, als Herr Arnold, „Giwwels Unkel“, im Krieg einen Kehlkopfdurchschuss erhalten hatte und nicht mehr voll arbeitsfähig war. Man hatte ihm zwar eine neue Speiseröhre eingesetzt, aber er hatte große Schwierigkeiten beim Schlucken. Die Geräusche, die er dabei machte, waren für uns anfangs sehr befremdlich. Später gewöhnten wir uns daran. Weil er ein gutmeinender Mensch war und uns Kinder gern hatte, fühlten wir uns auch zu ihm hingezogen.
Die Lebensweise der Familie war sehr nüchtern und karg. Ihr protestantischer Glaube trug, wie ich vermute, zusätzlich dazu bei, dass größere Lebensfreude nicht aufkam. Frau Arnold führte ihren Haushalt mit größter Sparsamkeit. Jede Verschwendung war ihr ein Graus. Das Essen war einfach. Fleisch gab es meistens nur am Sonntag. Im Frühjahr und im Herbst schlachteten sie ein Schwein. Das Fleisch wurde zum großen Teil zu Dauerwurst verarbeitet, eingemacht oder geräuchert. Mit diesen Vorräten wurde ihr Fleischbedarf im Wesentlichen gedeckt. Daneben schlachteten sie auch einige ältere Hühner und junge Hähne. Die Legehennen sorgten für Eier.
Ich erinnere mich gut, dass die Hausfrau zu ihren Gemüse- und Kartoffelsuppen manches Mal ein Stückchen Dauerwurst „röre Worscht“ (rote Wurst) als Fleischbeilage gab. Die Hausherrin backte alle 14 Tage bis drei Wochen zehn bis fünfzehn Laibe Roggenbrot. Sie wurden im gemeindeeigenen Backhaus gebacken und auf Brettern in der Speisekammer gelagert. Auf einem flachen Raum über dem Backofen trockneten die Bauern im Herbst auf Blechen Apfel- und Birnenschnitzel und Zwetschen. Sie waren für uns Kinder, die leicht in diesen flachen Raum gelangen konnten, eine ständige Versuchung. Frau Arnold machte auch eigenen Handkäse aus Quark, den sie aus der Milch ihrer Kühe gewann. Er wurde in der Speisekammer ebenfalls auf Brettern gelagert, bis er „durch“ war. Das dauerte etwa drei Wochen. Oft kam dieser Käse aber schon früher auf den Tisch. Er war dann in der Mitte noch weiß und krümelig. So mochte ich ihn nicht, wenn er aber „reif“ war, aß ich ihn gern.
Alles Gemüse, das Obst und die Kartoffeln stammten aus eigener Produktion, auch die Eier. Das Mehl bekam man aus dem Roggen, der in der Mühle in Rennertehausen gemahlen wurde. Die groben Teile, den Schrot, benutzte man als Schweinefutter. Für den Kuchen erhielten sie vom Müller im Tausch Weizenmehl. Aus dem Laden holte sich die Bauern damals nur die Sachen, die sie nicht selbst erzeugen konnten, wie Salz, Zucker, Zimt, Rosinen, Pfeffer, Öl, Schnittkäse etc. Auf dieser Weise lebten die meisten Kleinbauern in dem Ort. Frische Wurst oder Käse wurden nicht gekauft Auch in unserer Familie war das zum großen Teil so. Geld war bei ihnen wie bei uns immer knapp.
Frau Arnold hatte ein Spinnrad und spann damit Schafwolle zu Garn. Sie strickte daraus selbst wollene Leibchen, Strümpfe und Handschuhe. Die Tochter Frieda beteiligte sich daran. Im Winter trafen sich die heiratsfähigen Mädchen und junge Frauen zur „Spinnstube“. Ich berichte davon in anderen Zusammenhang. Otto betrieb neben seiner Imkerei auch noch einen Fahrradhandel. Er verkaufte Räder der Marke „Panther“ und brachte auf diese Weise ein wenig Geld ins Haus. Bei der üblichen Produktionsweise der Kleinbauern, überwiegend Selbstversorgungswirtschaft, war der Geldmangel ein ständiger Begleiter des Lebens.
Читать дальше