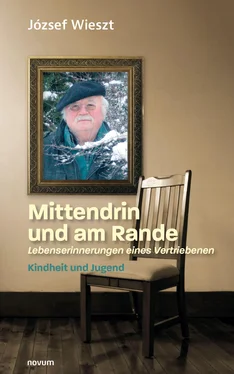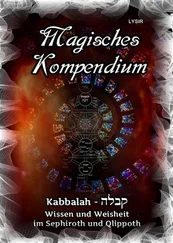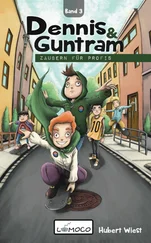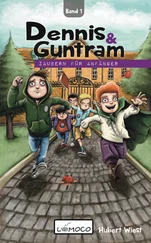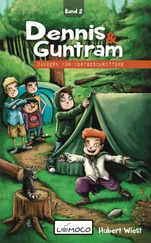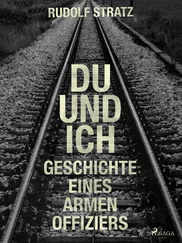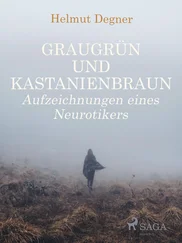Arbeitssame Leute waren wir
Ein Grund für die Verbesserung der Situation war auch, dass die Arnolds bald feststellten, dass wir keineswegs „Zigeuner“ waren, sondern arbeitsame Leute, deren Eltern in Ungarn eine ähnliche kleine Landwirtschaft gehabt hatten, sogar eine größere als sie hier. Meine Eltern waren mit all den hier anfallenden Arbeiten vertraut, und sie halfen den Vermietern bald aus, v. a. während der Ernte, bei der jede Hand gebraucht wurde. Mein Bruder und ich halfen ebenfalls mit. Eine Arbeit, die wir etwa einmal im Monat für unsere Mutter übernehmen mussten, war „Wäsche bleichen“. Wenn Mutter große Wäsche hatte, legten wir bei schönem Wetter Bettlaken, Bettbezüge und die Tischwäsche in Giebels Garten auf den Rasen und begossen sie mit Wasser aus einer Gießkanne. Das wiederholten wir einige Male. Dann wurden die Wäschestücke umgedreht und die Rückseite bleichte nun in der Sonne.
Wir durften uns auf dem Hof der Bauersleute einen Kaninchenstall bauen, und so verfolgte uns Jungen diese Arbeit auch in der neuen Wohnung. Unser „Peiniger vom Straßenrand“ wohnte nun sogar in unserer unmittelbaren Nähe
Wenn die Heidelbeeren reiften …
Wenn die Heidelbeeren reiften, mussten wir mit unserer Mutter und weiteren Frauen und Kindern in den Wald, um sie zu pflücken. Es war eine mühsame Arbeit, diese kleinen blauen Kugeln einzeln abzupflücken. Wir legten sie zunächst in ein Milchkännchen oder auch in eine Konservenbüchse, die wir mit einer Kordel um den Bauch gebunden hatten. War ein Gefäß voll, so schütteten wir es in einen Eimer, der bei der Mutter stand. Beim Pflücken konkurrierten mein Bruder und ich miteinander. Wir zeigten uns gegenseitig, was wir schon gepflückt hatten. Bei mir war der Boden schon bedeckt. Er hatte die Büchse fast zu einem Viertel gefüllt oder umgekehrt. So ging das den ganzen Tag über. Es half uns aber, die lange Zeit zu überstehen.
Schlimm war es, wenn einer stolperte und hinfiel. Der ganze Ertrag seiner Arbeit lag dann auf dem Boden, und er versuchte, die Beeren wieder in sein Gefäß zurückzubringen. Schlimm waren auch die Rinderbremsen und sonstigen Stechfliegen, die uns ständig in unsere nackten Beine stachen. Eine immerwährende Versuchung war es, die Beeren zu essen, statt sie in den Sammelbecher zu tun. Wenn unsere großen Eimer dann endlich voll waren, begann der lange Weg aus dem Wald ins Dorf zur Sammelstelle. Dort wartete schon ein Aufkäufer, der uns pro Kilo eine Mark bezahlte. Das bezahlte er aber nur für „einwandfreie Ware“. Waren zu viele Blätter zwischen den Beeren, gab es weniger Geld.
Waldhimbeeren sammelten wir zu dem gleichen Zweck. Die bei den Heidelbeeren auftauchenden Probleme wurden dabei noch vergrößert, weil wir uns an den stacheligen Himbeersträuchern die nackten Beine zerkratzten. Diese Beeren mussten noch sorgfältiger gepflückt werden als die Heidelbeeren, weil sie sehr leicht „zermatschten“ und dadurch unansehnlich wurden. Wenn wir Beeren aßen, erlebten wir häufig eine unangenehme Überraschung. War zuvor eine Blattwanze darüber gelaufen, so stanken und schmeckten sie ekelhaft, und wir spuckten die schönen Beeren wieder aus. Das wenige zusätzliche Geld, das wir durch Beeren sammeln verdienen konnten, gab unsere Mutter für Kleider und Schuhe für uns aus, denn wir wuchsen ständig aus den alten Sachen heraus.
Heuernte
Im Juni mähten unsere Hausleute ihre Wiesen. Das geschah mit einem „Mähbalken“, in dem ein Messer ständig hin und her lief und das Gras abmähte. Er war an einer Maschine angebracht, die von Kühen gezogen wurde. Otto saß auf einem Sitz zwischen den Rädern und hob und senkte den Balken mit einem Hebel. Das Gras blieb zum Trocknen in der Sonne liegen, bis es trocken war. Bei heißem Wetter wurde es mittels Rechen täglich gewendet, damit auch die Rückseite zu Heu trocknen konnte. Wenn das Heu fertig war, wurde es in lange Reihen zusammengerecht, die dann von den Männern mit Heugabeln auf einen Leiterwagen geladen wurden. Auf dem Wagen sorgte die Tochter Frieda dafür, dass es richtig verteilt wurde. Auch mein Bruder und ich halfen beim Wenden und auf dem Wagen. War ein Wagen voll, so wurde das Heu mit einem langen Rundholz, dem „Heubalken“, der längs über dem Wagen lag und hinten und vorne mit Seilen oder Ketten gespannt wurde, befestigt. Dann wurde das Heu in die Scheune auf dem Hof gefahren. Die Wege, die dabei gefahren werden mussten, waren mehrere Kilometer lang. Eine solche Fahrt dauerte jeweils über eine Stunde. Wir Kinder durften dabei oben auf dem Wagen mitfahren. Wir lagen auf dem Rücken in der Sonne, inmitten des duftenden Heus und atmeten die würzigen Sommergerüche tief ein. Für mich zählen diese Fahrten zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen an Berghofen. In der Scheune wurde das Heu vom Wagen direkt auf den Heuboden verladen. Das Auf- und Abladen war eine schwere Arbeit. Danach ging’s wieder zurück auf die Wiese, und die Arbeit begann von Neuem. Am Nachmittag fand eine kurze Erholungspause auf der Wiese statt. Zur Stärkung hatte die „Giwwelstante“ Kuchen und Pfefferminztee mitgebracht. Auch an diese Pausen erinnere ich mich gern zurück.
Otto, der Wagenlenker
Der Wagenlenker bei all den Fahrten auf die Felder und Wiesen war Otto, der Sohn der Hausleute. In der rechten Hand hielt er die Peitsche, die er nur sehr sparsam einsetzte, sozusagen nur zur Erinnerung, damit die Kühe beim Ziehen nicht einschliefen. Leicht ließ er das Seilende über den Rücken der Tiere streifen. Die Ahnung, dass er auch schmerzhaft zuschlagen könnte, beschleunigte für eine Weile ihren Schritt, bis sie wieder langsamer wurden. Dann wiederholt sich alles wieder. Otto dirigiert die Tiere meistens mit Sprache: „Oaar“ hieß links, „hott“ hieß rechts, „brrr“ anhalten, „hüüüh“, hieß „Los, los!“ War er zufrieden, klang seine Stimme versöhnlich, wenn er den Namen der Tiere aussprach: Sie hießen „Bless“, „Liese“ oder „Braune“. Gingen sie nicht so, wie sie sollten, schrie er „Schinnoos“, „Brauner Deivel“, „Deer weer ich hälfe“, dann schlug er nach ihnen. Er war jähzornig. Diese Wutanfälle waren sozusagen das ergänzende Verhalten zu seiner sonst überwiegenden Ruhe.
Giebels haben sich nie einen Traktor angeschafft, auch keinen Selbstbinder. Das Geld dazu fehlte immer. Auch an einen „Gummiwagen“ kann ich mich nicht erinnern, so wurden Wagen mit Gummi bereiften Rädern genannt. Giebels Wagen hatten Holzspeichenräder mit einem Stahlband drum herum. Die Lauffläche war im Sommer silbrig glänzend vom Gebrauch mit Kratzspuren überfahrener Steinchen. Der Seitenrand kontrastierte dazu rostig-schmutzig. In Berhofen gab es keine Ochsen, es gab nur junge Bullen, die bald geschlachtet oder verkauft wurden, und den Deckbullen, der für Nachwuchs sorgte. Die Kühe waren rechts und links der Wagendeichsel festgemacht. Sie zogen mit einem „Kummet“, das vor die Stirn der Tiere mit Riemen geschnallt wurde und an dem die Zugketten befestigt waren. Die Ketten liefen über eiserne Führungsringe, die an breiten ledernen Leibriemen an den Außenseiten der Tiere befestigt waren. Sie waren an jeweils einer „Runge“ befestigt, die ihrerseits mittels Ring und Öse an der „Waage“ festgemacht war. Sie wurde über einen starken Bolzen geschoben, der in eine Halterung am Ende der Deichsel eingelassen war. Er stellte die feste Verbindung zum Wagen dar. An ihm hingen die komplette Zugvorrichtung und damit das ganze Gewicht des Wagens.
Gelenkt wurden die Tiere mittels langer Lederriemen, der „Korschel“, die jeweils an der äußeren Seite des Kummets der Zugtiere befestigt waren. In den Händen des „Kutschers“ liefen die Riemen zusammen. Ein kurzer Ruck am rechten Riemen und die Tiere fuhren rechts heran oder bogen rechts ab. Ein Zug nach links und das Gleiche geschah in der umgekehrten Richtung. Wurden beide Riemen gezogen, fast immer verbunden mit einem lauten „brrrrrh“, blieben die Tiere stehen. War die Straße abfallend, mussten sie die Beine spreizen und sich gegen das Gewicht des nachschiebenden Wagens stemmen, um anzuhalten. Ging‘s zu steil abwärts, zog Otto die Bremsen des Wagens an und entlastete damit die Tiere. Die Bremse war ein mit Gummi beschlagener Holzkeil, der mittels einer Gewindestange auf die Lauffläche der Räder gepresst wurde. Dann entstand ein kratzendes, zuweilen quietschendes Schleifgeräusch. Je schwerer der Wagen beladen war, desto lauter und störender wurde es. Drehte er die Bremse wieder auf, rollte der Wagen leiser weiter.
Читать дальше