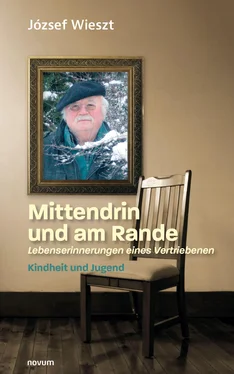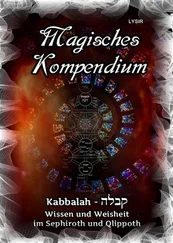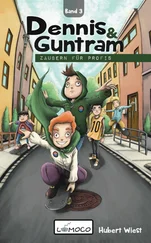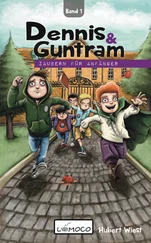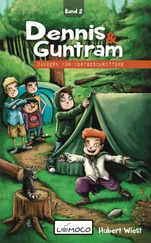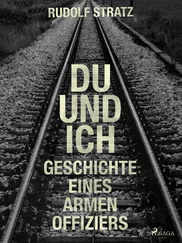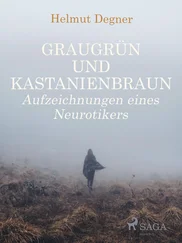Koch bei den Amis
Nach einer gewissen Zeit im Lager, hatte er dort, wohl weil er kochen konnte, als Koch gearbeitet. Er wurde dann in ein Magazin der amerikanischen Armee versetzt: Materialausgabe für US-Soldaten. Dort „organisierte“ er zusammen mit zwei anderen alles Brauchbare, v. a. aber Ami-Zigaretten. Unsere Mutter holte diese Zigaretten in München ab, und der Kopp-Opa vertrieb sie in Berghofen und Umgebung, wohin es seine Familie verschlagen hatte. Mutter soll alle 14 Tage nach München gefahren sein. Auf diese Weise unterhielt er seine Familie, die inzwischen nach Nordhessen vertrieben worden war. In München lernte er die Zofe von Marlene Dietrich kennen und später auch diese selbst in ihrer Wohnung. Ob er ein Verhältnis mit einer der beiden hatte? Darüber sprach er nicht. Später oder zur gleichen Zeit hatte er ein Verhältnis mit einer anderen Frau, Name unbekannt. Mit ihr hatte er angeblich einen Sohn. Was aus ihm geworden ist, ist nicht bekannt. Unsere Mutter hat diese Frau bei ihren Fahrten nach München selbst kennengelernt. Sie wollte ihn zu seiner Familie zurückholen. Er wollte aber bei der Frau in München bleiben und nicht zu seiner Familie nach Berghofen kommen. Er hätte dadurch seinen Job im Magazin verloren, der offenbar sehr bequem und lukrativ war.
Von unserer Mutter und dem Kopp-Opa wurde er unter Druck gesetzt, zu seiner Familie zurückzukehren. Einmal ist er zu Besuch gekommen – wahrscheinlich Anfang 1947 – und wieder nach München zurückgefahren. Den Ausschlag, dass er im Spätherbst 1947 doch zu seiner Familie zurückkam, gab wohl ein Brief seiner Mutter: Sie drohte ihm darin an, „ins Wasser zu gehen“, wenn er bei der Frau in München bleibe.
Er kam mit dem Fahrrad
Er kam mit einem Fahrrad und einer ledernen schwarzen Aktentasche von Marburg aus zu uns. Bis Marburg/Lahn war er mit dem Zug gefahren. Vor uns Kindern stand ein hagerer fremder Mann mit einer Schirmmütze. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob er uns in den Arm genommen oder wie er uns sonst begrüßt hat. Nur an diese Aktentasche erinnere ich mich. Sie enthielt neben Ami-Zigaretten ein „Staverl“: den bereits erwähnten lederbezogenen Rohrstock. Nach den oben erwähnten Spannungen mit den Hausleuten mussten wir bald ausziehen.
Aber wohin? „Niemand im Dorf wollte uns haben“, erzählte uns unsere Mutter. Da wir aber eine Unterkunft brauchten, eine Familie mit drei kleinen Kindern konnte ja nicht auf der Straße leben, wurden wir bei der Familie Arnold, Hausname Giebels (Giwwels), zwangseingewiesen.
Bei Familie Arnold
Geleitschutz
Ein Polizist aus der benachbarten Kleinstadt Battenberg soll uns (mit gezogener Pistole?) in die angewiesenen beiden Räume gebracht haben. Um Probleme zu vermeiden, war er mit dabei. Unser Vater ist in meiner Erinnerung bei diesem Umzug nicht vorhanden. Schrank, Bett und Tisch hat er vermutlich schon vorher dorthin geschafft. Möglicherweise musste er an dem Tag arbeiten, denn 1951 im Sommer hatte er schon einen Hilfsarbeiterjob als Handlanger auf dem Bau gefunden.
Es war die gute Stube der Bauern, in die wir zogen. Eine anschließende Kammer wurde das Kinderschlafzimmer. Eine Küche gab es für uns nicht. Vermutlich hat unsere Mutter auf einem Ofen im Wohnzimmer gekocht.
Der Umzug erfolgte nach der Erinnerung unserer Schwester so: Der Polizist ging vorneweg.
Maria folgte ihm an der Hand unserer Mutter. Sie durfte die Sturmlaterne tragen. Dann folgten mein Bruder und ich. Wir zogen den Handwagen mit unseren wenigen Habseligkeiten, einem Feldbett („Amibett“), das wohl der Vater auch mitgebracht hatte, und einem Kinderbett für die Kleine.
Unser Empfang bei Giebels war mehr als frostig. Für dreieinhalb Jahre wohnten wir zu fünft in den beiden Räumen: zwei Erwachsene, zwei heranwachsende Jungen und unsere kleine Schwester Maria. Um in unser Zimmer zu gelangen, mussten wir durch den Hausflur, zwei Holzstufen hinauf und dann nach rechts in unsere Wohnung. Das Ehepaar Arnold hatte zwei erwachsene Kinder, die Geschwister Otto und Frieda. In den ersten Wochen trauten wir uns kaum hinaus, aus Angst, jemandem von den „Hausleuten“ zu begegnen. Es kam anfangs aber nicht oft dazu, denn wir horchten an der Tür, ob nicht gerade jemand von ihnen im Hausflur war, und gingen nur hinaus, wenn wir nichts hörten. Trafen wir dennoch einen an, erschraken wir Jungen jedes Mal heftig und gingen ihm schnell aus dem Weg. Zumindest bei mir war es so. Meine Mutter hatte uns verboten, mit den Hausleuten zu reden oder gar etwas von ihnen anzunehmen. Sie war sehr beleidigt darüber, dass man sie und ihre Familie nicht wollte.
Die kleine Maria bricht das Eis
Anfangs sprachen wir und die Giebels nicht miteinander. Die kleine Maria, drei Jahre alt, hielt sich aber nicht an das Verbot. Sie brach schließlich das Eis. Ständig rannte sie hinter Otto und Frieda her, den erwachsenen Kindern der neuen Hausleute. Unsere Mutter versuchte immer wieder, sie zurückzuhalten, aber sie ließ sich nicht daran hindern. Sie rannte auch hinter der „Giwwelstante“29, Frau Arnold, her, sogar bis Backhaus in der Mitte des Dorfes. Maria wollte immer Gläser mit Marmelade von der „Giwwelstante“ haben. Ihr wurde gesagt, wenn ein Mann in gläsernen Stiefeln komme, der eine gläserne Leiter trage, dann dürfe sie zur Marmelade. Otto hatte unsere kleine Schwester offenbar sehr gern. Scherzhaft nannte er Maria „schoarzes Oos“ oder „schwoazer Deiwel“ (schwarzes Aas oder schwarzer Teufel). Darüber hat sie sich immer geärgert. „Ech sei kän schworzer Deiwel!“ („Ich bin kein schwarzer Teufel!“)
Sie ging neugierig und unbefangen auf unsere Vermieter zu und hatte durch ihre kindlich-freundliche Art bald das Herz der Frauen gewonnen. Sie war ja im Dorf geboren und damit sozusagen schon eine Einheimische. Das Eis zwischen uns begann schon nach einigen Wochen, etwas aufzutauen. Der Anlass war folgender:
Maria war verschwunden. und meine Mutter machte sich große Sorgen. Sie ging sie suchen. Von Nachbarn erfuhr sie, dass die Kleine mit der „Giwwelstante“, Frau Arnold, mit zum Backhaus gegangen war. Meine Mutter kam dorthin und traf die beiden an. Sie wollte ihr Kind sofort mitnehmen. Das Kind wollte aber nicht. Sie wehrte sich und schrie wie am Spieß.
Da sprach Frau Arnold meine Mutter an: „Lassen Sie das Kind doch hier, ich bringe sie ja heil wieder nach Hause.“ Das waren wohl die ersten Worte, die sie an meine Mutter gerichtet hatte. Meine Mutter gab nach und die Kleine durfte bleiben. Sie hatte einen besonderen Grund, nicht mit der Mutter zu gehen. Im Backhaus backten die Frauen nicht nur ihre Brote, sondern auch leckere Zucker- und Streuselkuchen, im Herbst auch Apfel- und Pflaumenkuchen. Ein weiterer Vorfall, den meine Schwester ausgelöst hatte, wirkte sich ebenfalls fördernd auf die Kommunikation aus: Im Dorf feierten die Ungarndeutschen „Kiridog“, ihr Kirmesfest. Maria hatte ihr neues Kleid mit Rotkäppchenmuster an, das ihr unsere Wiest-Großmutter aus diesem Anlass geschenkt hatte. Die Kleine war als Erste fertig angezogen für dieses Ereignis und wartete schon auf dem Hof auf uns andere. Dort stand auch der vollgetankte Jauchewagen der Hausleute. Maria sah ihn sich genauer an, entdeckte hinten an dem Tank eine Kette und zog daran. In einem hohen Schwall ergoss sich die stinkende Brühe über sie. Auf ihr lautes Geschrei hin liefen die Frauen auf dem Hof zusammen. Meine Mutter rannte unser „Trögl“ holen, in dem wir Kinder immer badeten. Die Giebelstante und die Frieda zogen das unglückliche Kind aus. Wasser wurde herbeigeschafft und die Kleine vom Kopf bis Fuß eingeseift und abgeschrubbt, abgetrocknet und neu eingekleidet. Ob sie hinterher nicht doch noch ein wenig gestunken hat, ist nicht bekannt. Sie konnte jedenfalls mit zum Kirchweihfest gehen. Selbstverständlich hatten die Frauen bei dieser Rettungsaktion auch mit einander gesprochen. Ich gehe übrigens davon aus, dass unser Vater von Anfang an mit den Hausleuten gesprochen hat.
Читать дальше