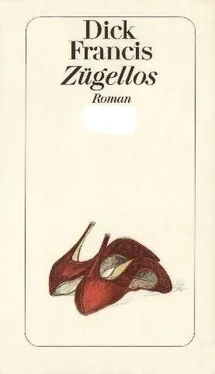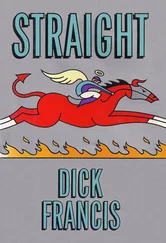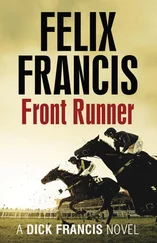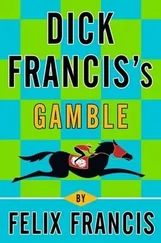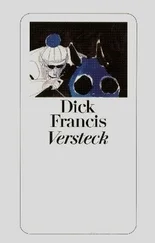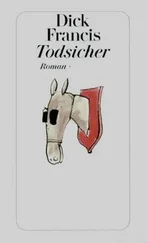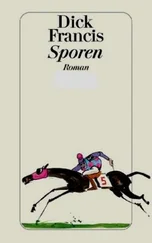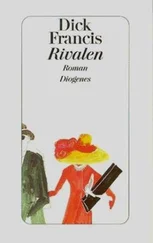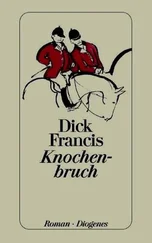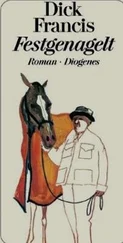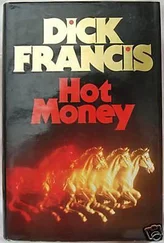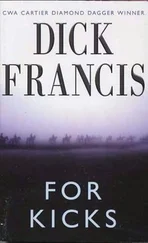Mein Werk, ob es stand oder fiel. Leben auf dem schiefen Turm.
Ich hatte, als ich von Newmarket nach Westen aufbrach, nur eine vage Vorstellung davon, wo ich hinfuhr, und noch weniger ahnte ich, was ich sagen sollte, wenn ich ankam.
Vielleicht, um den Augenblick hinauszuschieben, aber auch, weil es am Weg lag, fuhr ich zuerst nach Cambridge und zu dem Krankenhaus, in dem Dorothea untergebracht war. Am Telefon hatte ich immer nur zu hören bekommen: »Es geht ihr gut«, aber das konnte auch bedeuten, daß sie im Sterben lag oder mit Drogen vollgepumpt war, und wie vorauszusehen bewog mein persönliches Erscheinen die Schwestern nicht, mich zu ihrer Patientin vorzulassen.
»Tut uns leid, kein Besuch.«
Nichts konnte sie umstimmen. Keinerlei Besuch, mit Ausnahme ihres Sohnes. Ihn könne ich wohl sprechen, wenn ich wollte.
»Ist er hier?« fragte ich und wußte selbst nicht, warum mich das erstaunte. Nichts auf der Welt hätte Paul von einer ausgewachsenen Krise ferngehalten.
Eine der Schwestern war so nett, ihn von meiner Anwesenheit zu unterrichten, und kam mit ihm im Schlepptau wieder.
»Mutter ist nicht in der Verfassung, Sie zu empfangen«, verkündete er, als wäre sie sein Eigentum. »Außerdem schläft sie.«
Wir musterten uns mit gegenseitigem Mißfallen.
»Wie geht’s ihr?« fragte ich. »Was sagen die Ärzte?«
»Sie liegt auf der Intensivstation.«
Pauls offiziöser Ton klang selbst für seine Verhältnisse übertrieben.
Ich wartete. Schließlich erläuterte er: »Wenn keine Komplikationen eintreten, kommt sie durch.«
Großartig, dachte ich. »Hat sie gesagt, wer sie angegriffen hat?«
»Sie ist geistig noch nicht klar.«
Ich wartete wieder, aber diesmal ohne Erfolg. Als er sich anschickte, mich einfach stehenzulassen, um das Gespräch zu beenden, sagte ich: »Haben Sie gesehen, in welchem Zustand ihr Haus ist?«
Er antwortete stirnrunzelnd: »Ich war heute morgen da. Die Polizei hat meine Fingerabdrücke genommen!«
Er klang empört.
»Meine auch«, sagte ich ruhig. »Geben Sie mir bitte meine Bücher zurück.«
»Was war das?«
»Sie sollen Valentines Bücher und Unterlagen herausgeben.«
Er starrte mich mit einer Mischung aus Entrüstung und Haß an. »Ich habe Valentines Bücher nicht. Die haben Sie kassiert.«
»Habe ich nicht.«
Ein böser, selbstgerechter Blick. »Mutter hat die Tür abgesperrt und sich geweigert - geweigert -, mir den Schlüssel zu geben. Ihrem eigenen Sohn!«
»Gestern abend hat der Schlüssel in der offenen Tür gesteckt«, sagte ich. »Und die Bücher waren fort.«
»Weil Sie sie abgestaubt haben. Ich habe sie jedenfalls nicht .«
Ich fing an, seinen Unschuldsbeteuerungen zu glauben, so unwahrscheinlich sie auch waren.
Aber wenn er die Sachen nicht weggeholt hatte, wer in aller Welt dann? Der Schaden im Haus und der Angriff auf Dorothea zeugten von Gewalt und Eile. Das Leerräumen einer Bücherwand und etlicher Schränke voll Unterlagen zeugte von Gründlichkeit und Zeit. Und Robbie Gill war sicher, daß die Randale dem Angriff auf Dorothea vorausgegangen war.
All das reimte sich nicht.
»Weshalb«, fragte ich, »waren Sie derart erpicht darauf, die Bücher an sich zu bringen?«
Irgendwo in seinem Hirn läuteten Alarmglocken. Ich hatte mit zu vielen Schauspielern gearbeitet, als daß ich das so oft schon ausgelöste Zucken in den Augenmuskeln nicht erkannt hätte. Paul, dachte ich, handelt nicht einfach aus Habgier, aber wenn ich auch merkte, daß es da ein stärkeres Motiv gab, blieb mir doch unklar, worin es bestand.
»Familieneigentum bleibt immer am besten in der Familie«, dozierte er und setzte, bevor er davonstolzierte, noch eins drauf: »Wegen des Zustands meiner Mutter ist die für morgen früh geplante Einäscherung Valentines auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Bitte verschonen Sie uns künftig mit Ihren Besuchen. Mutter ist alt und gebrechlich, und ich werde mich um sie kümmern.«
Ich sah zu, wie sein massiger Rücken enteilte, Großspurigkeit in jedem Schritt, und die Schöße seiner Anzugsjak-ke im Gehen nach außen schwangen.
»Paul!« rief ich laut hinter ihm her.
Er hielt zögernd an und drehte sich um, blieb aber breit im Krankenhausflur stehen, statt zurückzukommen. »Was ist denn noch?«
Ein Meter Taillenumfang mindestens, dachte ich. Ein schwerer Ledergürtel hielt die dunkelgraue Hose. Cremefarbenes Hemd, schräggestreifter Schlips. Das dicke Kinn streitlustig vorgereckt.
»Was wollen Sie?«
»Nichts«, sagte ich. »Schon gut.«
Er zuckte verärgert mit den schweren Schultern, und ich ging nachdenklich zu meinem Wagen und sann über Telefone nach. Ich trug mein Mobiltelefon jederzeit einsatzbereit am Gürtel. Paul hatte genauso ein Gerät, war mir aufgefallen, und trug es ebenfalls an seinem breiten Gürtel.
Gestern abend war ich Dorotheas wegen froh gewesen, daß Paul daheim in Surrey ans Telefon gegangen war, als ich ihn von dem Überfall auf seine Mutter verständigt hatte. Surrey war ein felsenfestes Alibi.
Hätte ich Paul gemocht oder ihm auch nur getraut, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, der Sache nachzugehen. So aber versuchte ich mich an die Nummer zu erinnern, die ich angerufen hatte, bekam aber nur die ersten vier und die zwei letzten Ziffern zusammen, und damit war keine Verbindung herzustellen.
Ich rief das Amt an und fragte, ob die vierstellige Zahl am Anfang eine Ortsvorwahl in Surrey sei.
»Nein, Sir«, sagte eine muntere Frauenstimme, »das ist ein Code für Mobiltelefone.«
Erstarrt fragte ich, ob sie mir die Nummer von Paul Panniers Funkanschluß heraussuchen könne; er lebe in der Nähe von Godalming; die beiden letzten Ziffern seien zweimal die Sieben. Nach kurzer Pause nannte sie mir entgegenkommend die Nummer, die ich vergessen hatte, und ich schrieb sie auf und tätigte meinen Anruf.
Paul meldete sich knapp: »Ja?«
Ich sagte nichts.
Paul sagte: »Wer ist da? Was wollen Sie?«
Ich schwieg.
»Ich kann Sie nicht hören«, sagte er verärgert und schaltete sein Gerät ab.
Soviel zu Surrey, dachte ich grimmig. Aber nicht einmal Paul - nicht einmal Paul hätte seine eigene Mutter aufschlitzen können.
Es war schon vorgekommen, daß Söhne ihre Mütter umgebracht hatten. Aber kein dicker Mittvierziger, der allzusehr von sich überzeugt war.
Beunruhigt fuhr ich westwärts nach Oxfordshire und machte mich auf die Suche nach Jackson Wells.
Wieder mit Hilfe der Telefonauskunft fand ich heraus, in welcher Gegend er wohnte, und indem ich Tankwarte und Spaziergänger mit Hund zu Rate zog, gelangte ich schließlich zur Batwillow Farm südlich von Abingdon, südlich von Oxford, verschlafen und friedvoll am späten Sonntagnachmittag.
Ich rumpelte langsam einen ausgefahrenen, unbefestigten Weg entlang, der in einem ungepflegten Platz vor einem mit Kletterpflanzen bewachsenen Haus endete. Unkraut gedieh. Ein Satz alter Reifen lehnte an einem baufälligen Holzschuppen. Ein wacklig anmutender Stapel Zaunlatten schien vor sich hin zu gammeln. Ein muffeliger alter Griesgram lehnte am Eingangstor und starrte mich ungnädig an.
Schon beim Aussteigen deprimiert, fragte ich: »Mr. Wells?«
»Hä?«
Er war schwerhörig.
»Mr. Wells«, rief ich.
»Ja.«
»Kann ich Sie mal sprechen?« rief ich.
Aussichtslos, dachte ich.
Der Alte hatte mich nicht verstanden. Ich versuchte es noch einmal. Er schaute mich nur gleichmütig an und zeigte dann aufs Haus.
Ich wußte zwar nicht genau, was er damit meinte, ging aber vom Tor zur Tür und drückte auf eine unübersehbare Klingel.
Es gab kein leises Dingdong wie bei Dorothea: der Lärm der Klingel auf der Batwillow Farm ging einem durch Mark und Bein. Bald darauf öffnete ein hübsches, blondes junges Mädchen mit Pferdeschwanz und Pfirsichhaut die Tür.
Читать дальше