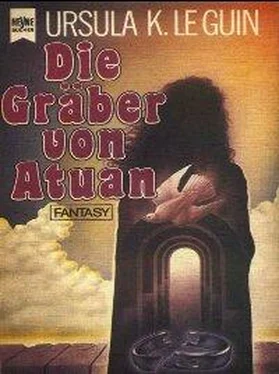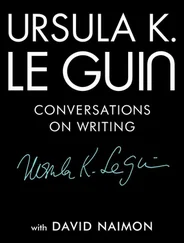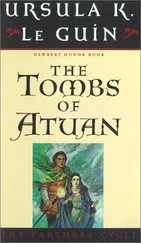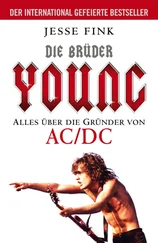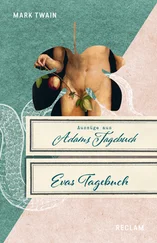Langsam bewegte sie sich jetzt vorwärts, sie war unsicher, und ihre Gedanken überstürzten sich. Sie tastete nach links, den zweiten Eingang suchend, den Gang, der ins Labyrinth führte. Hier blieb sie stehen und lauschte.
Ihr Gehör sagte ihr nicht mehr als ihre Augen. Aber als sie regungslos stand, mit ausgestreckten Händen den Eingang links und rechts berührend, fühlte sie ein schwaches, fast unmerkliches Vibrieren im Fels, und die kalte, verbrauchte Luft enthielt etwas, das ihr fremd war, das nicht hierhergehörte: den Geruch von wildem Salbei, der auf den Hügeln der Wüste wuchs, über ihr, unter dem freien, offenen Himmel.
Langsam und lautlos schlich sie vorwärts, ihrer Nase folgend.
Nach ungefähr hundert Schritten hörte sie ihn. Er war fast so lautlos wie sie, aber er bewegte sich nicht so sicher in der Dunkelheit, mit der sie vertraut war. Sie hörte ein ganz schwaches Schürfen, so als ob er sich an dem unebenen Boden gestoßen und sofort wieder gefangen hätte. Sonst vernahm sie nichts. Sie wartete eine Weile, dann ging sie langsam weiter, mit den rechten Fingerspitzen leicht die Wand berührend. Endlich spürte sie den gerundeten Metallstreifen unter den Füßen. Hier hielt sie inne und tastete den Metallstreifen hoch, streckte sich, so weit sie konnte, bis sie einen Griff zu fassen bekam, der aus dem Metall herausragte. Diesen hielt sie fest und zog ihn, plötzlich, mit ihrer ganzen Kraft nach unten.
Ein furchtbares Rasseln ertönte, dann ein dumpfer Schlag. Blaue Funken fielen um sie nieder. Echos verhallten streitend im Gang hinter ihr. Sie streckte ihre Hände aus und fühlte, nur Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt, die beschlagene Oberfläche einer eisernen Tür.
Sie atmete tief aus.
Langsam folgte sie dem Gang, der zum Untergrab führte, und sich rechts haltend, kehrte sie zur Falltür hinter dem Thronsaal zurück. Sie beeilte sich nicht und ging leise, obwohl es nicht mehr nötig war, still zu sein. Sie hatte ihren Dieb gefangen. Die Tür, durch die er geschritten war, war die einzige, die ins Labyrinth hinein- und aus ihm herausführte. Und sie konnte nur von außen geöffnet werden.
Jetzt war er dort unten, in der Dunkelheit unter der Erde, und er würde nie mehr herauskommen.
Aufrecht und gelassen schritt sie am Thron vorbei und die lange, von Säulen flankierte Halle hinunter. Dort, wo sich auf einem hohen Dreifuß eine Bronzeschale voll glühender Kohle befand, wandte sie sich um und näherte sich den sieben Stufen, die zum Thron hinaufführten.
Auf der niedersten Stufe kniete sie nieder und berührte mit ihrer Stirn den kalten, staubigen Stein, der von Mäuseknochen übersät war, die die Eulen hatten fallen lassen.
»Vergebt mir, daß ich Zeuge war, wie Eure Dunkelheit zerstört wurde«, flehte sie, ohne die Worte laut zu sprechen. »Vergebt mir, daß ich Zeuge war, wie Eure Gräber geschändet wurden. Ihr werdet gerächt werden. Oh, meine Gebieter, der Tod wird ihn Euch übergeben, und er wird niemals wiedergeboren!«
Doch noch während sie betete, sah sie vor ihrem geistigen Auge den herrlich schimmernden Glanz des leuchtenden Gewölbes, sah Leben an der Stätte des Todes, und anstatt Furcht wegen der Schändung und Zorn gegen den Verbrecher zu verspüren, mußte sie immer wieder daran denken, wie seltsam es war, wie seltsam …
»Was soll ich nun Kossil sagen?« fragte sie sich, als sie in den Wintersturm hinaus trat und ihren Umhang fester um die Schultern zog. »Nichts. Noch nichts. Ich bin die Herrin des Labyrinths. Das geht den Gottkönig nichts an. Vielleicht werde ich es ihr sagen, wenn der Dieb tot ist. Wie werde ich ihn töten? Ich sollte Kossil mitbringen und zuschauen lassen, wie er stirbt. Sie hat den Tod ja gern. Was hat er nur gesucht? Er muß wahnsinnig sein. Wie kam er nur hinein? Kossil und ich sind die einzigen, die einen Schlüssel für die Tür zwischen den roten Felsen und die Falltür besitzen. Er muß aber durch die Felsentür gekommen sein. Nur ein Hexenmeister kann die öffnen. Ein Hexenmeister …?«
Sie erstarrte, obwohl der Wind sie fast umriß.
»Er ist ein Hexenmeister, ein Zauberer aus den Innenländern, der das Amulett von Erreth-Akbe sucht.«
Und dieser Gedanke war von solch einer unheimlichen Faszination, daß ihr trotz des eisigen Windes ganz warm wurde und sie laut auflachte. Die Stätte und die Wüste, die sie umgab, waren schwarz und still; der Wind heulte; kein Licht brannte im Großhaus; feiner, fast unsichtbarer Schnee trieb an ihr vorbei.
»Wenn er die rote Felsentür aufgemacht hat, dann kann er auch andere Türen öffnen. Er kann entfliehen.«
Der Gedanke rieselte ihr kalt durch die Glieder, aber er überzeugte sie nicht. Die Namenlosen hatten ihn eintreten lassen. Warum auch nicht? Er konnte kein Unheil anrichten. Welche Gefahr stellte ein Dieb dar, der die Stätte seines Verbrechens nicht verlassen konnte? Gewiß, er besaß die Macht, Zauber und Schwarze Magie zu wirken, und groß mußte seine Macht sein, denn er war weit gekommen. Aber weiter kam er nicht. Keine Zauberei eines Sterblichen konnte sich mit dem Willen der Namenlosen messen, mit denen, die in den Gräbern gegenwärtig waren, mit den Herrschern, deren Thron leer stand.
Um sich dessen zu vergewissern, eilte sie zum Kleinhaus hinunter. Manan war eingeschlafen auf der Veranda. Er hatte sich in seinen Umhang und in die alte Pelzdecke gehüllt, die ihm als Winterbett diente. Sie trat leise ein, um ihn nicht aufzuwecken, und zündete keine Lampe an. Sie öffnete einen kleinen, verschlossenen Raum, nicht viel größer als ein Schrank, am Ende des Flurs. Dort schlug sie einen Funken, gerade lang genug, um eine gewisse Stelle am Boden zu finden, und sich niederkniend löste sie eine Kachel vom Boden.
Ein kleines Stück grobes, schmutziges Gewebe, nur ein paar Zentimeter groß, lag unter ihren Fingern. Das schob sie lautlos zur Seite. Sie fuhr zurück, denn ein Lichtstrahl drang herauf, fiel ihr direkt ins Gesicht.
Sie faßte sich und schaute dann, ganz vorsichtig, durch die Öffnung. Sie hatte vergessen, daß er dieses seltsame Licht am Ende seines Stabes hatte. Sie hatte höchstens erwartet, daß sie ihn dort unten in der Dunkelheit hören würde. Das Licht hatte sie vergessen, aber er stand dort, wo sie ihn erwartet hatte: direkt unter dem Guckloch, an der Eisentür, die den Ausgang aus dem Labyrinth versperrte.
Da stand er, eine Hand leicht in die Hüfte gestemmt, mit der anderen, von sich weggestreckt, hielt er den hölzernen Stab, der so groß wie er selbst war und an dessen Spitze dieses kleine, magische Lichtlein schwebte. Sein Kopf, auf den sie aus zwei Metern Höhe herabschaute, war etwas zur Seite geneigt. Seine Kleidung war nicht anders als die eines Winterreisenden oder Pilgers, ein kurzer, warmer Umhang, ein Lederwams, Strümpfe aus Wolle und geschnürte Sandalen. Auf dem Rücken trug er einen kleinen Ranzen, an dem eine Wasserflasche baumelte, an der Seite ein Messer, das in einer Scheide steckte. Er stand regungslos da, wie eine Statue, aber entspannt und nachdenklich.
Langsam hob er seinen Stab und hielt das helle Ende gegen die Tür, die Arha von ihrem Guckloch aus nicht sehen konnte. Das Licht veränderte sich, wurde kleiner und schien in durchdringender Helle. Die Sprache, die sie vernahm, kam Arha seltsam vor, doch noch seltsamer berührte sie die tiefe, wohlklingende Stimme.
Das Licht am Stab veränderte sich wieder, flackerte und wurde schwächer. Im nächsten Augenblick war es erloschen, und sie konnte ihn nicht mehr sehen.
Jetzt erschien wieder das schwache, violette, gleichmäßige Moorlicht, und sie sah, wie er sich von der Tür abwandte. Sein Öffnungszauber hatte versagt. Die Mächte, die das Schloß dieser Tür festhielten, waren stärker als alle Magie, über die er verfügte.
Er schaute sich um und schien zu denken, was nun?
Читать дальше