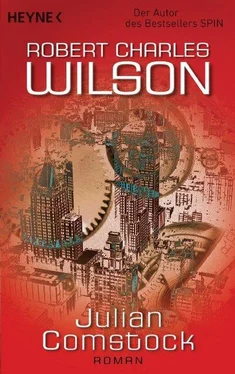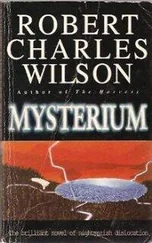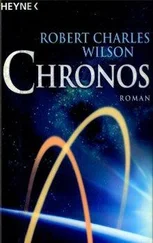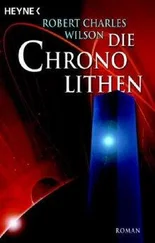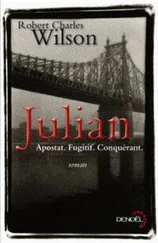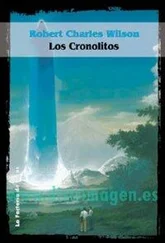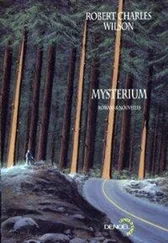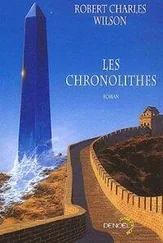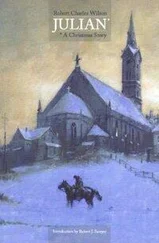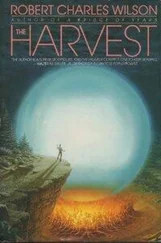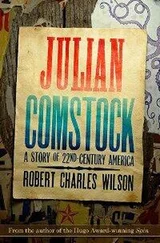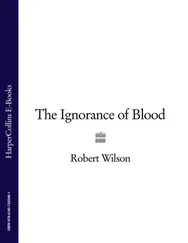»Dann hast du sie aus der Entfernung beobachtet?«
»Eigentlich …«
»Bist du dir überhaupt sicher, dass es Piraten gibt — wenn du sie noch nie gesehen hast? Nein, sag jetzt nichts; aber dafür sag ich dir was: Warum schreibst du über Piraten, Adam, wo du in ein Abenteuer verstrickt bist, das mindestens so bedeutsam ist wie alles, was C. C. Easton sich jemals ausgedacht hat?«
»Was wollen Sie damit sagen — dass ich über den Krieg schreiben soll? Ich kenne ihn doch kaum.«
»Egal! Schreibe, was du weißt: Das ist ein ehernes Gesetz in unserem Metier.«
»Umso schlimmer für mich«, sagte ich benommen, »denn ich weiß herzlich wenig, wenn’s drauf ankommt.«
»Jeder weiß etwas. Die Schlacht von Mascouche zum Beispiel. Warst du nicht mittendrin?«
»Ja, aber es war meine erste.«
»Wäre es nicht eine vernünftige Übung, mit dem Bleistift festzuhalten, was an diesem Tag passiert ist? Nicht, was der Laurentischen Armee passiert ist — überlass das den Historikern —, ich meine, was dir passiert ist — was du ganz persönlich erlebt hast.«
»Wen interessiert das?«
»Es wäre auf jeden Fall eine Übung im Schreiben. Adam«, rief er, stand von seinem Hocker auf und warf mir in einer unerwartet jovialen Geste einen Arm um die Schultern, »warum verplemperst du deine Zeit hier oben? Ein Schriftsteller muss vor allen Dingen schreiben! Vergeude nicht kostbare Minuten, indem du auf meine Schreibmaschine starrst — oder schlimmer noch, sie anfasst —, jetzt, wo der Feind ruhig und das Wetter schön ist, hast du Zeit, deine literarischen Fertigkeiten zu schulen! Nimm deinen bescheidenen Bleistift, Adam Hazzard, und schreibe deine Erinnerungen an die Ereignisse der letzten paar Tage auf — und spare nicht mit Einzelheiten.«
Das leuchtete mir sofort ein — ich war Feuer und Flamme und machte mir Vorwürfe, nicht selbst darauf gekommen zu sein. »Wenn ich mit dem Aufsatz fertig bin, darf ich dann damit vorbeikommen?«
Er setzte sich, als bliebe ihm die Luft weg. »Vorbeikommen?«
»Mit meiner Beschreibung der Schlacht. Damit Sie mir sagen können, was ein erfahrener Schriftsteller anders gemacht hätte.«
Mr. Dornwood schob die Brauen zusammen, er war sichtlich verstört; dann sagte er: »Also gut … sagen wir nächsten Sonntag — wenn wir dann noch unter den Lebenden weilen.«
»Das ist sehr großzügig!«
»Ich bin ein weithin bekannter Heiliger.«
Ich wollte schnurstracks zu meinem Zelt und damit beginnen, Dornwoods Vorschlag in die Tat umzusetzen, als ich durch gut drei Dutzend Soldaten abgelenkt wurde, die das Zelt des Gefreiten Langers belagerten.
Langers, der Leser wird sich erinnern, war ein Passagier des Zuges mit dem Karibugeweih: ein Kolporteur, wie er sich gerne nannte, der religiöse Traktate über delikate Dinge an einsame Männer verkaufte, die ihr Vergnügen an den Illustrationen hatten — aus Gründen, die sich nicht unbedingt mit Pietät und Glauben vertrugen. Langers war durch die Rekrutierung aus der Bahn geworfen worden und jetzt nichts weiter als ein weiterer Infanterist. Doch seine unternehmerischen Instinkte hatten die Verwandlung überlebt und es schien, als sei er wieder im Geschäft — irgendeinem —, nach der Meute zu urteilen, die ihn umringte.
Ich fragte einen Soldaten, was los sei.
»Langers war zum Begraben eingeteilt«, sagte der Mann.
»Würde mich wundern, dass er deshalb so beliebt ist.«
»Er hat den toten Deutschen alles Mögliche abgenommen. Jacken und Helme, Abzeichen und Brieftaschen, Koppelschlösser und Lederhalfter …«
Feindliche Ausrüstungsgegenstände mussten dem Quartiermeister ausgehändigt werden, aber alles andere war vermutlich »vogelfrei« und gehörte dem, der es fand. Menschen sind häufig in der Versuchung, ein, zwei Andenken an ihre getöteten Feinde mitzunehmen — vorausgesetzt, ihr Magen macht diese Art von Schatzsuche mit. Doch Langers war weit über diesen verzeihlichen Impuls hinausgegangen. Er hatte den ehemaligen Brückenkopf der Deutschen mit einem mittleren Korb abgeerntet und alle Früchte fein säuberlich ausgestellt. Dutzende von Trophäen lagen in Reih und Glied auf einer Decke vor seinem Zelt; auf einem Schild stand: EVERY-THING $ 1.
Ich fand den Preis komisch. Ein paar Sachen waren offensichtlich mehr wert, wie zum Beispiel die Sammlungen deutscher Münzen, für die man in Montreal gutes Geld bekommen würde. Aber die meisten Sachen waren viel weniger wert. Fast alle Jacken hatten Schusslöcher; und das Glasauge, so lebensecht es war, hatte einen hässlichen Sprung. Der Soldat hinter mir klärte mich auf.
»Das heißt nicht, dass du einen Dollar bezahlst und nehmen kannst, was du willst. Überall liegt eine Nummer daneben — siehst du die Papierschnipsel? —, und Langers hat einen Topf mit genau solchen Schnipseln. Wenn du deinen Dollar zahlst, sagt er: ›Greif in den Topf‹, und das machst du und ziehst eine Nummer und kannst nachsehen, was du gekauft hast. Wenn du Glück hast, bekommst du vielleicht diese Gürtelschnalle mit der Meerjungfrau. Aber es kann auch so ein dusseliges Lederbeutelchen sein oder ein deutscher Stiefel mit einem amerikanischen Loch.«
»Ist das nicht Glücksspiel?«
»Quatsch«, sagte der Soldat. »Das macht nicht halb so viel Spaß.«
Ich war von klein auf vor Glücksspiel gewarnt worden, von meiner Mutter und vom Dominion Reader for Young Persons , obwohl das einzige Glücksspiel, das ich jemals zu Gesicht bekam, die unter abhängigen Arbeitern verbreitete Variante war, in der mit Würfeln oder Karten um Tabak oder Alkohol gespielt wurde. Diese Spiele endeten meist in Faustkämpfen und hatten mich nie gereizt. Doch dem Losverfahren des Gefreiten Langers war nicht so leicht zu widerstehen. Ich war neugierig auf die Deutschen und fand, ich sollte vielleicht das eine oder andere über die Leute erfahren, auf die ich geschossen und die ich manchmal auch getötet hatte. Etwas von ihnen zu besitzen schien mir ein fast religiöses Bedürfnis zu sein (man verzeihe mir diese kleine Ketzerei), ganz ähnlich dem Brauch primitiver Völker, das Herz ihrer Feinde zu verzehren — eine eher christliche Inszenierung desselben Motivs.
Also drängte ich mich nach vorne, nahm einen Comstock-Dollar heraus und legte ihn hin, damit ich in den Glückstopf des Gefreiten Langers greifen durfte. Ich zog die Nummer 32, die einem kleinen Lederranzen gehörte, der ziemlich abgewetzt und enttäuschend schmal war. Der Ranzen gehörte augenscheinlich nicht zu den wertvollen Dingen, und Langers lächelte zufrieden, als er den Dollar wegsteckte und mir den Ranzen aushändigte. Aber meine Enttäuschung verflog schnell; denn der Ranzen enthielt einen Brief, den vermutlich ein deutscher Soldat kurz vor seinem Tod verfasst hatte. Noch einmal: Einen Geldwert besaß der Ranzen nicht, und Langers hatte allen Grund zu frohlocken; doch als Andenken an das Leben eines Menschen und als Blick durchs Schlüsselloch der mitteleuropäischen Infanterie fand ich den Brief unheimlich interessant.
Ich faltete die beiden handgeschriebenen Seiten auseinander und versuchte mir den Deutschen vorzustellen, wie er dasaß und den Brief schrieb, ohne zu ahnen, dass die Zeilen erst einem leichenfleddernden Kolporteur in die Hände fallen würden, um dann in den Besitz eines Pächterjungen aus Williams Ford zu gelangen. In meinem Zelt starrte ich nahezu eine Stunde lang auf die beiden Seiten und philosophierte über Schicksal, Tod und andere bedeutungsschwere Dinge.
Lymon Pugh schaute vorbei und scheuchte mich aus meiner Grübelei. Ich zeigte ihm den Brief.
Er rätselte einen Moment lang, ehe er sagte: »Da muss ich wohl noch viel Unterricht nehmen, was?«
»Ist doch klar, dass du das nicht lesen kannst. Das ist Deutsch.«
»Deutsch? Sie reden das Geraspel nicht bloß, sie schreiben es auch auf?«
Читать дальше