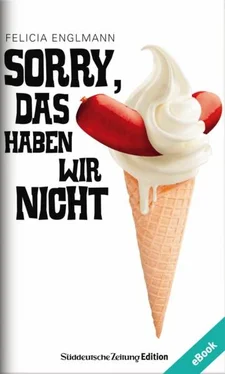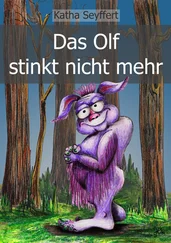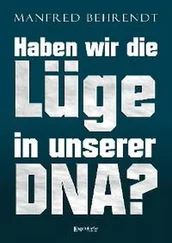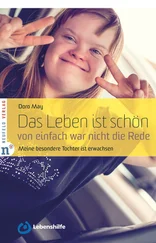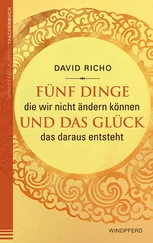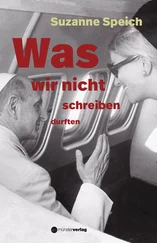Unversehens stand ich dann vor Auerbachs Keller, in einem der schnieken Schneider-Bauten gelegen. Jetzt wollte ich’s wirklich wissen. War Leipzig top oder flop? Provinz oder Prachtstadt? Auerbachs Keller, in seiner Version als große, säulengestützte Bierhalle, war brummvoll, auf großen Tabletts schleppten die Kellner Spezialitäten herum. Da saßen auch weder saufende Studenten noch ein Dichter mit teuflischer Begleitung, sondern ältere Leipziger in ordentlicher Winterkleidung, pro Kopf mindestens drei Tüten mit Einkäufen auf Stühlen und unter Tischen geparkt.
Ich wollte es wirklich, wirklich wissen. Ich bestellte einen Teller Leipziger Allerlei und ein Glas Weißwein. Der Kellner zuckte mit keiner Wimper. Irgendwie hatte ich geahnt, dass das Allerlei genauso wenig mit dem mir bekannten Dosengemüse zu tun haben würde wie Leipzig mit meinen jahrzehntelang gepflegten Vorurteilen gegen Ostdeutschland. Was dann kam, überraschte mich aber noch mehr als das Erscheinungsbild Leipzigs und die erdige Lebenseinstellung seiner Bewohner. Serviert wurde ein duftender Teller mit feinsten, knackigen Gemüsen in weißer Sauce. Ja, auch mit Erbsen und Möhrchen und Spargel, aber auch mit Blumenkohl, Pilzen, zarten Rosenkohlröschen, Kartöffelchen und einem kleinen Flusskrebsschwanz. Wenn sich nicht sogar noch etwas Kalbfleisch in der Sauce versteckt hatte, ich weiß es nicht mehr, ich war zu begeistert. Übermütig versuchte ich, mit dem Zeigefinger von unten ein Loch in die Tischplatte zu bohren, aber es floss dann doch kein Wein heraus, kopfschüttelnd nahm der Kellner das leere Glas mit und servierte ein volles. Wenn jemand in Auerbachs Keller den Witz mit dem Wein reißt, finden das die Leipziger ungefähr so spannend, wie irgendeinen Soul-Sänger, der im Palasthotel wohnt, oder einen Star-Designer, der ihnen billigen Ramsch andrehen will.
Mehrere Versuche, zu Hause dieses Leipziger Allerlei nachzukochen, sind seither gescheitert. Es gibt einfach weiterhin den Mecklenburger Gemüseeintopf meiner Großmutter. Zumeist hapert es schon an den Zutaten, denn entweder es gibt auf dem Münchner Viktualienmarkt frischen Spargel oder es gibt frische Morcheln, aber nicht beides gleichzeitig, zumindest nicht dann, wenn ich Allerlei kochen möchte. Ganz zu schweigen von dem Problem, wo man dann noch einen frischen Flusskrebs herkriegen soll, und was der dann, wenn es ihn gibt, kostet. Und dann das Kochen, ach weh, als ob Mephisto einem auf der Schulter säße. Ein riesiger Aufwand ist das Gemüseputzen. Wenn dann irgendetwas auch nur eine Minute zu lang in seinem Saft köchelt, ist der ganze Zauber dahin, der Kohl zerfallen, die Sauce geronnen, das Krebsfleisch steinhart.
Allerlei zu machen ist eine Kunst, die wohl nur innerhalb der Leipziger Stadtgrenzen erlernbar ist. Oder hat es jemand schon mal außerhalb der Stadt auf irgend einer Speisekarte gesehen? Leipziger Allerlei aus der Dose oder dem Gefrierpäckchen aber gibt es bis heute, gelegentlich sogar als Beilage in ganz, ganz schlimmen westdeutschen Provinzwirtshäusern. Wer sowas ernsthaft kauft und serviert, der war noch nie in Leipzig und hat daher weder von Gemüseeintopf noch von der Welt Ahnung. Einerlei was er für Leipziger Allerlei hält, denn in Leipzig existiert es nicht, weil sich die Leipziger keinen Tinneff andrehen lassen. Für die Leipziger darf es immer nur das Beste sein. Ich schäme mich heute, dass wir damals nur die fiese Schokolade und den billigen Kaffee in die DDR geschickt haben. Umso mehr, weil es uns bis heute niemand von der Verwandtschaft je zum Vorwurf gemacht hat.
So schnell läßt sich ein Berner keine Wurst aufbinden
Am Schwellenmätteli rauscht das blaugrüne Wasser der Aare über eine flache Kaskade. Mitten auf der Schwelle steht die Skulptur eines Bären, der aussieht, als würde er darauf warten, dass Lachse die Schwelle hinauf und ihm direkt ins Maul springen. An einem sonnigen Spätnachmittag leuchten die Häuser der Berner Altstadt, erbaut aus grünem Sandstein, mit dem Grün des Flusses und dem Gras in den Gärtchen um die Wette. Gärtchen, die wie asiatische Reisterrassen in den steilen Abhang zwischen der Stadt und dem Wasser gesetzt sind. Als wäre der Anblick der Berner Altstadt von hier unten aus noch nicht entzückend genug, haben die Berner ein Terrassenlokal mitten auf die Schwelle gebaut, auf Stelzen, unter denen der Fluss durchrauscht. Es trägt den gleichen Namen wie der Ort, „Schwellenmätteli“, und ist nicht irgendein Lokal, sondern eine Designerhütte aus Glas und Holz, mit feinen Speisen aus aller Welt, oder einfach einem Amuse-Bouche-Trio, einem Traum aus Schinken-, Artischocken- und Thunfischcreme. Man kann auch nur einen Gin Tonic schlürfen, auf Teakholzmöbeln auf der Terrasse oder auch auf Sofas, die auf der Kiesfläche am Südufer stehen.
In München fließt die Isar ebenfalls mitten durch die Stadt, oft ist sie grün, aber es gibt kein Lokal, dass annähernd so spektakulär ist wie das „Schwellenmätteli“. Der Münchner Publikumsmagnet am Wasser ist vielmehr eine Kiesbank namens Flaucher, südlich des Zentrums, und man muss alles, was man dort verzehren will, selbst hinschleppen. Mangels Alternativen tun dies, gerade im Sommer, sehr viele Münchner. Ignoriert man die blauen Schwaden, die aus Kohlegrill-Hundertschaften aufsteigen, und später die sturzbetrunkenen Jugendlichen, sind die Abende am Flaucher zwar unkomfortabel, aber charmant.
Anfang des neuen Jahrtausends tauchte ein neuer Gast bei den Flaucher-Parties auf: das Berner Würstchen. Es lag nicht auf den Grills der Langweiler mit den Klettsandalen, die beim Bio-Metzger einkaufen. Auch nicht auf denen der türkischen, arabischen oder griechischen Clans, sondern auf jenen der young and trendy Professionals, die in schicken Wohnungen wohnen, aber trotzdem nicht aufs Grillen verzichten möchten. Die für den Einkauf beim Metzger keine Zeit haben, sondern alles für den Abend an der Isar, inklusive Grill und Kohle, spontan am Samstag Nachmittag in einem Supermarkt shoppen, den man bequem mit dem Auto anfahren kann. Berner Würstchen sind in ihrem Kern Wienerwürstchen mit halber Länge des Originals, jedoch gefüllt mit Käse und umwickelt mit Speck, der beim Grillen knusprig wird. Sie schmecken gut und sie waren angesagt, im Jahr 2002, etwas Neues aus der Convenience-Grill-Abteilung, das noch nicht jeder hatte. Rostbratwürste waren gestern, Bruzzler sind für Camper.
Die Berner haben das „Schwellenmätteli“-Restaurant und müssen sich nur ordentlich stylen, wenn sie am Fluss ausgehen wollen. Wahlweise steht ihnen auch das „Alte Tramdepot“ zur Verfügung, etwas weiter oberhalb des Wassers, aber ebenfalls mit sensationellem Blick auf die Altstadt. Oder auch der „Rosengarten“, hoch über der Altstadt, wo sich die Mütter mit Kinderwagen ebenso treffen wie Studenten beim ersten Date, japanische Touristen und ältere Paare im dritten Frühling.
Dort und auch sonst auf den Speisekarten der Berner Altstadt sucht man das Berner Würstchen vergebens. Man vermisst es auch nicht, denn statt dessen gibt es Salate mit feinen Fischen, italienische Scaloppine mit Zitronensauce, asiatisches Knackgemüse aus dem Wok, oder im schnuckeligen Restaurant „Ringgenberg“ am Kornhausplatz Brennessel-Gnocchi in einer Sauce aus Ricotta, Weißwein und frischen Kräutern.
Bern hat ein Wunder vollbracht. Nicht, dass es seine barocke Altstadt vor Zerstörung bewahrt und es damit zum UNESCO-Weltkulturerbe gebracht hat. Das Wunder ist, dass diese Altstadt weder Museum ist wie Venedig, noch langweiliger Touristenschlauch wie Salzburg oder Rothenburg, noch Fressmeile wie Barcelona, sondern ein edles, lebendiges, überraschendes Zentrum. Außer der Grundversorgung mit Fast-Food-Buden und internationalen Filialisten gibt es eben noch die kleine Feinkostmetzgerei. Die „TragArt“ Galerie einer älteren Dame, die Mode als Kunst versteht. Die rummelige Bude, die, warum auch immer, Souvenirs aus Dubai anbietet. Vor der Zytglogge, einem mittelalterlichen Uhrturm mit Spezialeffekten wie einem krähendem Metallhahn und musizierenden Bärchenfiguren, die sich immer zur vollen Stunde in Bewegung setzen, stehen mehr oder weniger große Besuchertrauben und staunen. Es fällt ihnen gar nicht auf, dass direkt neben ihnen ein Stadtbus vorbeisurrt, weil der nämlich dezent mit Strom betrieben wird.
Читать дальше