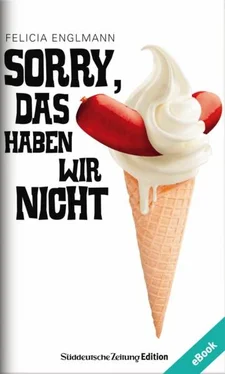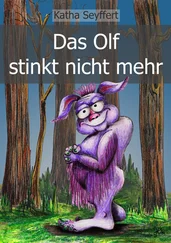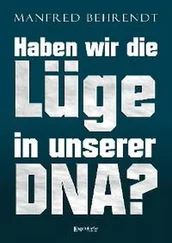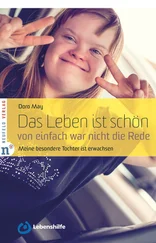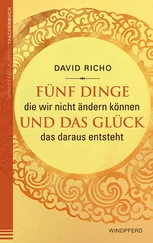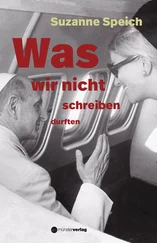Und so war auch die Küche. Lasagne aus dem Supermarkt, Fleischeintopf, Schweinekoteletts mit Minzsauce, Chicken Caserole (in Gemüse zerkochte Hühnchenbeine). Wir machten auch die Bekanntschaft mit Spam, einem quietschrosa Formfleisch aus der Dose, das es gebraten zu Erbsen gab. Danach wurde später der E-Mail-Müll benannt. Der sehr freundliche und langmütige Haushund Alice hat uns aber dankbar von den unverzehrbaren Resten des Spam erlöst. Shepherd’s Pie, graues Hackfleisch mit Kartoffelbrei überbacken, wollte nicht mal Alice fressen. Lauwarmes Cornedbeef mit Kartoffelbrei war auch nicht jedermanns Lieblingsessen. Einmal nahm uns Dorothy mit zum „Old People’s Lunch“ in die Mehrzweckhalle des Dorfes, da gab es aus der Gulaschkanone Steak and Kidney. Dieser Fleisch-Nieren-Eintopf gehört bis heute zum Scheußlichsten, was ich je auf meinem Teller hatte. Nicht nur in Lage und Lebensweise, auch die Küche Byfields entsprach dem England, das heute so gerne in Rosamunde-Pilcher-Filmen schöngezeichnet wird.
Angesichts so vieler Abscheulichkeiten fällt es dem England-Unkundigen leicht, zu glauben, dass auch der fieseste Kuchen, den die Welt kennt, aus England kommen muss und daher Englischer Kuchen heißt. Den Brocken aus der Kastenform mit den hartplastikartigen Citronat-Brocken, den schleimigen Rosinen-Einschlüssen, dem Geschmack geschredderter Zeitung und der Konsistenz des Grindes, der sich unter 20 Jahre alten Teppichfliesen bildet, dieses Monstrum also, das bei uns unter dem Namen Englischer Kuchen angeboten wird, würde keine englische Hausfrau über ihre Schwelle lassen.
Denn was sie beim Hauptgericht vermasseln, machen die Engländer beim Nachtisch und Süßgebäck wett. Apple Crumble, ein Duett aus frischen, säuerlichen Äpfeln mit ZimtButterstreuseln. Hot Cross Buns, flauschiges Frühstücksgebäck aus Hefeteig. Meringue with Cream and Fruit, diese Wolke aus weichem Baiser mit Extras dazu. Trifle, der perfekte Nachtisch aus Schichten von Fruchtgelee, in Sherry getränkten Keksen, Vanillecreme und Sahne. All das belohnte uns Reisende für Spam und Kidney. Schon allein die Aussicht auf Nachtisch, der irgendwo in Dorothys Küche versteckt sein musste, ließ auch den Shepherd’s Pie halb so schlimm erscheinen. „No matter where I serve my guests, I think they like my kitchen best“ hing als gerahmtes Stickbild über Dorothys Herd: „Egal, wo ich meine Gäste bewirte - in meiner Küche gefällt es Ihnen doch am besten.“
Tatsächlich ist England auch außerhalb der Dorfküchen ein Süßgebäck-Paradies. Der Englische Kuchen deutscher Nation ist dagegen nur ein plumpes Imitat aus Backstuben, die normalerweise überreiche Sahnetorten, Streuselkuchen oder vor Gelee triefenden Obstkuchen herstellen. English Tea Cake, ein leichter, dezenter und dennoch feiner Kuchen, ein enger Verwandter unseres Standard-Rührkuchens, kann gelegentlich mit ein paar Rosinen verfeinert sein, aber ebenso gut mit frischen Kirschen. Teacake, und das ist etwas Spannendes an der englischen Sprache, das man erst nach einigen Reisen und viel Süßwarenkonsum versteht, Teacake kann im Grunde alles Süße sein, das man zum Tee isst. Der zarte Rosinenkuchen in der Vitrine des Tea Room ist genauso ein Teacake wie Scones, die eher an unsere Milchbrötchen erinnern, ein Muffin oder ein anderes eher schlichtes Teilchen. Pies und Tarts sind dann schon die Diven unter den Backwaren, gefüllt, verziert oder sonstwie aufgerüscht. Außer den Klassikern Apple Pie, Lemon Meringue Pie, Jam Tart, die in keinem Tea Room fehlen dürfen, hat fast jede Region ihre eigene Spezialität, wie ich in den Folgejahren mit stetig wachsender Begeisterung herausfinden durfte: Bakewell Tarts, kleine Teilchen gefüllt mit grobem Marzipan und mit Fondant überzogen. Dundee Cake, ein saftiges Früchtebrot. Chelsea Buns, besonders zarte, leichte RosinenRohrnudeln. Den Englischen Kuchen sucht man vergebens. Nur selten findet sich in besonders schlechten Tea Rooms Teacake, der ihm ähnelt, denn Zitronat und Orangeat schmecken sogar den meisten Engländern nicht, und total trockenes Zeug erst recht nicht.
Viel könnte man lernen von der Wunderwelt der britischen Süßwaren, aber nicht einmal der Starkoch Jamie Oliver, der den Ruf der britischen Köche und Küche nachhaltig verbessert hat, hat es bisher geschafft, seine Heimat als Kuchenparadies anzupreisen. Stattdessen wandern aus den USA derzeit die Donuts und Cupcakes ein, und sogar die inzwischen allgegenwärtigen Muffins aus Backpulverteig treten als Amerikaner auf, obwohl ihre Wurzeln in England liegen, in Form eines flachen Hefeteigbrötchens, das ebenfalls in die Kategorie Teacake fällt. Dieses heißt nun in Britannien English Muffin, um sich klar von den bunten, aufgeplusterten Rückwanderern abzugrenzen. Ernsthafte Konkurrenz für Pie und Tart sind sie aber nicht.
Kuchen und Süßigkeiten nach England zu tragen, ist ungefähr so sinnvoll wie Schokolade in die Schweiz zu schicken, und wird mit Skepsis, wenn nicht gar mit offener Ablehnung quittiert. Schokoladen-Ostereier, die ich bei meinem zweiten Besuch als Mitbringsel nach Byfield schleppte, blieben ungegessen als Dekoration auf dem Küchentisch liegen. Beim dritten Besuch 1994 war ich mit meiner Freundin Katrin auf dem Weg nach Schottland. Da wir mit dem Auto unterwegs waren, hatten wir ein ganz besonderes Geschenk dabei: Hermann, den Sauerteig. Für Dorothy, die doch Kuchen und Nachspeisen so liebte. Hermann, das war dieser vor sich hin fermentierende Teigbatzen, in den man alle paar Tage neuen Zucker rühren musste und der sich so stark vermehrte, dass man den daraus zu backenden Kuchen kaum aufessen konnte und Teile des Teiges wie in einem Schneeballsystem an Freunde verschenkte. Hermann, der Teig, verbrachte die ganzen 1300 Kilometer von München nach Byfield in einer mit Alufolie verschlossenen Plastikschüssel, eingekeilt hinter dem Fahrersitz meines Fiat Panda. Da wir für die Anfahrt drei Tage brauchten, fütterten wir ihn auf irgendeinem Parkplatz in Belgien sogar mit Zucker. Der Fiat Panda fuhr maximal 120 Stundenkilometer. Katrin und ich hatten viel Zeit uns vorzustellen, wie Hermann von Byfield aus ganz England erobern würde, von kuchenbegeisterten Hausfrauen von Tür zu Tür weitergegeben.
In Byfield war Hermann allerdings nicht willkommen. Mit kaum verborgenem Entsetzen betrachtete Dorothy den graugelben Teig und las den albernen „Hermannbrief“, den wir für sie ins Englische übersetzt hatten. Sie stellte ihn irgendwo in ihre Küche. Am übernächsten Tag fuhren wir weiter und Dorothy erwähnte Hermann mit keinem Wort mehr, nicht als wir bei ihr waren und niemals später. Ich denke fast, dass sie ihn kein einziges Mal gefüttert hat, sondern in dem Moment im Komposthaufen versenkte, da der Fiat Panda aus ihrer Hofeinfahrt fuhr. Es gibt also in England keinen HermannKuchen und auch keinen Englischen Kuchen - Gott sei Dank, denn beide schmecken wirklich niemandem. Nicht den Engländern, und eigentlich auch nicht den Deutschen.
Poeten und Märchenerzähler aus Tausendundeiner Nacht
Steigen Sie in Teheran in ein beliebiges Taxi und wenn Sie klar gemacht haben, wohin es gehen soll und was der Spaß kosten wird, entrollt sich garantiert genau dieser Gesprächsteppich: „Was arbeiten Sie hier, was ist ihr Business in Teheran?“ - „Keines, ich bin im Urlaub hier“ -„Was??? Warum das denn?“ - „Ich möchte die großen Schätze der iranischen Kultur sehen.“ - „Aaaaach, verstehe. Esfahan, Shiraz ...“ - „Ja, und Teheran.“ - „Ja. Ja. Wo wollten Sie gleich nochmal hin?“ - „Niavaran. Das Museum, Sie wissen doch .“ - „Ach, jaja, aber wissen Sie, Shiraz . Wann fahren Sie nach Shiraz?“ - „Ahem, ähm, ich wollte nur noch nach Isfahan.“ - „Ach, aber Sie sollten wirklich nach Shiraz fahren.“ Wenn die Fahrt etwas länger dauert, was angesichts des anarchischen Teheraner Verkehrs immer der Fall sein wird, es sei denn, es ist gerade Freitagsgebetszeit oder drei Uhr morgens, wird der Fahrer Sie dann auch noch fragen, woher Sie kommen, erfreut feststellen, dass der Sohn seines Neffen auch schon einmal in Deutschland war und es ihm dort natürlich sehr gut gefallen hat. Wenn die Fahrt dann noch etwas länger dauert und schon die ersten Gesprächspausen entstehen, wird der Fahrer in den Spiegel blicken, Ihr kopftuchgerahmtes Gesicht betrachten, und dann mit tiefer Verschwörerstimme sagen: „Wissen Sie eigentlich, dass in Shiraz der Wein erfunden wurde? Die berühmten Shiraz-Trauben, kennen Sie die? Wir dürfen hier ja keinen Wein trinken ...“ Jetzt bleiben Ihnen nur zwei Möglichkeiten: Sie können schweigen wie ein Genießer und sanft nicken, mit jener überlegenen Mischung aus Wissen und Bedauern, oder überzeugt ausrufen: „Ach, wirklich? Na sehen Sie, wieder ein Beispiel für die iranische Hochkultur!“
Читать дальше