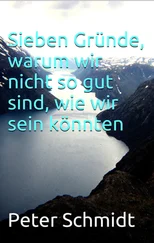Man könnte die Geschichte noch einmal ganz anders erzählen, so ähnlich wie die mit dem kleinen Bären und dem kleinen Tiger, die eine leere Bananenkiste mit der Aufschrift „Panama“ im Fluss finden und beschließen, dass Panama ein Land ist, das von oben bis unten nach Bananen riecht. Sie ziehen los, um es zu suchen, laufen im Kreis und entdecken schließlich ihre alte Heimat neu, ohne es zu merken, beziehen in trauter Eintracht ihre alte, inzwischen leicht ramponierte Hütte, renovieren sie und genießen das Leben. Die Heimat riecht zwar nicht nach Bananen, aber sie ist perfekt für die beiden unterschiedlichen Charaktere. Janosch, der Autor dieser Geschichte, findet: „Jeder lebte schon immer im Paradies, er hat es nur nicht gewusst.“
In der Stunde vor Sonnenuntergang riecht es in Jaffa genauso wie Tel Aviv: Nach Auspuff, nach heißen Snacks aus den Imbissbuden und ein wenig nach Strand und Meer. Ziemlich paradiesisch also, und doch sehr heutig. Und in der Stunde vor Sonnenuntergang ist der Lebenslust-Pegel in beiden Orten gleich hoch.
Auch in der Bäckerei von Said Abouelafia in der Ladenstraße von Jaffa ist Hochbetrieb. Von hier kommen all die Rascheltüten mit den Sesamkringeln, den Fladenbroten, den kompakten Brötchen mit der Knusperrinde. Der Geruch des frischen Brotes weht so intensiv aus der Backstube, dass er die Auto-und Mopedabgase überdeckt. Die Backstube ist nach vorne zur Straße offen, es gibt keine Tür, sondern ein Verkaufstresen über die ganze Breite des Ladens erstreckt sich direkt am Gehsteig entlang. Verkauft wird direkt von den Blechen weg, und nur, was nicht sofort über den Tresen geht, wird in kleinen Vitrinen aufgestapelt. Der Ruf der Bäckerei von Jaffa reicht sogar noch weiter als der Duft des frischen Gebäcks, der immerhin die ganze Straße erfüllt. Jeder, der einmal eine Nacht in den Clubs von Tel Aviv durchgefeiert hat, erzählt „vom Bäcker in Jaffa“. Wer vom Tanzen erschöpft ist, landet unweigerlich am Strand und wandert wie magisch angezogen nach Süden, wo ihn in der Morgendämmerung eben jener Duft nach Brot empfängt. Er wird sich bei Said Abouelafia und seinen Söhnen die erste Mahlzeit des neuen Tages holen, die vielleicht nicht den Kater vertreibt, aber zumindest neue Kraft gibt, um die Bushaltestelle zu finden oder sogar zurück zu wandern, wieder auf die weißen Hochhäuser zu. Ach, der Bäcker in Jaffa ... so seufzen die ehemaligen Austausch-Studenten und Urlauber, die Club-Gänger und auch die Rucksack-Traveller, die am Strand übernachtet haben.
Ein Vater hat seinen Sohn auf die Schultern genommen, damit der sich aussuchen kann, was gekauft wird, Frauen mit Kopftüchern drängeln sich ebenso am Tresen. Seit 1879 geht das schon so, verrät das Schild über der Backstube. Die beleuchteten Glasmosaike mit Kamelen und Beduinen verweisen auf die noch viel ältere Tradition des Arabischen an der östlichen Mittelmeerküste. Es dauert, bis man ganz vorne ist, und der Hunger wird größer, wenn man nur noch eine Glasscheibe von den Spezialitäten entfernt ist. Trotzdem, Zeit für ein Experiment ist immer: „Einen Jaffa-Cake, bitte!“ Der junge Verkäufer hat für Firlefanz keine Zeit. „WAS?“, fragt er scharf, als hätte er nicht verstanden. „Jaffa-Cake!“ - „Ja, hier, alles Cakes, alles Gebäck! Was wollen Sie denn jetzt?!? Süß? Oder mit Käse? Sesam?“
Entweder, er hat den Spruch schon tausendmal gehört, oder die maschinell gefertigten Kekse aus dem Supermarkt liegen seinem Geist so fern, dass er nicht im Traum darauf kommen würde, jemand könnte sie bei ihm bestellen, wo er doch der Herr über all die Fladen und Kringel, die gefüllten Teigtaschen und verführerisch glänzenden Süßwaren ist. Das ist unglaublich erfreulich. „Geht das nicht schneller?“, schimpft ein alter Mann von hinten, der schon einen kleingerollten Schein in der Hand hat. „Dann bitte einmal Samosa mit Pizzafüllung ohne Schinken, zweimal Pita mit Zatar und einmal Sesambrot.“ Zack, ist alles in der Rascheltüte und der knurrige Alte ruft schon seine Bestellung über den Tresen.
Es ist längst dunkel, als der Stau nach Tel Aviv das Auto endlich wieder frei gibt. Da duftet es schon im ganzen Wagen nach frischem Brot, Kräutern und Käse. Israel riecht nicht von oben bis unten nach Orangen, nicht einmal der kleine Ort Jaffa, und Jaffa Cakes gibt es auch nicht. Aber, genau deshalb: Oh, wie schön ist Israel!
Treibstoff für die Motorrad-Fiesta in Andalusien
Jerez de la Frontera ist eine gähnend fade Stadt mitten in Andalusien. Im Sommer ist dort eine riesen Hitze, so dass alles Gras zu gelbem Pulver verdorrt, im Winter ist dort gar nichts, und im Frühjahr ist die große Neuigkeit, dass die Störche angeflogen kommen um ihre Nester zu bauen. In Jerez gucken Fuchs und Hase zu, wenn am MiniFlughafen die Chartermaschinen direkt vor die Terminalhütte fahren, die Türen aufklappen und die Gäste dann einfach über den Platz ins Gebäude tapern. Vor der Tür setzen sie sich in ihre Mietwagen und kommen erst wieder nach Jerez, wenn der Charterflieger sie nach Hause bringen soll. Falls sie dann überhaupt in Jerez Zentrum waren, können sie von jeder Menge Flachbungalows berichten, einer unbedeutenden Kathedrale, einem ebenso unbedeutenden Schloss. Geschwärmt wird von Sevilla, von Cadiz, von Granada, Cordoba und Malaga, alles locker in Auto-Reichweite. Aber Jerez? Kann man getrost vergessen.
Damit das nicht so bleibt, denkt sich Jerez einiges aus: Ein jährliches Flamencofestival gibt es zum Beispiel, ein Pferdefestival und ein Herbstfestival ohne besonderes Thema. Nur einmal im Jahr ist in Jerez wirklich etwas geboten, wenn auf der Rennstrecke Circuito de Jerez, weit außerhalb der Stadt, Moto GP gefahren wird. Früher war sogar die Formel 1 mit einem Rennen dort zu Gast, jetzt sind es noch die Motorräder, die dort ihre Meisterschaftsrunden drehen. Wenn das Wochenende des „Großen Preis von Spanien“ ansteht, rollen Biker zu Hunderttausenden aus Spanien, Frankreich und Portugal herbei, um Teil dieses Spektakels zu sein. Nicht jeder hat überhaupt eine Eintrittskarte für die Vorläufe und Rennen in der 125er, 250er und Moto-GP-Klasse. Am Renntag an die Strecke zu kommen ist ohnehin nicht leicht, denn auch Autofahrer wollen das Rennen sehen. Da ansonsten in Jerez nichts los ist, ist die Polizei jedes Jahr wieder heillos überfordert von dem Ansturm. Manchmal kommen nicht einmal mehr Motorräder durch. Kilometer- und stundenlang staut es sich durch die andalusische Pampa. Wenn man dann mal da ist, an seinem Platz an der Strecke, sieht man aus ordentlicher Distanz sehr bunte, sehr laute Motorräder sehr schnell die Kurven kratzen. Man muss Glück haben, wenn man eine Videoleinwand im Blick hat, auf der Standings und Rennergebnisse angezeigt werden. Besser man hat einen Taschenfernseher dabei oder eine der seltenen Karten für die VIP-Lounges über der Start-und Zielgerade. Da fast keiner etwas davon hat, entwickelt das Rennwochenende seine eigene Dynamik, wird zum Motorradfest anlässlich des großen Rennens. Laute Partymusik spielt auf der Fanmeile vor der Strecke, schon während morgens die 125er ihre Rennrunden drehen, wird dort getanzt und ordentlich Cerveza gepichelt. Auf den Campingplätzen rund um die Strecke liegen palettenweise leere Bierdosen, vor den Zelten sitzen entsprechend rotäugige und bleichgesichtige Zombies, die noch überlegen, warum sie da sind, wegen des Rennens oder wegen der Party.
Auf dem Campingplatz und an der Strecke ist jedoch alles nur Vorglühen für den Abend. Da rockt Jerez und sogar noch der Nachbarort El Puerto de Santa Maria, in dem ansonsten ganzjähriges Schlummern angesagt ist. Tausende strömen auf die Straßen, um entweder ihr eigenes Motorrad vorzuführen oder zumindest den schicken, papageienbunten Lederkombi, oder aber um Motorräder und Menschen in Lederkombis zu bestaunen. Die schmalen Straßen sind voller Fußgänger, aber die Mopeds fahren trotzdem in die Menge, es wird begeistert und respektvoll Platz gemacht. Den meisten Applaus bekommt derjenige, der die Maschine am effektvollsten aufheulen lässt. Als Held gefeiert wird jeder, der einen Burnout wagt, den Reifen so lange durchdrehen lässt, bis er völlig auf die Straße radiert ist und die Menge in einer beißenden Wolke Gummidampf steht. Dafür gibt es großen Jubel und Schulterklopfen. Alle Lokale sind rappelvoll, auf manchen Tischen wird spät in der Nacht getanzt. Viele Wirte haben einen provisorischen Straßenverkauf eingerichtet, an dem es Gambas gibt und Bier aus Plastikbechern. Leergefutterte Gambaspanzer und zerknüllte Becher liegen haufenweise in jeder Ecke. Mancher klettert auf einen Laternenmasten und schüttet aus Jux einen ganzen Becher voll über die tobende Menge. Viele Männer sind da, aber auch Frauen, schöne Frauen. Die sind aber angesichts der geballten Maschinenmacht an diesen Abenden uninteressant. Die bierseligen Kerle schwärmen von der erotischen Ausstrahlung, die so manches Motorradheck für sie entwickelt. Der Motorradcorso reißt nicht ab, kommt aber auch nicht wirklich voran, es wird geschubst und gerempelt, gejubelt und gekreischt, und wer vor lauter Bier und Begeisterung kotzt, versucht bloß keine der teuren Maschinen zu treffen.
Читать дальше