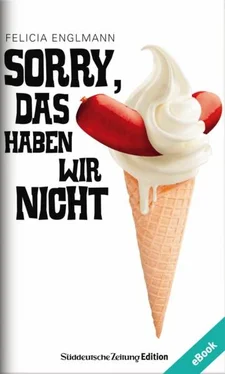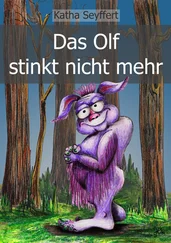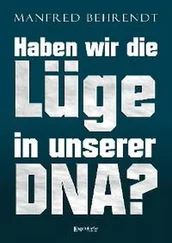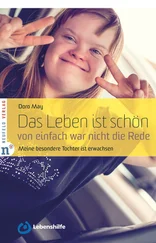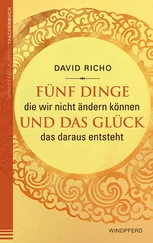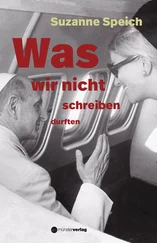Schon so mancher Italiener wird, ohne zu wissen, was er tut, vom Rhein einen Souvenir-Römer mit zurück nach Rom gebracht haben, um ihn zu den anderen Schätzen aus aller Welt in den Schrank zu stellen. Aber kein Italiener, der etwas auf sich hält, wird ernsthaft aus einem Römer trinken. In einem Lokal nicht, weil die germanischen Pokale dort nichts verloren haben, und zu Hause nicht, weil man weder Souvenirs noch andere Geliebte im Alltag verschleißen und damit unbrauchbar machen sollte. Im Gegenteil, sie werden sie zur ewigen Anbetung bewahren, den Römer aus der Rüdesheimer Drosselgasse in der Vitrine und die Geliebte im Herzen, wo sie einen Platz neben der Mama bekommt wie der Römer neben der leuchtenden Madonna aus Fatima. Ein kleiner Moment macht sie alle zur lebenslangen Liebe, und in den Herzen der Italiener ist Platz für viele Geliebte. Das ist der Grund, warum die Italiener so oft zu wildfremden Frauen „Ciao Bella“ sagen. Für sie ist der flüchtige Moment so kostbar wie die Ewigkeit, jede Dame wunderschön, und kein Krümelchen Amore jemals verschenkt ...
So etwas denkt man, wenn man bei Sonnenuntergang auf der Piazza Navona sitzt, den teuersten Prosecco der Stadt bestellt hat und eine nachts leuchtende Padre-Pio-Statuette in der Handtasche trägt. Einfach nur Tourist sein, seinem eigenen Klischee entsprechen, dabei den Moment genießen - auch das ist eine Kunst. Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt.
Spukgeschichten aus dem untergegangenen Ostpreußen
Die Insel im Fluss bietet Platz für jedermann. Auf den Bänken an der zentralen Promenade sitzen Mädchen in pinkfarbenen Miniröcken und zeigen, was sie schon haben. Gegenüber hocken die Jungs in zu weiten Jeans und zeigen, dass sie schon richtig gut rauchen, breitbeinig sitzen und eine Bierflasche halten können. Wenn einer sich Mut angeraucht hat, überquert er den Pflasterweg, schlendert dabei bemüht lässig um die quadratischen Raseninseln herum, die Mädchen fangen schon an zu kichern, und bietet ihnen dann eine Zigarette an.
Einige Bänke weiter sitzt ein Mittzwanziger und liest Zeitung. Ihm gegenüber ein Paar, das sich schon gefunden hat. Der kleine schwarze Hund des Parkwärters saust über diese Promenade und kontrolliert, ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Vorbei an den alten Damen mit den großgeblümten, unterm Kinn geknoteten Kopftüchern, vorbei auch an den drei kräftigen Männern mit den kahl rasierten Köpfen und den verquollenen Augen, von denen jeder eine fast leere Wodkaflasche festhält. Vorbei an den deutschen Rentnern in ihren beigebraunen Funktionshosen, die mitten in einer der Raseninseln stehen, einer fotografiert und zwei lesen im Reiseführer, hinein in den eigentlichen Park, hindurch zwischen den scheinbar wahllos aufgestellten Skulpturen. Zurück durchs Gebüsch auf den geteerten Platz, wo ein paar kleine Mädchen Tretroller fahren. Wirklich niemand, der auf der Insel im Fluss nicht sein Plätzchen fände. Obwohl sie mitten im Zentrum der Stadt liegt und der Verkehr in endloser Folge über die weiß lackierte Stahlbrücke am Ende der Promenade zieht, ist der Lärm nur ein Summen in der Luft. Idyllisch ist diese Insel, und doch ist sie ein Ort des Spukes. Zentralinsel heißt sie, oder Kant-Insel, aber 600 Jahre lang hieß sie Kneiphof, und war kein Park, sondern das Zentrum einer Metropole, der Ort, an dem die Kaufmannshäuser dicht an dicht standen, die Suppenkessel dampften, die Waren durch die Gassen gekarrt wurden und die Damen in teuren Roben flanierten. Als die Insel Kneiphof hieß, trug die Stadt um sie herum den Namen Königsberg. Von ihr ist nichts übrig als Geister und Erinnerungen.
Kaliningrad heißt die neue Stadt an der Ostsee, in deren Mitte eine grüne Insel mit einer Promenade liegt. 1946 benannt nach dem Politiker Michail Iwanowitsch Kalinin, einem linientreuen Kommunisten und Stalin-Diener. Mit Königsberg hat Kaliningrad wenig mehr gemeinsam als den Boden, auf dem die beiden Städte stehen, und den Fluss Pregel. Im Grunde wurde Königsberg nicht einmal umbenannt, sondern es wuchs in ihren zerbombten und ausgebrannten Ruinen Kaliningrad als neue Stadt, mit einer komplett neu zugezogenen Bevölkerung aus Russland, Weißrussland, der Ukraine und Kasachstan, oder, wie es damals hieß, aus der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Kaliningrad hat sein Zentrum bewusst nicht auf der Insel im Fluss gewählt, sondern einen guten Kilometer weiter nördlich, wo der Spuk nicht mehr ganz so erschreckend ist.
Bis in die 60 er Jahre war Königsberg wie ein kettenrasselnder Geist, nicht zu übersehen und irgendwie lästig, in Gestalt des zerbombten und ausgebrannten Domes auf der Pregelinsel, dem skelettartig heruntergekommenen alten Stadtschloss. Als Oberapparatschik Leonid Breschnew zum Chef aller Russen wurde, war es eine seiner ersten Amtshandlungen, neben allerlei anderen Geistern auch den Königsbergs auszutreiben. So wurden die Ruinen trotz Streits und Protests gesprengt. Preußens Gloria - weg damit und zugeteert.
Sozialistisches Wohnen im ehemaligen Zentrum Ostpreußens - njet. Kneiphof sowie sein nördliches und südliches Ufer sind Parks und fast hübsch, gäbe es nicht tiefe Löcher und herausragende rostige Metallstücke im Gehsteig, die jeden zwingen, die Augen am Boden zu halten. Zu sehen gäbe es als Blickfang von nahezu allen Winkeln aus das Dom Sowjetos, das Haus der Räte, ein Hochhaus, das mit seiner Macht aus Stahlbeton darüber wacht, dass sich die alten Geister in seiner Umgebung auch ja nicht mehr regen. Allein, es ist selbst ein Spukhaus, seit 1970 steht es leer, stiert mit blinden Augen über eine kahl geschlagene Umgebung. Im Inneren stöhnen und knarzen die Untoten der Sowjetunion, klagen über den vergeblichen Versuch, aus Kaliningrad etwas Großartiges zu machen. Allein, es hört sie niemand, da der umgebende Zentralplatz mittlerweile mit einem Zaum abgesperrt ist.
Die Deutschen sind jedenfalls ausgetrieben und mit ihnen alles Deutsche, inklusive der Schrift, denn alles wird ausschließlich kyrillisch angeschrieben, auch über dem Portal der einstigen Kant-Universität, wo jetzt „Universitetska“ steht. Kyrillisch, natürlich. In Kaliningrad kocht kein deutsches Restaurant mehr auf, kein deutsches Buchgeschäft verkauft Kant im Original, kein Krämer hat hinter seiner Theke selbst importierte Pfanni-Knödel und Schwartau-Marmeladen stehen. In den Tiefkühltruhen der Supermärkte liegen Pelmeni, in verschiedenen Großpackungsgrößen oder sogar offen zum selbst Abfüllen, in den Abteilungen mit den Dosengerichten stehen Borschtsch und Soljanka. Im Knabberregal gibt es baltischen Trockenfisch. Wenn schon exotisch, dann essen die Kaliningrader Russen gerne beim Asiaten oder beim Litauer, „Brikas“ heißt einer dieser Imbisse. Der serviert Zeppelinai, schiffchenförmige, fleischgeladene Geschosse aus Kartoffelteig.
Ein Hauch Sowjetunion weht noch durch die verkehrsgünstigen Hauptstraßen, die sich eitel Prospekt nennen, verwirbelt sich an den gelben Kvass-Tankwägelchen, vor denen die bekopftuchten Verkäuferinnen kauern, rüttelt an den rostigen Straßenbahnwaggons. Im Lebensmittelmarkt „Central Rynok“ heult der Geist nur leise, denn die Berge von Äpfeln, die Körbe voller Kirschen, Trauben, Aprikosen, Dill und Erdbeeren, die glänzenden Kohlköpfe und Fleischtomaten, die Honiggläser, die zu Pyramiden aufgestapelten Würste, all das in seiner Üppigkeit ist so gar nicht sowjetisch. Nur dann und wann lugt der alte Geist hinter den Papierhäubchen der Verkäuferinnen hervor, wenn sie mit der bloßen Hand und missmutiger Miene in das Frischkäsefässchen fahren und die Käsekrümel in ein Plastiktütchen stopfen.
Doch nicht etwa aus der Oblast Kaliningrad, jener tapferen, immer noch russischen Exklave an der Ostsee, stammt die Fülle des Marktes, sondern aus Polen, Litauen und Weißrussland sind die Leckereien herangekarrt. Das behaupten zumindest die, die der alten UDSSR hinterhertrauern, da es für sie ein Früher bedeutet, in dem wirklich alles besser war. Die Felder um Kaliningrad liegen brach, seit Glasnost und Perestroika als Sturm über den Osten wehten. Noch stehen die Betonhallen der Kolchosen, aber ihre Fenster sind ebenso blind wie die des Dom Sowjetos, auf den Dächern nisten Störche. Als großes Grasmeer wogen gelbe und grüne Halme über das Land, als Schaumkronen schweben darüber lila Lupinen, von Horizont zu Horizont. In den Dörfern hocken die Männer mit Flaschen in der Hand vor windschiefen Häusern und stieren auf den Boden. Die Höfe der ehemaligen deutschen Bauern stehen als Ruinen zwischen den Hütten, weil hier nicht einmal ein Bulldozer vorbei gekommen ist. Das Aussehen der bewohnten und der vor 60 Jahren verlassenen Katen hat sich erschreckend angenähert. Für den größten Teil des Landes ist seit der Wende kein Aufschwung in Sicht, sondern ein zweiter Niedergang.
Читать дальше