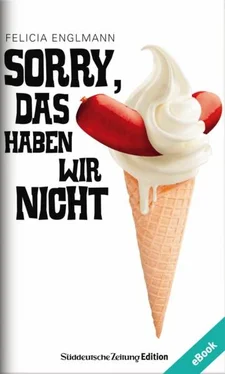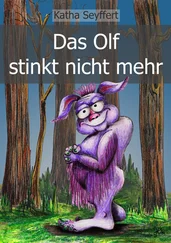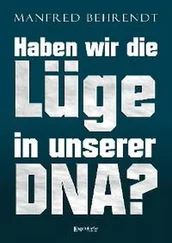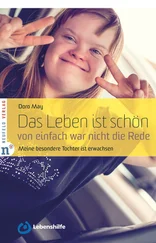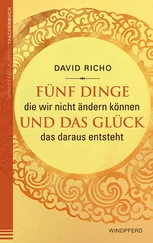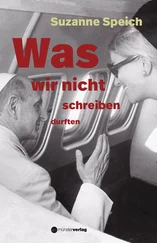Ganz weit vorne steht dafür aber Cadbury, und das nicht wegen der Schokolade. Cadburyworld, der Themenpark der britischen Zuckerbäcker, befindet sich in der Nähe von Birmingham und gar nicht weit von Leamington Spa, aber Katrin befürchtet, dass der Einfluss des „-ham“ dort noch spürbar sein könnte, weshalb wir noch nie zusammen in Cadburyworld waren. Die Dörfer South und North Cadbury dagegen sind in der südlichen Grafschaft Somerset versteckt. Sie sind durch eine Schnellstraße getrennt, sodass ich bis heute nicht weiß, ob es im nördlichen Dorf einen Tante-Emma-Laden gegeben hätte, im südlichen Dorf jedenfalls gibt es ein paar Bauernhäuser, eine Kneipe und einen Parkplatz, auf dem ein ziemlich zorniges Schild die Besucher warnt, hier keinen Müll liegen zu lassen. Und es gibt dort Cadbury Castle, vom dem man meinen könnte, es bestehe aus Milchschokolade, denn das sollte sich die größte Süßwarenfabrik des Landes als Prestigeobjekt schon leisten können.
Die Milchschokolade in der traditionellen violetten Verpackung naschen Engländer schon seit 1905, und es gibt keinen Kiosk, keine Tankstelle und keinen Süßwarenautomaten im Königreich, in dem man nicht sie oder ihre Nichten, die zahlreichen Riegel, finden kann. Wenn jemand in Großbritannien in seinem Laden nur eine einzige Industrie-Süßigkeit verkaufen dürfte, es wäre Cadbury-Schokolade. Das Dorf Cadbury könnte also so sein wie das Innere von Willy Wonkas wunderbarer Schokoladenfabrik: knallbunt und voller Verlockungen, aber solche Wunderlandträume sind amerikanisch und haben im nüchternen Großbritannien, dem Mutterland des Understatement, keinen Platz. Weniges wird dort mehr verachtet, als wenn Profanes mit übertriebenem Lärm und in grellen Farben inszeniert wird. In South Cadbury soll ja nicht einmal das Einwickelpapier einer mitgebrachten Schokolade herumfliegen, das gehört in den Mülleimer und sonst nirgends hin. So bedrohlich wie das Schild auf dem Parkplatz wirkt, nascht man nur heimlich im Auto und versteckt das Papier dann schamhaft im Seitenfach der Fahrertür.
Wie so oft hat das Dörfchen rein gar nichts mit dem weltberühmten Lebensmittel zu tun, das seinen Namen trägt: Cadbury-Schokolade heißt korrekt Cadbury’s. Wer richtig gut Englisch kann, erkennt daran das Genitiv-S, das im Englischen weit öfter für Personen als für Städte verwendet wird. So ist es denn auch; die Süßwaren tragen den Namen ihres Erfinders John Cadbury, eines Quäkers, der 1824 in Birminghams Bull Street einen Lebensmittelladen eröffnete und dort auch bald Trinkschokolade anbot. Jene Bull Street im übrigen, in die in den 60er Jahren ein Einkaufszentrum hingeklatscht wurde, das dann ziemlich herunterkam und 2003 in aller Pracht neu errichtet wurde.
Aber zum Einkaufen und Schlecken bin ich nicht nach Cadbury gefahren, sondern wegen des Schlosses. Mein Wagen ist der einzige auf dem Parkplatz, dicke graue Wolken segeln vor dem strammen Wind über die Ebene, ich muss die Kapuze eng um den Kopf binden. Kein Mensch aus dem Dorf geht bei dem ins Gesicht pieksenden, eisigen Regen vor die Tür. Gutes englisches Wetter. Klebrige Lehmbatzen liegen auf der Straße, ein Busch beugt sich so tief über den Wegweiser, dass man ihn kaum sehen kann, aber den Burgberg kann man nicht verpassen, ich habe ihn schon vom Parkplatz aus gesehen. Ich wandere an den Cottages vorbei in einen Hohlweg. Obwohl das Wetter tobt, ist es im Hohlweg so still, dass ich meine Schritte im Laub vom Vorjahr rascheln höre. Ich durchwandere das Tor des äußersten Befestigungsrings, der Anstieg wird steiler, der nächste Durchgang, kein Wächter stellt sich mir entgegen. Auf das letzte Tor gehe ich besonders langsam zu, um jeden Moment aufzusaugen, in meinem Inneren spielt die Musik alter Zeiten, dann trete ich durch das Portal in den Schlosshof. Es ist ein großes, grasbewachsenes Plateau, über das der Wind pfeift. Von Cadbury Castle steht kein Stein mehr. Es ist kein Schloss, sondern die Erinnerung an das Schloss der Schlösser, gefangen auf einem einsamen Hügel mit holpriger Oberfläche, umgeben von einem Ring aus baumbestandenen und überwachsenen Wällen, die einmal die Befestigung bildeten. Eigentlich ist Cadbury Castle nur ein komischer Hubbel in der Ebene, an dessen Fuß sich ein Dörfchen duckt. Aber die Erinnerung ist stärker als jedes Gebäude, das dort stehen könnte, denn als noch Reiter durch das Tor preschten, Soldaten die Holzpalisaden auf den Wällen bewachten und oben auf dem Gipfel die tapfersten Krieger ihrer Zeit zusammen kamen, war Cadbury Castle die berühmteste Burg, die es je gegeben hat: Camelot. Das Schloss des König Artus.
Die Zeit mag die hölzernen Gebäude zernagt haben und die Wälle geschleift, die besondere Kraft des Ortes hat sie nicht stören können. Bei Regen und Sturm über den Hügel von Camelot zu laufen ist einmalig, denn die schiere Größe der untergegangenen Anlage lässt ihre Erhabenheit ahnen, der Blick reicht auch bei tieffliegenden Wolken weit ins Land. Ob die Spuren der riesigen, seit der Eisenzeit befestigte, immer wieder verlassenen und schließlich um das Jahr 1020 endgültig aufgegebenen Burg, die Archäologen hier gefunden haben, wirklich die von Camelot sind, ist wie an allen sagenhaften Orten nicht geklärt. Aber schon im Mittelalter wollte man gerne glauben, dass Artus einer der ganz Großen war und seine Ritter die wahre Liebe erfunden haben. Wer daran glaubte, für den war die Welt ein besserer Ort, weil es dort zumindest in der Erinnerung echte Kerle gab, verzehrende Romanzen und wirklich wichtige Aufgaben, denen man sich mit Haut und Haar verschreiben konnte, statt den eigenen Lebensweg im faden Alltag verblassen zu sehen. Wer glaubt, dass in Cadbury Camelot stand, für den ist der grasige Hügel der eine Ort auf dem Planeten, an dem sich die größten Helden aller Zeiten getroffen haben. Und da braucht man keine Schokolade und kein schönes Wetter, keinen Audioguide und keine Erklärtafeln, da ist es am besten, wenn man ganz allein über die Sturmhöhe wandert und das Echo der eigenen Sehnsüchte in sich klingen hört. Wenn es an einem Ort eigentlich gar nichts gibt, dann gibt es dort das, was man sich hinwünscht und was man in seinem Inneren dort hinträgt. Cadbury Castle wäre nicht mysteriös und faszinierend, wenn man dort mit hunderten Touristen durch tot renovierte Gemäuer schlurfen könnte. Der Geist von König Artus braucht eine große Fläche, um sich entfalten zu können - und stünde in Nottingham nicht dieses Stadtschloss, sondern einfach nichts, würden die Geister des Sheriffs und seines Feindes Robin dort noch immer herumspuken.
Ob es in der Dorfkneipe von Cadbury, die den schönen Namen „The Camelot“ trägt, vielleicht doch ein Stück Schokolade gegeben hätte, hat mich angesichts der Erhabenheit des Ortes dann auch gar nicht mehr interessiert. Das Internet sagt, es werden dort ordentliche Braten aufgetischt, Würstchen mit Kartoffelbrei, Sandwiches und Ploughman’s Lunch, ein traditioneller britischer Brotzeitteller, hier wahlweise mit Ham, Cheddar oder beidem.
Den Ausflug nach Cheddar spare ich mir. Daher weiß ich bis heute nicht, was es in der „Cheddar Gorge“ gegeben hätte, die dort als Sehenswürdigkeit in meinem Straßenatlas eingezeichnet ist. Ich stelle mir aber vor, dass dort eine Höhle versteckt ist, in der die Tropfsteine aus Käse bestehen. Es könnte aber auch einfach ein Schinken sein.
Die Liebe zum Souvenir -ein manchmal unpassendes Verhältnis
Sogar noch auf dem Dach der Peterskirche gibt es Souvenirs. Rom, diese gierige Stadt, lässt keinen Raum ungenutzt. Wo man dort kein Seelenheil erbeten kann, gibt es für Geld allerlei Waren. Wo man nicht stehen kann, um Schaufenster oder historische Orte zu bestaunen, die man entweder später als Miniatur erwirbt oder worin man wiederum um Seelenheil bittet, wird gefahren, und das auch möglichst so, dass keine Lücke frei bleibt. Es gibt keinen Flecken und kein Bedürfnis, das in Rom nicht ausgenutzt wird. Zeigen die Fenster in den Gebäuden keine Waren, so hängen dort Speisekarten oder sie geben gleich den Blick frei auf die Bar mit Cornetto, Prosecco und Co. Nichts, gar nichts bleibt brach liegen in der ewigen Stadt. Vielleicht konnte sie genau wegen dieser Emsigkeit, diesem übereffizienten Ausnutzen aller Ressourcen, so lange überleben. Weder Vandalen noch Pilger, weder Faschisten noch Massentouristen haben der Stadt wirklich etwas anhaben können, im Gegenteil, sie hat gelernt, ihren Gewinn zu maximieren und dafür den geringstmöglichen Aufwand zu betreiben. Warum regelmäßig Busse auf die wichtigen Linien schicken, wenn es auch unregelmäßig geht und sich die Menschen darin auch stapeln können? Warum den Prosecco kühl stellen, wenn man ihn auch warm verkaufen kann?
Читать дальше