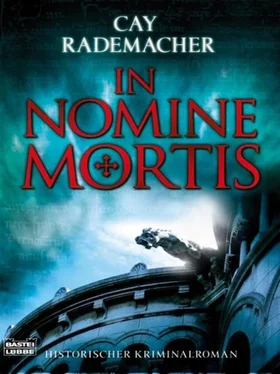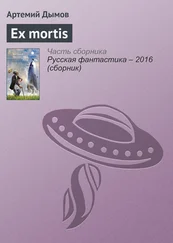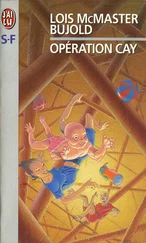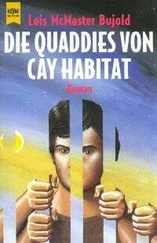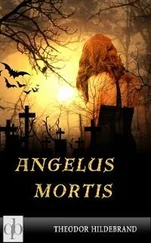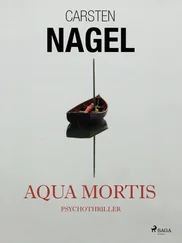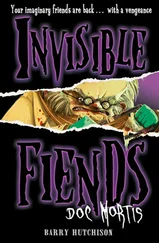Cay Rademacher - In Nomine Mortis
Здесь есть возможность читать онлайн «Cay Rademacher - In Nomine Mortis» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2009, Жанр: Исторический детектив, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:In Nomine Mortis
- Автор:
- Жанр:
- Год:2009
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
In Nomine Mortis: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «In Nomine Mortis»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
In Nomine Mortis — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «In Nomine Mortis», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Meine Oberen sahen das wohl, gaben mir anfangs milde Strafen, doch ließen mich später gewähren. Sind nicht wir Dominikaner in der ganzen Christenheit berühmt für unsere Gelehrsamkeit? Mich dürstete nach Wissen - und der HERR gab mir einen Prior, der meinen Durst gnädig stillte.
Eines Tages hatte er mich in seine Zelle befohlen.
»Bruder Ranulf«, hatte er gesagt, »ich sehe wohl, dass du nach der vollkommenen Erkenntnis strebst. Es gibt tausend Wege zu GOTT, doch für dich kann es nur einen geben: den, der über Paris führt.« Und so hatte er mich, kaum dass ich meinen Magister in den Sieben Freien Künsten erworben hatte, zum Studium der Theologie entsandt an den Ort, der allein der Lehre der höchsten Wissenschaft von allen würdig war: Paris, die größte Stadt der Christenheit. Ich weiß wohl, dass unsere gelehrtesten Kartografen Jerusalem für den Mittelpunkt der Weltenscheibe ausgeben. Doch für mich, der HERR möge mir meine Vermessenheit vergeben, lag das Zentrum der Welt an der Seine. Dort erhob sich die berühmteste Universität des Abendlandes. Nirgendwo wurde das Wort GOTTES so intensiv, so inbrünstig, so voller Eifer, so scharfsinnig studiert wie hier. Wer sich der Theologie hingeben wollte, so wie ich danach brannte, es zu tun, für den gab es keinen gesegneteren Ort in der Welt. Sobald mein Prior mir eröffnet hatte, dass ich nach Paris gehen durfte, sprach ich bei Bruder Richard vor. Ihn hatte es - niemand wusste, warum - einst von Dijon an den Rhein verschlagen, wo er die Gelübde abgelegt hatte, nachdem ihm die Muttergottes im Traum erschienen war. Mit ihm übte ich mich in der Sprache der Franzosen. Selbstverständlich wusste ich, dass die Gelehrten auch in Paris nur Latein sprachen, wie es sich geziemt. Doch wollte ich, der ich mich heimlich fürchtete vor jener Welt jenseits der Klostermauern, nicht gänzlich hilflos sein auf meinem Weg durch das französische Land. Und ich wusste, dass wir, die Dominikaner, auch dem Wort der Predigt verpflichtet sind, auf dass die Gelehrsamkeit - wohldosiert und abgewogen, selbstverständlich — auch unter das Volk käme. Wie aber hätte ich auf Latein oder Deutsch zu den Bürgern von Paris predigen können?
Als dann an einem Tag im April die entscheidende Stunde gekommen war und ich nach der Prim mein kleines Bündel packte und mich von allen Brüdern und vom Prior verabschiedete, musste ich mich stumm zur Ordnung rufen, um nicht in ungebührlichen Jubel auszubrechen. Wer hätte weniger geeignet sein können für eine so lange, so gefährliche Reise als ich? Ich war fast zwanzig Jahre alt, war groß und dürr, meine blonden Haare woben einen wirren Kranz um meine Tonsur, meine Haut war hell, meine Hände lang und fein und unvernarbt, meine Fußsohlen weich, da ich noch nie einen langen Weg gegangen war. Doch meine Augen waren klar und mein Herz weitete sich vor Glück und Sehnsucht nach Paris.
Bruder Anselm begleitete mich, ein schweigsamer Mönch unbestimmbaren Alters. Er hatte den beschwerlichen Weg nach Paris schon mehrmals auf sich genommen, um rare Manuskripte oder wichtige Botschaften von unserem Kloster an das unserer Mitbrüder in Paris zu überbringen. Diesmal führte er, in drei Lagen feines Leder eingeschlagen und versteckt in einem Sack aus grobem Leinen, auf dass sie nicht die Aufmerksamkeit von Vaganten auf sich ziehen möge, eine Abschrift des Kommentars zu den Sentenzen des Petrus Lombardus von Albertus Magnus bei sich. Unsere Brüder in Paris hatten ihr Exemplar dem Herzog von Orleans ausgeliehen — nicht ganz freiwillig, wie ich vermutete — und bis zu jenem Tage nicht zurückerhalten. Also hatten sie uns um eine neue Abschrift gebeten. Der Prior hatte seine besten Schreiber an diesen ehrenvollen Auftrag gesetzt und diese hatten binnen weniger Wochen im Skriptorium das Wunder vollbracht, den Kommentar des Albertus Magnus so genau zu kopieren, dass man die Abschrift vom Original nur am Pergament unterscheiden konnte, das neuer war, heller und noch ohne Stockflecken. Ich war begierig darauf, unterwegs von Bruder Anselm mehr über die legendäre Stadt Paris zu erfahren. Zweihunderttausend Menschen, so hörte ich sagen, lebten in ihren Mauern — eine Zahl so unglaublich, dass mir schien, nicht einmal die Heuschrecken, mit denen der HERR das Land des Pharaos plagte, wären so groß an Zahl gewesen wie die Bürger von Paris.
Doch Bruder Anselm wich all meinen Fragen aus, murmelte Unverständliches, sprach einsilbig, gab unverbindliche Antworten. Nach einigen Tagen wurde mir klar, dass ich wenig von ihm erfahren würde. Und es dauerte noch etwas länger, bis ich glaubte, den Grund dafür erraten zu können. Bruder Anselm hatte Angst vor Paris. Niemals habe ich herausgefunden, was ihn in Furcht versetzte. Es gelang mir nicht einmal, zu erfahren, ob er nur auf dieser einen Reise verzagt war oder ob ihn jedes Mal die Angst packte, wenn er vom Rhein an die Seine befohlen wurde. Er sprach jedenfalls während der ganzen Reise, außer zu unseren gemeinsamen Gebeten oder wenn es sonst unbedingt notwendig war, kein Wort mit mir. Wir rasteten, wo immer dies möglich war, in einem Kloster unseres Ordens, wo wir stets in Ehren aufgenommen wurden. Mehr als eine Nacht verbrachten wir jedoch unter einem Baum oder in der Scheune eines barmherzigen Bauern, wo uns Flöhe und Wanzen plagten und Ratten raschelten, wo uns jedoch wenigstens der Regen nicht quälen konnte. In den ersten Tagen schmerzten mir Füße, Waden und Oberschenkel, doch langsam gewöhnte ich mich an das Wandern. Mein Schritt wurde fester, meine Haut verdunkelte sich. Dann juckten mich auch die Bisse der Flöhe kaum noch. Schließlich, der HERR möge mir verzeihen, genoss ich es gar, der Enge der Klostermauern entkommen zu sein; ich saugte die Welt in mich hinein. Meine Reise fiel in eine äußerst unruhige Zeit. Düsternis und Unfrieden hatten sich über die Christenheit gelegt. Seit einem Menschenalter schon war Rom verwaist. Papst Clemens VI. residierte, wie seine Vorgänger, in Avignon und die Gerüchte von unaussprechlichen Sünden, begangen hinter den finsteren Mauern seines Palastes, waren selbst bis zu uns ins Kölner Kloster gedrungen. Hinzu kam, dass in den vergangenen elf Jahren ganz Frankreich zum Schlachtfeld geworden war — wohl zum Zeichen SEINES Zornes, denn ER ist betrübt, dass der Stellvertreter Christi nicht länger dort residiert, wo es ihm geziemt. Der König von Frankreich, Philipp VI., und seine Gemahlin, die im Volk verhasst war und nur die »böse, lahme Königin Johanna« geschimpft wurde, mussten sich Eduards III. erwehren — des Königs von England und, wie er und viele Adelige glaubten, auch rechtmäßigen Königs von Frankreich. Anno DOMINI 1337 war Eduard in Flandern gelandet und seine Ritter hatten, angeführt vom schrecklichen Schwarzen Prinzen, die Franzosen das Fürchten gelehrt. Keine zwei Jahre war die Schlacht von Crecy erst her, da die englischen Bogenschützen die hochmütigen französischen Ritter von ihren Pferden schossen. Viertausend Edle blieben auf dem Schlachtfeld zurück und König Philipp konnte gerade noch fliehen, mit fünf Begleitern. Calais hatten die Engländer eingenommen und es war, so munkelten viele, nur noch eine Frage der Zeit, bis sie auch in Paris siegreich einziehen würden. Bruder Anselm und ich zogen manche Tage allein über die verschlammten Straßen. Wir stolperten in den tiefen Rinnen, welche die schweren Ochsenwagen gegraben hatten. Nebel stieg aus Sümpfen und Wäldern auf und mehr als einmal bekreuzigten wir uns, weil wir die umherirrenden Seelen unbegrabener Toter in den Schwaden erblickten.
Wir waren erleichtert, wenn wir einmal auf Händler stießen, die mit ihren Ochsenkarren und Maultieren ein Stück weit des Weges mit uns zogen. Von den Vaganten und Spielleuten, Bettlern und Studenten, den Schaustellern und Bärenführern, die Musik machten und selbst mitten am helllichten Tag nur zu ihrer eigenen Freude höchst sündige Tänze und noch viel Schlimmeres aufführten, hielten wir uns hingegen fern.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «In Nomine Mortis»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «In Nomine Mortis» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «In Nomine Mortis» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.