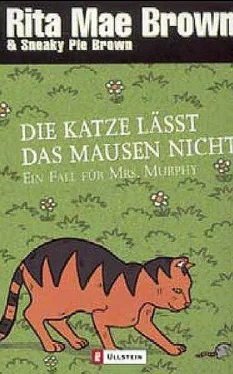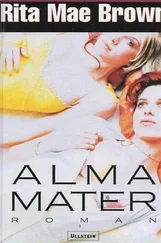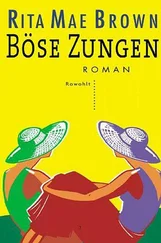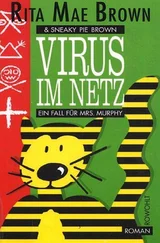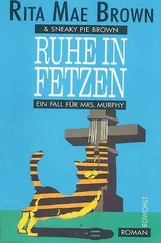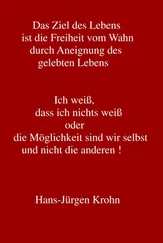»»Du hast Recht, und ich hätte von vornherein daran denken sollen.« Tucker hatte ein schlechtes Gewissen.
»Du hättest es schon noch getan.« Mrs. Murphy sprang auf die Ladefläche des Transporters, just als Diego, durchschnittlich groß und muskulös, hinuntersprang.
»Ach Quatsch«, widersprach Pewter. »»Ein Mensch ist ziemlich genau wie jeder andere. Sie machen einen Riesensums um diese winzig kleinen Unterschiede, aber als Spezies sind sie alle aus demselben Holz geschnitzt.«
»»Mutter ist besser.« Tucker verteidigte Harry, die sie von ganzem Herzen liebte.
»Sie machen sich ins Hemd wegen Pingel- und Popeligkeiten, aber ich finde, sie sind alle sehr verschieden, und das ist ihr Dilemma. Sie sind Herdentiere, und sie brauchen einander, um zu überleben, aber sie können keine Gemeinschaften gründen, die alle einschließen. Das ist ein echtes Kuddelmuddel. Sie erkennen ihre wesentliche Natur nicht, nämlich Teil der Herde zu sein«, erklärte Murphy, »Ich bin nicht Teil einer Herde.« Pewter sprang stolz zu Murphy.
»»Natürlich nicht. Du bist eine Katze«, sagte Murphy.
»Murphy, die Idee mit der Herde hört sich gut an, aber du hast einmal gesagt, Hunde sind Rudeltiere, und ich bin hier - nicht bei anderen Hunden.« Tucker wartete, dass Harry sie in die Fahrerkabine des Transporters setzte.
»»Wir sind dein Rudel.« Mrs. Murphy machte ihren Standpunkt klar. »»Der Umstand, dass wir Katzen plus ein Mensch sind, ist unerheblich.«
»H-m-m.« Tucker sann hierüber nach, während die Menschen miteinander plauderten. »Daran hab ich nie gedacht.«
»»Mrs. Murphy, die Superkatze.« Murphy warf sich in die Brust, dann lachte sie.
»... lustiger«, beendete Diego seinen Satz, der mit »umso« begonnen hatte. Er war einverstanden gewesen, mit zwei Katzen, einem Hund und Harry vorne in dem Transporter mitzufahren. Es schien ihm überhaupt nichts auszumachen.
Harry fuhr hinten herum. Sie parkten in der Nähe der Hauptkreuzung und gingen das letzte Stück zu Fuß. Die Katzen blieben bei geöffneten Fenstern im Transporter. Keine von beiden liebte Gedränge; allerdings ritten sie meistens auf Harrys Schultern, wenn sie mal ins Getümmel mussten. Pewter beschwerte sich über die Marschmusik. Mozart war ihr lieber. Außerdem taten die Trompeten ihren Ohren weh. Mrs. Murphy fand, es war Zeit für ihren Mittagsschlaf.
Beflissen begleitete Tucker Harry und Diego. Als sie zu der Hauptkreuzung kamen, säumten die Menschen die Straße in Viererreihen, eine Masse für Crozet. Mit einssiebenundsiebzig konnte Diego über den größten Teil der Menge hinwegschauen, aber Harry mit einssiebenundsechzig musste sich auf die Zehenspitzen stellen.
Diego schob sich vorsichtig nach vorne, griff hinter sich nach Harrys Hand und zog sie mit sich. Als die Leute sahen, dass es ihre Posthalterin war, mit Tucker auf dem Arm, machten sie gerne Platz.
Kaum hatten sie ihren Standort erreicht, als der Festwagen der Vereinigten Töchter der Konföderation vorüberrollte; Lottie und ihre Unterhose riefen Bemerkungen hervor.
Harry hörte Roger O'Bannon einem Zuschauer zubrüllen:
»Gib mir zwanzig Mäuse, und ich kipp sie alle auf die Straße.«
Das Angebot wurde mit Gelächter quittiert. Lottie ignorierte es natürlich.
Angespornt von dem Gelächter, steckte Roger den Kopf noch weiter aus dem Laster, der von dem Festaufbau kunstvoll verborgen war. »Hey, Lottie, willste den Reifen nicht wegschmeißen?«
»Halt den Mund, Roger.«
»Du solltest lieber nett zu mir sein. Ich steuere dieses Schiff.« Er lachte laut. Sie ignorierte ihn wieder, darum stieß er einen missbilligenden Pfiff aus. »Lottie, oh, Lottie Pearson.«
»Roger, um Himmels willen, pass auf, wo du hinfährst.«
Sie waren dicht an den Straßenrand geraten.
»Wollte euch Mädels bloß was leckeres Kaltes zu trinken besorgen.«
Danny Tucker, Susans Sohn, eilte herbei, zwei Getränke in jeder Hand. Die Damen nahmen sie begierig entgegen.
»Wie konnten die Frauen diese Dinger bloß anhaben?«, murrte eine junge Dame, denn die Montur war schwerer als alles, was sie je getragen hatte.
»Sie haben sie nicht jeden Tag angezogen«, fuhr Lottie sie an, besann sich aber, dass sie sich auf die Menge konzentrieren sollte. Sie lächelte breit und winkte, dann sah sie, erblickte sie Diego Aybar. Ihr Lächeln gefror. Sie fasste sich und ignorierte weiterhin Roger, dessen Ansinnen immer schlüpfriger wurden.
Am Ende der Parade war die Stimmung der Teilnehmer und der Menge noch ausgelassener als zu Beginn. Der Grund hierfür war, dass die Veteranen von Kriegen im Ausland eine kleine Blaskapelle mit zwei Schnarrtrommeln hatten und sich gegen Ende der Parade marschierend und spielend aus ihr lösten. Sie marschierten geradewegs in eine kleine Bar, wo sie weiterhin ihren Mann standen.
BoomBoom machte ein Polaroid-Foto von Don Clatterbuck und Roger auf dem Festwagen. Die »Schönheiten« waren samt und sonders geflohen. In dem Moment, als sie knipste, begaben sich die zwei Männer schnurstracks in die Bar.
»Ist das immer so?«, fragte Diego.
»Mehr oder weniger, das heißt, sie betrinken sich entweder mehr oder weniger.« Harry lächelte.
»Ah, ja.« Er lächelte zurück, und es war offensichtlich, dass sie ihm gefiel. In der Botschaft gab es nicht viele Frauen wie Harry. Sie faszinierte ihn. »Bei uns sind die Jahreszeiten anders herum. Frühlingsgefühle stellen sich Ende Oktober und Anfang November ein.«
»Ich stelle es mir schön vor in Südamerika.«
»Ja - nicht jeder Zentimeter, aber - ja.«
»Hat BoomBoom Ihnen den Zeitplan für heute gegeben?«
»Wir gehen auf eine Teeparty. BoomBoom wollte, dass ich Sie im Garten treffe. Sie hatte vorgeschlagen, dass ich mir die Parade anschaue und Sie anschließend treffe, aber ich wollte Sie so bald wie möglich kennen lernen, und ich bin froh, dass ich es getan habe.«
»Ich auch. Ich vermute, BoomBoom wollte, dass wir uns im Garten treffen, weil ich dann ein Kleid angehabt hätte. Das kommt selten vor.« Harry errötete kurz. »Offen gesagt, ich bin fast immer in Jeans.«
»Senorita, Sie sind schön, ganz egal, was Sie anhaben.« Er neigte leicht den Kopf.
»»Oh, das ist gut.« Tucker war begeistert.
Harry brach in Lachen aus. »Mr. Aybar ...«
»Diego.«
»Diego, Sie sind sehr liebenswürdig.« Sie holte tief Luft.
»Wir haben noch ein paar Stunden, bevor wir uns für die Party umziehen müssen. Wenn Sie wollen, kann ich Sie herumfahren, Ihnen ein bisschen die Gegend zeigen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir es rechtzeitig bis Monticello und zurück schaffen können.«
Er hob die Hand. »Ich bin dort gewesen. Mr. Jefferson besitzt meine volle Bewunderung.«
»Rumkreuzen?«
»Rumkreuzen.« Er sprach ihr Wort nach. Diego lernte schnell.
Und sie kreuzten herum und plauderten die ganze Zeit. Sie fuhr an Landsitzen, Apfelhainen, Rinderfarmen vorbei. Zu ihrer Freude erfuhr sie, dass die Aybars einen Wohnsitz in Montevideo unterhielten, aber auch eine Estancia hatten, wo sie Vieh züchteten.
Diego hatte an der Duke-Universität und an der Yale- Universität und abschließend in seiner Heimat Uruguay Jura studiert. Sein Vater hatte ihn zum diplomatischen Dienst getrieben, doch sein Herz gehörte der Landwirtschaft.
»Ich bin an einem Scheideweg.«
»Und Ihr Vater wird verstimmt sein?«
»Er wird an die Decke gehen.« Diego lächelte matt. »Die Familie ist in meiner Heimat, oh, ich kann nicht sagen wichtiger, aber enger, tiefer verpflichtet vielleicht. Hier kommt die Arbeit zuerst - so scheint es mir zumindest. Heimat heißt Familie. Und wie alles ist das gut und schlecht. Sehen Sie, wir haben herrschende Familien, und sie fragen nicht, was ist das Beste für Uruguay, sondern was ist das Beste für die Familie.«
Читать дальше