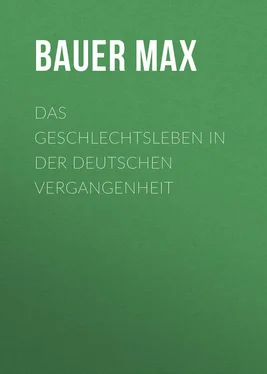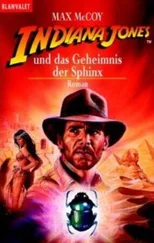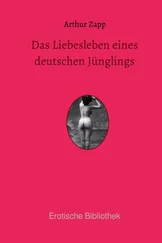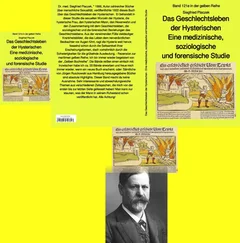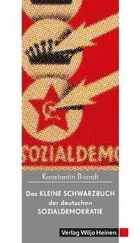Max Bauer - Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit
Здесь есть возможность читать онлайн «Max Bauer - Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: foreign_antique, foreign_prose, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Selbst in den sittenreinsten Klöstern dachte man im Zeitalter Karls und seiner Nachfolger sehr frei, wofür die Dramen Roswithas von Gandersheim Beweise erbringen, jener vielseitigen, hochgebildeten Nonne, mit der der lange Reigen der deutschen Schriftstellerinnen anhebt. »Der singende Mund von Gandersheim« ( clamor validus Gandeshemensis ) lebte und dichtete um die Mitte des 10. bis zu Anfang des 11. Jahrhunderts. Die Dichterin entnahm ihre Stoffe der Heiligengeschichte, die sie in einer dem Terenz nachgeahmten Form dramatisierte. Mit Vorliebe erhitzt sie ihre Phantasie an sinnlichen Vorwürfen, die stellenweise durch die behaglich-breite Detailschilderung von einer Vorurteilslosigkeit zeugt, von der sie ihr letzter Übersetzer trotz aller aufgewandten Mühe nicht völlig reinzuwaschen vermag. 17 17 Die Dramen der Roswitha von Gandersheim. Übersetzt und gewürdigt von Ottomar Pilz. Leipzig o. J.
In ihrem dritten Stücke »Die Auferweckung der Drusiana und des Calimachus« dringt der letztere, ein schöner heidnischer Jüngling, in die kaum geschlossene Gruft »und sucht in dem Marmorbette des Leichnams die Umarmung, welche ihm Drusiana lebend versagte«. Eine Schlange verhindert rechtzeitig die Leichenschändung. – Etwas viel auf einmal für eine schriftstellernde Himmelsbraut! In dem Drama »Fall und Busse Marias, der Nichte des Einsiedlers Abraham« führt uns Roswitha in ein Bordell; in »Die Bekehrung der Buhlerin Thais« schildert sie realistisch ein Freudenmädchen; im »Dulcitius« sollen die drei christlichen Jungfrauen Agape, Chionia und Irene wegen ihrer Standhaftigkeit im Glauben römischen Soldaten preisgegeben werden, nachdem Dulcitius vergeblich versucht hat, seine Begierden an ihnen zu stillen, und dieses alles und noch mehr trägt Roswitha mit frommem Augenaufschlag vor – ad majorem Dei gloriam –. Zur Ehre der Dichterin, die sich eines kraftvollen, aber barbarischen Mönchslateins bediente, sei angenommen, dass sie ihre Stoffe nach schriftlich vorliegenden Vorbildern formte, nichts Selbsterlebtes in ihre Darstellungen verflocht. Aber mussten nicht derartige Scenen selbst die reinste Phantasie mit unzüchtigen, dem Gelübde der Keuschheit diametral entgegenstehenden Bildern füllen und sie zu weiterer Ausspinnung reizen? Die müssiggängerischen Nönnchen hatten so unendlich viel Langeweile, wie sie oft selbst gestehen, dass sie sich wohl recht oft an den Dramen der Gandersheimerin ergötzt und die darin geschilderten Vorkommnisse recht ausführlich durchgesprochen haben mögen…
Vom 12. Jahrhundert an datiert der geistige und materielle Aufschwung des deutschen Volkes, das ganz allein aus sich heraus erstarkte. Der Handel, das Handwerk und auch die, wenn auch nur auf eine engbegrenzte Menschenklasse, namentlich die Klosterleute und die aus den Klosterschulen Hervorgegangenen sich erstreckende Bildung, hoben sich zusehends, erweiterten den Gesichtskreis, schufen neue Lebensformen und mit ihnen neue Bedürfnisse. Das altgermanische Kriegertum, die Freude an Fehde und Jagd, das dem Adel noch immer durch die Adern pulsierte, dessen Andenken die unverklungenen, Begeisterung anfachenden Heldensagen wachhielten, gewann eine neue, modernisierte Gestalt im Rittertume, dessen romanische Urformen bald stark mit echt deutschem Geist durchsetzt waren, der manchen welschen Firlefanz noch vergröberte, um namentlich im Minnedienst, einem Hauptbestandteile des Ritterwesens, tief unsittliche Formen zu schaffen, die gleich vergiftend auf beide Geschlechter wirkten, besonders aber den Grundpfeiler der menschlichen Gesellschaft, die Ehe, untergruben. Die, gleichviel ob real oder platonisch Geliebte galt alles, die eigene Frau nichts. Man schlug sein Weib, wie Kriemhilde klagt 18 18 Nibelungen, 903.
, winselte aber zu Füssen der angebeteten Herrin um die Gunst, die Hand oder den Fuss küssen und den Saum des Gewandes berühren zu dürfen. »Die Ehe des Ritters, sein Hauswesen, seine Kinder, seine Familiengefühle, alles holde Behagen der Heimat stand ganz ausserhalb der idealen Welt, in welcher er am liebsten lebte.« 19 19 Gust. Freytag a. a. O. I. 524.
Des steirischen Ritters Ulrich von Lichtenstein Donquichoterien, sein Zug als Frau Venus im Jahre 1227, in kostbare Frauengewänder gekleidet, das Haupt mit Schleiern umhüllt, und seine sonstigen Läppereien, wie das Trinken des Waschwassers seiner Huldin, die Operation der breiten Oberlippe, das Abhauen eines ihr zu Ehren im Turnier verletzten Fingers, das Mischen unter widerliche Aussätzige, das ihm die Laune der excentrischen Geliebten anbefiehlt, sind der Gipfelpunkt des sich als ritterlichen Minnedienst gehabenden Blödsinnes. Diese sich bis zum Wahnsinn steigernden Überspanntheiten der Ritter, ihre Spielereien, die bandwurmartig anwachsenden Satzungen umgaben schliesslich das ganze Rittertum mit einem schalen Formelkram, der stark an die moderne Vereinsmeierei gemahnt, der Geheimbündeleien des 18. Jahrhunderts gar nicht zu gedenken, denen das Rittertum vielfach zum Vorbilde diente.
Das ritterliche Gehaben führte schliesslich zu einer allgemeinen Lüderlichkeit, die selbst dem überzeugten Romantiker Saint-Pelaye den Stossseufzer entlockte: »Nie sah man verderbtere Sitten, als in den Zeiten unserer Ritter, und nie waren die Ausschweifungen in der Liebe allgemeiner«. 20 20 Scherr, Geschichte der deutschen Frauenwelt, 5. Aufl., I. 177.
Jede Modedame musste ihren Ritter haben, der ihre Farben trug und dem Gemahle ins Handwerk pfuschte. Liebschaften von Frauen aus hohem Stande mit Unebenbürtigen konnten bei solchen Anschauungen nicht ausbleiben. Die Strenge Herzog Rudolfs von Österreich, der 1361 eine Hofdame seiner Frau wegen eines Verhältnisses mit einem ihrer Diener ertränken liess, steht anscheinend vereinzelt da. Der österreichische Dichter Heinrich, der zwischen 1153 und 1163 seine Mahnworte an Pfaffen und Laien richtete, schilderte den Umgangston der ritterlichen Gesellschaft als roh. Der Hauptgegenstand ihrer Unterhaltung waren die Weiber. Wer sich rühmen konnte, die meisten verführt zu haben, galt am höchsten. 21 21 Weinhold a. a. O. I. 253.
Der Ehebruch war alltäglich, wenn auch über seine Verwerflichkeit die damaligen Dichter einig sind. Aber es war Modesache, Ehebrecher zu sein, oder wenigstens als solcher zu gelten.
»Hat ein gutes Weib ein Mann
Und geht zu einer andern dann,
So gleichet er darin dem Schwein.
Wie möcht es jemals ärger sein?
Es lässt den klaren Bronnen
Und legt sich in den trüben Pfuhl.
Gar mancher hat schon so zu thun begonnen.«
klagt Meister Sperrvogel. 22 22 Deutscher Minnesang, übertragen v. Bruno Obermann, S. 37 ff.
Gottfried von Strassburgs unsterbliches »Tristan und Isolde« ist in seiner Gesamtheit eine Verherrlichung des Ehebruches, doch gab es, wie wir eben in dem biederben Sperrvogel sahen, auch Minnesänger, die gegenteiliger Meinung waren. Ein klarblickender deutscher Dichter des 12. Jahrhunderts gesteht es unumwunden ein, dass die Damen den Rittern keine Vorwürfe zu machen berechtigt seien, denn:
»Der wiber chiusche (Keuschheit) ist entwicht
frowen und riter
Dine durfen nimmer gefristen
We der ir leben bezzer si.« 23 23 Heinrichs »Rede von des Todes Gehügede« in Goedeckes »Mittelalter«, S. 187.
Die Lotterei der französischen Ritter, deren Liebeshöfe oftmals in Orgien ausarteten, bei denen sich verlarvte Mädchen und Frauen schamlos preisgaben 24 24 De la Curne de Saint-Pelaye, »Das Ritterwesen des Mittelalters«, deutsch von Klüber, II. 268.
, fanden hin und wieder Nachahmung in Deutschland, wenn sie sich auch nicht so allgemein verbreiteten, wie in ihrem Mutterlande, wo Liebeshöfe sogar in den Klöstern eine Stätte fanden.
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.