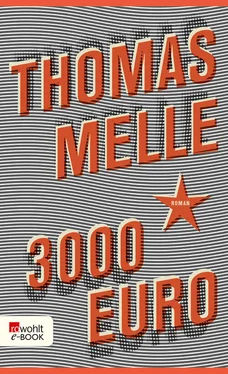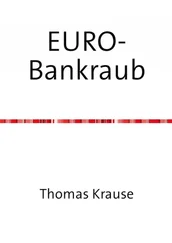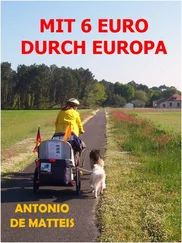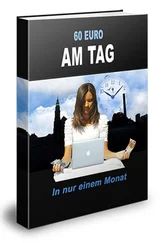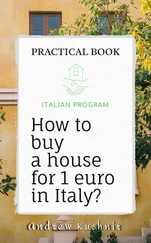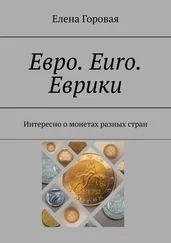Der Gedanke an Anton kam ihr wieder im Flugzeug, auf dem Hinflug, als sie versuchte, vor den Stewardessen zu verbergen, wie ungewöhnlich das Fliegen für sie ist, und gerade deshalb einen Tomatensaft bestellte, mit dem ironischen Zwinkern der Bescheidwisser, die das Klischee wählen, um ihm vermeintlich zu entgehen.
Das kam ihr wie eine Aktion von Anton vor, und sie musste unvermittelt an ihn denken und erschrak.
Sie wusste plötzlich mit einer Gewissheit, die sie so nicht kannte, dass er tot ist, und sah ihn in Blitzbildern hängend am Strick, in der Badewanne verblutet, vom Zug zerfetzt. Sie verscheuchte den Gedanken wieder, umstellte ihn mit Zweifeln, aber er wollte sich nicht beugen. Dann wappnete sie sich mit Gleichgültigkeit, während ein Film mit Ashton Kutcher begann. Anton ist also tot? Und wenn , dachte sie. Sie hätte sich fast nicht mehr an seinen Namen erinnert. Außerdem gibt es keine Gewissheit. Alles nur Gespenster im Kopf.
Die Pizzen sind da, es sind labbrige Monster mit etwas Tomatensaft, Cheddar Cheese und Oregano drauf, aber Linda mag sie sofort. Denise hat eigentlich keinen rechten Hunger und kaut lustlos auf einem Pizzastück herum, bis sie nur noch Mehl schmeckt. Linda redet über die Sachen, die ihr vom Tag haftengeblieben sind, die tanzenden Plüschhunde in einem Schaufenster, der freundliche Polizist, der ihr zuzwinkerte und Quatsch redete, der Seifenblasenmann mit den riesigen Seifenblasen.
Während Linda so vor sich hin redet, in ihre Pizza hinein, wird Denise bewusst, dass ihre Tochter immer nur Monologe hält, die an niemanden gerichtet sind. Sie hat keinen echten Adressaten, sie brabbelt einfach so vor sich hin, wohl, weil sie es gewohnt ist, dass Denise ihr nie zuhört. Sie beschäftigt sich einfach mit den Worten, redet in einen leeren Raum hinein, und es macht kaum einen Unterschied, ob sie gerade zu ihrer Mutter, zu einem amerikanischen Polizisten oder zu einer der Puppen spricht, die sie so gerne frisiert.
Denise muss schlucken und kämpft plötzlich mit den Tränen. Sie wendet den Blick ab und starrt nach draußen. Die Leute gehen ihrer Wege, schneller als in Deutschland, die meisten alleine wie Denise. Die, die in Gruppen gehen, lachen und reden und sehen gut aus. Der Boulevard ist prallvoll mit Leuten, die sie gar nicht «Leute» nennen will, weil sich das so deutsch und gewöhnlich anhört, es sind Menschen, fremde, lebendige Menschen, und Denise kommt sich im Vergleich zu ihnen wie halbtot vor, vor der falschen Pizza im falschen Diner, als falsche Mutter des falschen Kindes in der falschen Stadt. Ihr Blick verschwimmt, und sie nimmt eine Serviette aus dem Halter, um sich die Nase zu putzen und eine Träne aufzuhalten, bevor diese ihr das Make-up ruiniert.
Der Menschenstrom reißt nicht ab, wird größer, dichter, behäbiger. Es scheint Stoßzeit zu sein, und ihre Augen sind feucht, verwischen die Masse an Menschen zu einem dicken Pinselstrich. Linda redet noch immer. Denise hört das irgendwo im Hintergrund ihres Bewusstseins, ohne es in Sinneinheiten zerlegen zu können. Die Menschen draußen beschleunigen den Schritt, und nachdem Denise ihre Augen nochmals abgetupft hat, löst sich der Strom wieder in einzelne Personen auf.
Als Denise meint, dass sie sich gefangen hat, und sich jetzt endlich ihrer Tochter zuwenden möchte, um vielleicht eine bedeutungslose Zwischenfrage zu stellen, um Anteilnahme wenigstens vorzutäuschen, fällt ihr ein Mann auf, der inmitten der vorbeigehenden Passanten stehen geblieben ist. Er ist etwa fünfzig Meter entfernt, trägt einen grauen Anzug und starrt, so scheint es, herüber.
Denise erschrickt.
Sie erkennt sein Gesicht nicht genau, obwohl es zu lächeln scheint, aber die leicht gebeugte Körperhaltung, die auch über die Distanz hinweg deutlich wahrnehmbare, schräge Erscheinung, die eckigen Glieder, die Größe, der Anzug, die Haare, all diese Details legen nur einen Schluss nahe: Dort steht Anton. Anton lebt, und er steht dort, mitten in New York.
Ein Ruck durchfährt sie, sie will aufspringen und hinausrennen. Aber sie bleibt wie festgeleimt auf diesem viel zu hohen Barhocker sitzen und starrt zurück. Vielleicht, um es nicht aufzulösen, nicht zu zerstören. Um es wahrzumachen.
Anton, oder wer auch immer es ist, der dort steht, sieht sie noch immer an, sie, genau sie. Er ist es, mit seinem Anzug, mit seinem Lächeln. Er winkt nicht, gibt ihr kein Zeichen, sondern steht nur dort und blickt sie an, im Sonnenlicht, nah an der Schattengrenze. Denise nickt, und Anton nickt auch. Beide lächeln. Dann geht er weiter, zwei, drei Schritte, verschwindet hinter einer Touristengruppe und taucht nicht wieder auf.
Denise fröstelt.
Als sie zahlt, gibt sie mehr Trinkgeld, als üblich ist, und die Kellnerin bedankt sich erst gespielt überschwänglich und hält dann kurz inne. Sie sieht die Gelöstheit in dem Gesicht der Kundin, das Glück, das sie ausstrahlt. «You have a good day», sagt sie verschwörerisch und ist von der stillen Freude, die von Denise ausgeht, kurz angerührt.
Die blickt weiterhin nach draußen, hält diesen Augenblick fest, so lange es geht. Die Leute, die sie nicht Leute nennen will, gehen weiter vorbei, aber sie scheinen sie jetzt anzusehen. Ob sie weint?
Linda redet noch immer ins Leere, als sie aufstehen und gehen, aber die Worte setzen sich nach und nach wieder zu einem Sinn zusammen. Es sind noch immer der Polizist und der Park und die Ballons, die ihre Tochter beschäftigen, es ist ein Gebrabbel, doch Denise kann die Melodie darin wieder wahrnehmen, dem Inhalt folgen. Es ist wie ein Kinderlied, das sie lange vergessen hatte.
Als sie den Diner verlassen, atmet Denise tief ein und aus. Die Luft schmeckt frisch und neu. Sie hebt ihre Tochter hoch, trägt sie durch die Straßen und wird sie bis zum Hotel nicht mehr loslassen. Die Gesichter ziehen vorbei, alte, faltengekerbte Masken der Weisheit neben jungen, großäugigen Visagen. Sie blicken ihr alle in die Augen, doch ohne Häme diesmal, ohne Widerwillen, ohne den Drang, die Fehler in Denise zu suchen. So wurde sie lange nicht mehr angeblickt. Und sie scheint wirklich gemeint zu sein. Die Leute lächeln ihr freundlich zu, und Denise lächelt befreit zurück. Das ist also New York. Das ist also die Welt, denkt sie.
Lange nicht mehr gesehen.
Thomas Melle, 1975 in Bonn geboren, studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie in Tübingen, Austin (Texas) und Berlin. Er ist Autor vielgespielter Theaterstücke und übersetzte u.a. William T. Vollmanns Roman «Huren für Gloria». Für seinen Erzählungsband «Raumforderung» (2007) erhielt Thomas Melle den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis. Sein Debütroman «Sickster» (2011) war für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde mit dem Franz-Hessel-Preis ausgezeichnet. Thomas Melle lebt in Berlin.
Denise kommt mehr schlecht als recht mit ihrem Leben klar. Sie arbeitet im Discounter, ihre kleine Tochter Linda überfordert sie oft; eine langersehnte New-York-Reise bleibt ein — immerhin tröstlicher — Traum. Mit dem Lohn für einen Pornodreh will sie endlich weiterkommen, aber man lässt sie auf ihr Geld warten. Immer öfter steht Anton an ihrer Kasse, der abgestürzte, verschuldete Ex-Jurastudent, der im Wohnheim schläft. Vorsichtig kommen sich die beiden näher. Während Denise wütend, aber auch stolz um ihr Recht und für ihre Tochter kämpft, während Anton seiner Privatinsolvenz entgegenbangt, arrivierte frühere Freunde trifft, mal Hoffnung schöpft und sie dann wieder verliert, entwickelt sich eine zarte, fast unmögliche Liebe. Beide versuchen, sich einander zu öffnen, doch als Denise endlich ihr Geld bekommen soll und Antons Gerichtstermin naht, müssen sie sich fragen, wie viel Nähe ihr Leben wirklich zulässt …
Читать дальше