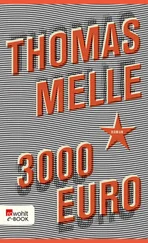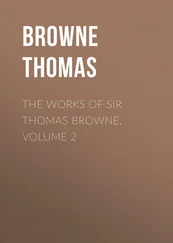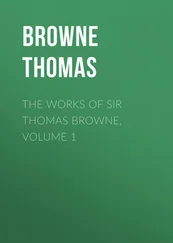Er war noch tiefer in die Nacht ausgegangen, immer tiefer, immer selbstverlorener, und hatte Musik gehört, stundenlang. Die neue, laute Musik aus der nikotinvergilbten Stereoanlage seiner Jugend haute ihn um, immer dieselben Lieder, immer lauter, jedes Mal. Ein jeder Club, in den er tatendurstig tänzelte, ließ ihn leer beglückt und höchst zufrieden wieder hinauswanken. Der Alkohol und die gelegentlichen Joints schärften seine Wahrnehmung. Die Welt und die Worte hatten dann eine besondere Patina; die Musik dröhnte und flashte dreimal so intensiv wie im nüchternen Zustand.
Ab einem bestimmten Punkt jedoch, der je nach Gemütslage und Körperzustand nach dem soundsovielten Bier überschritten war, fiel diese narkotische Sensibilisierung plötzlich in sich zusammen, und die Wahrnehmung zog sich auf sich zurück, die Perzeptoren machten zu, Ladenschluss. Dann wurde eben getanzt bis zum Umfallen, fast egal, zu welcher Musik, denn Tanzen war für Magnus die letzte (und vielleicht ohnehin die einzige) Möglichkeit, kommunikabel zu bleiben.
Morgens hatte er oft, andere nennen es Hangover , den Geschmack von Katharsis auf der Zunge. Wie nach einem Reboot trauten sich seine Augen wieder in die Welt zurück, erst blinzelnd verklebt, dann schon kalt gewaschen und bereit zur nächsten Flut. Jeder Rausch konnte ein Neuanfang sein. Und jeder Tag fing immer von vorne an, bei null, eine Wohltat.
Was auch half und die Sinne schärfte: Schlafentzug. Täglich höchstens vier Stunden hatte Magnus sich verordnet und diesen Plan bis zum August durchgehalten. Denn die Depression lauerte in jeder freien Minute. Das war familienbedingt und spürbar. Und Schlafentzug half dagegen, besser als jede Lichttherapie.
Im August aber war etwas anderes passiert: Die freien Minuten nahmen überhand. Magnus hatte nämlich frei, «Sommerloch», so nannten sie das, und er wusste nichts mit dieser Freiheit anzufangen. Er wollte diesen Urlaub nicht, aber der Urlaub musste irgendwohin; der Urlaub war eigentlich eine sommerliche Arbeitslosigkeit. Magnus begann, so schien es, den eingesparten Schlaf des ganzen Jahres nachzuholen, um die freien Minuten totzuschlagen, unfühlbar zu machen.
Irgendwann aber, nach etwa einer Woche, war er nicht mehr müde. Dann wurden die freien Minuten langsam zur Plage. Was dagegen half: das Internet.
Minütlich befinden sich Millionen von Menschen in den Datenräumen des Netzes, schaffen sich dort neue Identitäten und Namen, existieren als Zeichenhaufen und Bündel von Selbstzuschreibungen, transformieren sich in reinste Semiotik. Das Netz ist das Forum depersonalisierter Fragmente und fragmentierter personae, körperlos, geschichtslos, und alles kann im nächsten Moment umschlagen in etwas anderes.
Magnus ging bereits seit Mitte der Neunziger als zumeist stiller Teilnehmer in diese Parallelwelt der Zeichen und Bilder, besuchte offizielle Firmenseiten und abgelegene Chatforen, durchforstete Newsgroups, Musikarchive, blieb an Freakshows und Pornoseiten kleben. Es war eine synchrone, asymmetrische Bibliothek von Babel, die ständig wuchs hinter seinem Monitor, sich vernetzte und wucherte wie das Hirn eines lernenden Kleinkinds, und die Möglichkeit, etwas Überraschendes, Neues zu finden hinter all dem Halbwissen und Kommerz, übte einen seltsamen Sog auf ihn aus. Es zog ihn immer wieder zurück.
In jenem August, der ihn schließlich den Kopf kosten sollte, war villacam.org sein großer Favorit. Villa G. war eine junge, punkig angehauchte Ernährungsberaterin aus Tübingen, die ihren Alltag schon seit Jahren nahezu ungefiltert ins Web stellte und sich beim Spülen, Schlafen, Fernsehen filmen ließ. Jedes ihrer drei Zimmer war mit zwei Kameras ausgestattet; es gab nur einen Winkel im Flur, den die Kameras nicht erreichten. Eine mehr als ansehnliche Villa-Fangemeinde hatte sich über die Jahre formiert und tauschte sich eifrig im Gästebuch oder in den angegliederten Chatrooms aus; Unmengen von männlichen Teilnehmern hatten sich anscheinend schon in Villa verliebt und wieder entliebt und wieder verliebt und posteten lächerlich entflammte Liebesgedichte oder eben arg enttäuschte Schmähungen ins Gästebuch, welche Magnus zugleich auflachen und verkrampfen ließen — erinnerten sie ihn doch an seinen Brief an Jonna (mit der er seit Monaten nicht mehr gesprochen hatte). Villa klinkte sich bisweilen selber in die Diskussion ein und gab Kommentare ab, die zwischen bestechendem Charme und befremdlicher Naivität gar mädchenhaft schillerten. Magnus wusste nicht, ob diese Naivität Masche oder echt war, oder ob die Masche nun das neue Echte war, oder wie genau die Dinge tatsächlich lagen — aber es hielt ihn bei Laune.
Villa begleitete ihn, so wie er Villa begleitete. Den ganzen Tag über hatte er sie im Kopf, ihre zerbrechliche, fast hagere Statur, ihre kränkliche Bleichheit, ihr Lippenpiercing. Schloss er die Augen, blitzte ein Spiegelreflex ihres Vogelgesichts unter seinem Lid auf. Beim Texten, ob am Drehbuch oder an den Online-Updates stocktrockener Schmierstoff-News, holte er sich stündlich ein Villa-Update und schaute nach, was sie gerade so trieb. Wenn es ihm gefiel, fror er das Bild ein und versteckte es unter den aktuellen TOP-Artikel-Tabellen. Manchmal vertrieb er sich die Zeit, indem er das Bild perfektionierte, Sättigungsgrad und Körnung verfeinerte. Magnus ging mittags gleich nach dem Aufstehen ins Netz und blieb bis frühabends nach dem Mittagsschlaf; sogar noch spät in der Nacht, nach dem Ausgehen, checkte er, ob auch sie noch wach war, oder ob auch er schlafen gehen konnte. Am nächsten Tag wusste er dann oft gar nicht mehr, was er alles gesehen und gelesen und getippt hatte.
Jetzt, während der freien Tage im August, wo die Hitze im Hinterhof flirrte und die freien Minuten sich nachmittags stauten, war er ununterbrochen im Netz, während im Hintergrund dazu der Fernseher lief; er verdunkelte sein Zimmer, verhängte die Fenster mit Bettlaken und tauchte hinein in das andere Universum. Abends dann, schon erschöpft und völlig verwirrt von wabernden Artikeln, sinnlosen Filmchen und blinkenden, sprechenden, musizierenden Werbebannern, zog es ihn wieder nach draußen, in die Nacht, und er fand sich an der Theke wieder oder auf einer Tanzfläche, und die tausend Infopartikel, die sich tagsüber in sein System geschleust hatten, klumpten nachts im Kopf zu einem gezackten, bewegten Batzen zusammen.
Es ist kein rapider Abstieg, eher ein langsames Wegsterben aller Ambitionen, allen Ehrgeizes, auch des persönlichen Stils; ein schrittweiser Abstieg in wässrige, immer blassere Regionen. Das Aufstehen schiebt sich immer weiter in den späten Nachmittag hinein. Zwischen Woche und Wochenende gibt es kaum noch einen Unterschied. Gegessen wird wenn, dann aldi-dosen-italienisch, oder die Restkonserven vom abwesenden Mitbewohner. Die Tage sind so kurz, die Nächte noch viel kürzer, dafür intensiver. Erst wird dem Kopf mit Wein, Abendprogramm und Internet kräftig eingeheizt, dann wird blumig geträumt, offenen Auges, bei abgestelltem Fernsehton. Irgendwann, sehr viel später, legt sich vielleicht der Schlaf dazu und wirft dem Traum seine Decke über. Wenn das nicht klappt, heißt es: Schuhe an und Haare nass und raus in die Nacht, rein in die Bars. Manchmal, morgens nach dem Aufwachen, kann man spüren, wie das alte Leben in Streifen von einem abfällt, die alten Rahmendaten des Alltags mehr und mehr verschwimmen, verschwinden. Wie unterirdisch irgendwo eine Drift entsteht, es dröhnt in einem, als wenn kleine Kontinente sich aneinander aufreiben, wie es knackt und knirscht. Manchmal hat man einen Schweißausbruch.
Wie schnell das Verlernen geht, ist immer wieder überraschend. Plötzlich geht nichts mehr. Die Hand zum Beispiel kennt deine Schrift nicht mehr. Ein Buch wird aufgeschlagen, angelesen, verwirrt wieder zugeschlagen. Der Supermarktgang geschieht in Trance, als Gespenst auf der Suche nach der Punica-Oase. Und wie das Abspülen laufen soll, ist ein Rätsel. Deine Mutter hat dich als Kind gelehrt, Wasser in die benutzten Gläser und Schüsseln zu füllen, damit die Speise- und Getränkereste nicht eintrocknen, ja. Sie hat dir jedoch nicht gesagt, ob man das Wasser aus den Behältern schütten soll, und wenn ja, wann, und wie. Und was dann. Vielleicht hat sie es dir ja doch gesagt, aber du weißt es nicht mehr. Du hast es einfach vergessen. Du willst es auch gar nicht wissen. Jetzt wirft das Wasser in den Schüsseln Blasen und dümpelt vor sich hin, wird langsam zu ekligem Fruchtwasser. Bald ist das Geschirr trächtig, brütet eine gigantische Drosophila aus, die dich vernichten wird, indem sie sich auf dein Gesicht legt und dir das Leben heraussaugt. Und du schaust zu, hier, untätig und gelähmt. Wartest auf eine Drosophila. Stell dir das mal vor. Zieh dir das mal rein.
Читать дальше