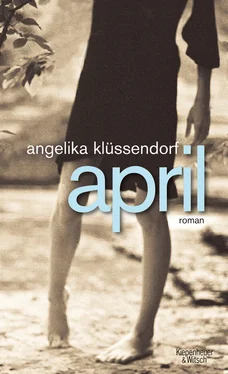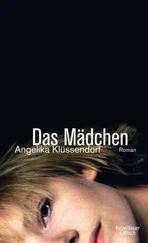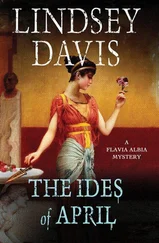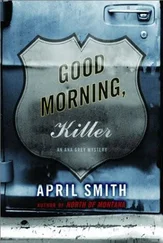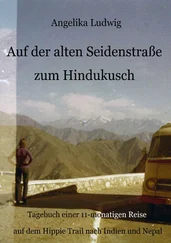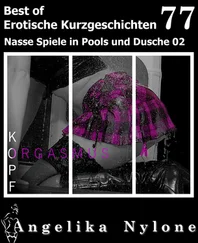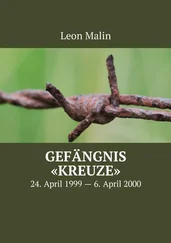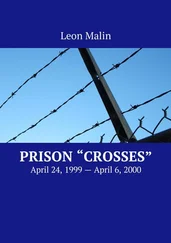Sie besucht Irma und bringt ihr eine Mappe mit, die sie im Proberaum auslegen soll. Toll, sagt Irma, das habt ihr ganz ohne Männer geschafft. Sie trägt eine schwarz glänzende Kappe, und April würde ihr am liebsten sagen, dass sie immer mehr einer Hummel gleicht, einer friedfertigen Wehrstachelträgerin, sie würde am liebsten laut summen — so wenig kann sie Irmas anerkennenden Blick aushalten.
Der Vater von Hans ist in München gestorben. Als die Nachricht eintrifft, stellt sich heraus, dass Hans just in seiner Todesnacht vom Vater geträumt hat, obwohl er schon sehr lange nichts mehr von ihm gehört hatte. Die Brüder stellen gemeinsam den Antrag, an der Beerdigung teilnehmen zu dürfen. Sie haben zwar mit der Ablehnung gerechnet, aber dann reagieren sie doch fassungslos. Was für eine Anmaßung, sagt Hans, sie hat ihn noch nie so verärgert gesehen.
Wir sollten hier endlich verschwinden, sagt April zu Hans, wir sollten dieses Land verlassen. Sie sagt das ins Blaue, hat keine Vorstellung, was damit verbunden ist. Den Westen, das sogenannte kapitalistische Ausland, hat sie sich immer als eine Art Eispalast vorgestellt, wie im Märchen der Schneekönigin. Die Straßen, Gehwege, Häuserwände gefliest, darüber selbst im Sommer Raureif, dauerhaft wie Marmor. Die Menschen parfümiert, ohne Eigengeruch. Dennoch kann ihr keine Propaganda erklären, warum sie in einem Land bleiben muss, um das eine Mauer gezogen ist. Sie will selbst entscheiden dürfen, wo und wie sie lebt.
Zu ihrer Überraschung bedarf es keiner langwierigen Diskussion mit Hans. Das sollten wir tun, sagt er, offenbar hat er schon lange darüber nachgedacht.
Die Vorstellung, dass sie gemeinsam weggehen werden, bringt sie einander wieder näher. Sie sitzen morgens und abends zusammen, reden, diskutieren. April ist zumute, als sei ein trüber Schleier von ihrer Beziehung genommen.
Ihr erster Antrag wird mit der Begründung abgewiesen, dass dafür jede gesetzliche Grundlage fehle. In ihrem zweiten Schreiben beruft sich Hans auf die Menschenrechte. Von da an schreiben sie wöchentlich und erhalten immer dieselbe Antwort. Die Behördengänge erweisen sich schon bald als Farce, sie werden wie Kinder behandelt: Na, was haben wir uns denn dabei gedacht, einen Antrag wollen wir stellen, ts, ts, ts, na, so was aber auch. Hans verliert seinen Studienplatz. Nun müssen sie mit Aprils Lohn auskommen. Als es einmal wirklich knapp wird, erinnert sie sich an den Schmuck der beiden alten Frauen von der Haushaltsauflösung und geht damit in ein Antiquitätengeschäft, ohne sich große Hoffnung zu machen. Doch dann stellt er sich als echt und wertvoll heraus. Sie behält nur ein Kreuz aus Granatsteinen, für den restlichen Schmuck bekommt sie eine größere Summe und kauft im Exquisitladen die feinsten Dinge. Lachend erzählt sie Hans, dass sie reich sein könnten, hätte sie damals das ganze funkelnde Zeug eingesteckt.
Durch ihren Antrag auf Ausreise hat sich etwas grundlegend geändert: Sie gehören nicht mehr dazu. April begegnet beim Bäcker, in der Poliklinik und andernorts denselben Leuten, doch sie hat das Band gekappt, ist aus der Schicksalsgemeinschaft ausgestiegen. Das ist ihr sogar dann bewusst, wenn ihr Gegenüber nicht Bescheid weiß. Ihr Gefühl von Überlegenheit wechselt sich mit Angst, manchmal mit Wehmut ab: wieder ein Stück Unschuld verloren.
Nach einer Weile werden auch die wöchentlichen Behördengänge zur Routine. Immer noch treffen sich Hans und Reinhard einmal in der Woche mit Freunden, sie lesen Heidegger und diskutieren darüber. Die Treffen finden in Reinhards Wohnung statt, und wenn April zufällig dabei ist, sitzt sie mit Babs in der Küche. Die Männer bleiben unter sich, Mao der Kater wird in dieser Runde eher akzeptiert als eine Frau. April will aber unbedingt bei den Männern sitzen. Sie beginnt, Heidegger zu lesen, um mitreden zu können, und obwohl sie Wendungen wie» es west an «lächerlich findet, glaubt sie, das Gelesene zu verstehen. Beim nächsten Treffen sagt sie beiläufig etwas möglichst Tiefgründiges, und der Überraschungseffekt bleibt nicht aus. Reinhard sieht sie an, als hätte er Zahnschmerzen, Hans zeigt einen gewissen Stolz, schließlich ist sie sein Geschöpf, doch dann lachen die Männer prustend los, als wäre es ein Riesenwitz, dass ausgerechnet April den Namen Heidegger im Munde führt.
Ist was dran an dem Gedanken, kommentiert Hans hinterher, das mit der Begrifflichkeit der Zeit hat sie doch ganz gut ausgedrückt.
Ja, für eine Frau ganz gut, sagt Reinhard.
April weiß schon gar nicht mehr, was sie gesagt oder gemeint hat, natürlich ist ihr die Geringschätzung hinter dem scheinheiligen Lob nicht entgangen, trotzdem buhlt sie weiter um die Aufmerksamkeit der Männer.
Wenn April und Hans abends ausgehen, lassen sie Julius allein in der Wohnung zurück. Er ist inzwischen zwei Jahre alt. Hans erzählt ihm eine Gutenachtgeschichte, und dann ziehen sie los, egal ob der kleine Junge wach ist oder schläft, sogar wenn er weint, schreit, bettelt. In ihrem Freundeskreis ist es durchaus üblich, die Kinder nachts manchmal allein zu lassen, und wenn sogar Hans sich darauf einlässt, muss es doch in Ordnung sein — so täuscht April sich selbst, wenn sie Julius im Dunkeln zurücklässt.
Immer wenn sie daran denkt, die Fenster zu putzen, kommt ihr der Ausreiseantrag in den Sinn, und sie lässt es bleiben. In diesem Sommer tragen die jungen Frauen lange, bunte Gewänder. Weil es keine dünnen Baumwollstoffe zu kaufen gibt, hat Susanne Windeln verarbeitet und daraus die schönsten Hippiekleider genäht.
Kirchenglocken in der Ferne, ein lauer Wind, sonst regt sich nichts. Neben April liegt ein junger Mann auf der Wiese, sein Brustkorb hebt und senkt sich gleichmäßig, sie streicht ihm eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie hat ihn am Vorabend kennengelernt, auf einer Performance, mitten im Trubel hat er einfach ihre Hand genommen und sie durch das Gedränge nach draußen gezogen. Stundenlang sind sie durch die Nacht gelaufen, ehe sie die noch immer sonnenwarme Wiese entdeckten. Was für ein schöner Morgen, sagt sie zu dem jungen Mann, der die Augen geöffnet hat und sie ansieht. Der junge Mann hat gerade seine Lehre als Werkzeugmacher beendet, er heißt August, sein rechtes Auge ist kleiner als das linke und sieht irgendwie traurig aus. Doch August ist alles andere als traurig, er sprüht geradezu vor Lebenslust, und sie fühlt sich neben ihm schon uralt, mindestens dreißig. Was für ein schöner Morgen, sagt nun auch August und küsst sie.
Sie will ihn mit ihrer Lebenserfahrung beeindrucken, doch sie war und wird nie so jung sein wie August, der die Arme hochreißt und sich streckt, als könnte er den Himmel mit links erreichen.
Er hat seine Wohnung gerade erst bezogen, auf dem Flur riecht es nach Räucherstäbchen, an der Wand prangen Fotos von nackten jungen Frauen in bescheuerten Posen — sie ist sofort eifersüchtig. Ein paar Tage später nimmt er die Fotos ab und hängt dafür Drucke alter Meister auf, einen Franz Hals, die sixtinische Madonna.
August ist Bassist und Sänger in einer Punkband, die Namen der Band wechseln ständig, seit Kurzem heißt sie Augustapril. Sie begleitet ihn gern zu seinen Auftritten, in Parkanlagen, Abrisshäusern oder stillgelegten Bahnhöfen. Seine Art zu singen oder singend zu brüllen versetzt ihr ein leichtes Beben im Unterleib, gleichzeitig löst seine Ungehemmtheit Neid in ihr aus: Nie wird sie so lässig sein können.
Eingabe um Eingabe an Honecker, Genscher, an all die Herren von Wichtigkeit.
Der Beamte gibt ihnen zu verstehen, dass sie niemals in den Westen ausreisen dürften, eher würde die Erde eine Scheibe werden; jeden Einwand schneidet er mit einem» Nein «ab. Nein, gibt es nicht, da haben wir uns beim Klassenfeind wohl falsch informiert?
In einer neuen Ausgabe vom» Anschlag «setzt April ein Zitat von Voltaire auf die erste Seite:»In manchen Ländern hat man angestrebt, dass es einem Bürger nicht gestattet ist, die Gegend, in der er zufällig geboren ist, zu verlassen. Der Sinn dieses Gesetzes liegt auf der Hand, das Land ist so schlecht und wird so schlecht regiert, dass wir jedem verbieten, es zu verlassen, weil es sonst die ganze Bevölkerung verlassen würde.«
Читать дальше