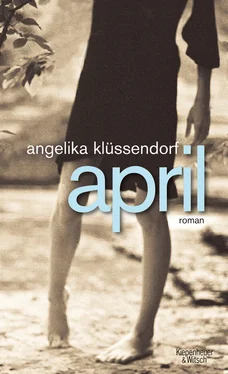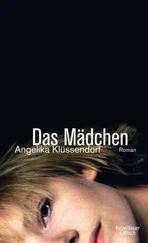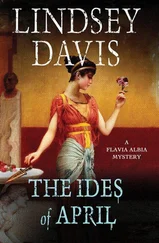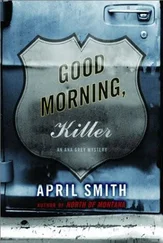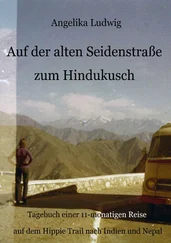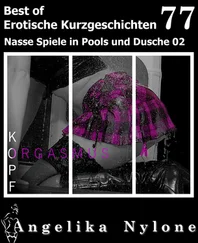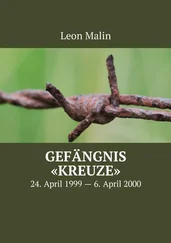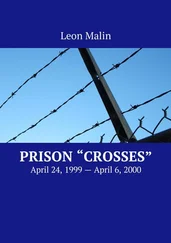Die Herausgabe ihrer Untergrundmappen ist für sie bisher ohne Folgen geblieben, was April in ihrer Annahme bestätigt, dass die Stasi-Geschichten übertrieben, wenn nicht gar erfunden sind, obwohl es zu einigen durchaus bedenklichen Begegnungen kommt. So wird sie auf der Straße von einem Mann angesprochen, der sie gerne fotografieren möchte, sie habe ein so schönes Lächeln. Wenn er ihre Augen oder ihre Haut gepriesen hätte, wäre sie ihm vielleicht auf den Leim gegangen, aber ihr Lächeln, das weiß sie genau, ist alles andere als schön; es ist gezwungen, vorsichtig, wie auf dem Sprung.
Ein anderer Mann kommt ins Museum und bietet ihr in seinem Lehrlingswohnheim eine Lesung an, er habe gehört, sie schreibe Gedichte und Erzählungen. Es ist ihre erste Lesung, die fünf Jungs, die ihr zuhören, sind angehende Elektriker, und sie kichern wie Mädchen. Sie legt den nötigen Ernst in ihre Stimme, doch die Jungs interessieren sich mehr für die Limonade und das Süßzeug, das sie als Bestechung fürs Zuhören erhalten haben. Nach der Lesung steckt der Mann ihr fünfzig Mark für ihre Mühe zu, nimmt sie vertraulich zur Seite und sagt: Traurige Gedichte, die Sie da schreiben, ich hoffe, ihre Einstellung zum Staat ist nicht ganz so traurig. April überlegt, wie oft er diese Sätze geprobt hat, ob auch andere Sätze zur Auswahl standen. Die fünfzig Mark sind immerhin eine Überraschung, da will sie ihm und der Stasi etwas bieten: Sie plane ein Attentat auf Ronald Reagan, den ultimativen Rausch für alle, FKK-Verbot für Funktionäre, und erst als der Mann hörbar nach Luft schnappt, beendet sie ihre Aufzählung mit dem Hinweis, dass sie sowieso an die Elfenbeinküste auswandern wird. Verstehen Sie, das Leben ist nicht traurig und meine Einstellung auch nicht, sagt sie, es gibt viel zu tun. Später überlegt sie, warum sie überhaupt eingeladen wurde, wegen dem Ausreiseantrag, der Untergrundmappe oder einfach, weil sie kein nützliches Mitglied der Gesellschaft ist?
Als sie Susanne davon erzählt, lachen sie sich schlapp, Hans ermahnt April zur Vorsicht. Sie berichtet auch anderen von ihrer Begegnung: Es ist ein unausgesprochenes Gesetz, Kontakte mit der Stasi sofort zu verbreiten.
Die kleine Frau mit der Warze taucht erneut im Museum auf, um ihren Status als Verrückte zu überprüfen. April lässt sie kaum zu Wort kommen, redet wie David von Farben, in ihrem Gehirn sei ein Farbsturm ausgebrochen, Aquamarin würde Zinnoberrot bekämpfen, und auf die Frage der Frau, wie sie sich fühle, antwortet sie: rabenschwarz. Noch während sie ihre kleine Vorstellung abliefert, behält sie im Hinterkopf den Gedanken, dass sie nicht übertreiben darf, denn wenn ihre Verrücktheiten ernst genommen werden, könnte sie in der Klapse landen, vielleicht sogar in der Geschlossenen.
Sie schenkt August zwei winzige Goldfische, die in einem gläsernen Weinballon schwimmen. Sie schickt ihm Telegramme mit Liebesgedichten und ihren Treffpunkten. Sie verschickt auch Telegramme an Freunde, mit scheinbar verschlüsselten Botschaften, und das nur, um sich über die Stasi lustig zu machen. Sie lernt einen Journalisten aus München kennen, der geradezu hingerissen ist von den vermüllten Straßen, dem Dreck, der Wäsche vor den Fenstern. Sie zweifelt an seinem Verstand. Das gefällt dir, fragt sie, und versucht mit Blick auf die grauen, ramponierten Mietshäuser zu erkennen, was sein Entzücken rechtfertigen könnte. Das ist wie in Venedig, ruft er und wirft vor Begeisterung die Arme in die Luft. Venedig hat sie sich ganz anders vorgestellt. Alles ist so echt, sagt er, unverfälscht und einfach, Kaffee und Bockwurst, eure Gastfreundschaft; man hat das Gefühl, in eine Wirklichkeit einzutauchen wie sonst nur noch bei den Russen.
Sie bittet ihn, ihr blaue Haarfarbe zu schicken, wenn er wieder in München ist; und auf wundersame Weise passiert das Päckchen tatsächlich alle Kontrollen. Sie lässt sich die Haare raspelkurz schneiden und sprüht sie mit metallblauer Farbe ein. Menschen bleiben bei ihrem Anblick stehen, deuten mit dem Finger auf sie, sogar Julius zeigt sich befremdet, als wäre ihr Auftreten unangemessen. Er wünscht sich eine normale Mutter, das spürt sie, normal mit allem, was dazugehört, verlässlich und anwesend, eine Mutter, bei der er nicht versuchen muss, Zeichen zu deuten.
Inzwischen erträgt sie es kaum noch, wenn Hans sie ständig korrigiert. In ihrer Wahrnehmung reagiert er wie ein Hund, der sofort seine Spur auf jeden ihrer Gedanken setzen muss. Wenn sie sich streiten, bleibt er stoisch, lässt ihre Vorwürfe an sich abprallen, am liebsten würde sie ihre Zähne in seine versteinerten Schultern schlagen. Sie sind beide durchdrungen von Starrsinn, Abscheu und einem Rest Liebe, stoßen sich gegenseitig ab und kommen dennoch nicht voneinander los. Sie fragt sich, warum sie mit ihm ausreisen soll und nicht mit August oder allein mit Julius.
Oft betrachtet sie Julius und denkt, sie müsste ihn mehr lieben. Einmal, an einem Sonntagmittag, schneidet er sich, während sie schläft, mit einer Nagelschere den Pony bis zum Haaransatz ab, setzt einen Hut von Hans auf und geht heimlich hinunter auf die Straße. Als sie ihn nach langem Suchen in einer Seitenstraße vor einem Schaufenster entdeckt, erkennt sie ihn zuerst nicht, sie sieht einen kleinen Fremden, der nichts mit ihr zu tun hat.
Freunde, Künstler, die April über die Arbeit für ihre Untergrundmappe kennengelernt hat, wollen während der Dokumentarfilmwoche gemeinsam vor dem Kino» Capitol «demonstrieren. Warum und wofür, fragt April, und aus den Antworten meint sie zu erkennen, dass es ihnen selbst nicht so klar ist: Für den Frieden, sagt eine schwangere Frau; Gerechtigkeit, sagt Susanne; warum nicht, sagt ein Maler. Frieden, welcher Frieden? Obwohl April das ziemlich kindisch findet, geht sie hin, mit einer Kerze, versteckt im Hosenbund. Sie wird von Polizisten angehalten, die wissen wollen, was sie in der Innenstadt vorhat:»Sie «wissen also Bescheid. Susanne sitzt neben der schwangeren Frau und den anderen in einem kleinen Kreis vor dem Kino, sie halten brennende Kerzen in den Händen und schweigen. April bringt es nicht fertig, sich zu ihnen zu setzen, die ganze Aktion ist ihr zu pathetisch. Sie beobachtet, wie die Menschen überrascht stehen bleiben, ein Raunen breitet sich aus. Dann aber erscheinen plötzlich zwei Männer, springen in den Kreis, einfach so, und versuchen die Kerzen auszutreten. Die Männer sind wie normale Büroangestellte gekleidet und ihre Bewegungen wirken verkrampft. Wortlos zünden Aprils Freunde die Kerzen wieder an, reagieren nicht auf die provozierenden Sprüche, sie seien asozial und arbeitsscheues Pack. Die beiden Männer werden zunehmend nervös, trampeln wütend umher. Während Susanne und die anderen weiterhin still und gelassen ausharren, als hätten sie ein Schweigegelübde abgelegt, ist April aufs Äußerste angespannt. Ein großer Armeelaster hält vor dem Kino, Uniformierte springen heraus und rennen auf ihre Freunde zu, versuchen sie an Haaren, Armen, Beinen fortzuzerren. Noch mehr Uniformierte kommen angerannt, und als sie sieht, wie einer von ihnen auf die schwangere Frau einprügelt, ist April nicht mehr zu halten, sie springt dem Uniformierten auf den Rücken und verbeißt sich in seinem Nacken. Sie schlägt, kratzt, tritt, verliert sich in einem Wirbel aus angestautem Zorn, bis sie taumelnd zu Boden geht. Ihr Kopf dröhnt, ihre Unterlippe ist aufgeplatzt, mühsam rappelt sie sich auf und läuft davon. Sie läuft und läuft, findet sich am Ende in einem ihr unbekannten Viertel wieder.
Am nächsten Morgen ist sie noch immer außer Atem. Die Erlebnisse vom Vorabend kommen ihr unwirklich vor, doch ihr demoliertes Gesicht im Spiegel sagt etwas anderes. Hans reagiert kühl, du hast eine Familie, sagt er, sei vorsichtig, und was nützt uns der Ausreiseantrag, wenn du im Knast landest.
Später erfährt sie, dass Susanne und die anderen in Untersuchungshaft sitzen, und ihre Stimmung schlägt in Entsetzen um. Sie haben nur eine Kerze angezündet, nur eine Kerze.
Читать дальше