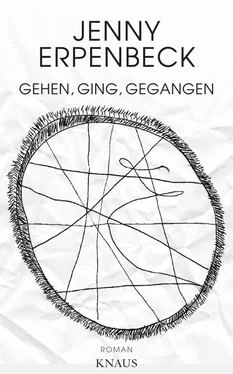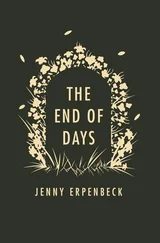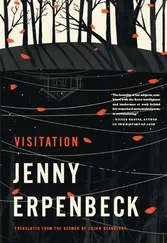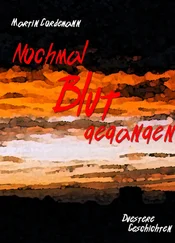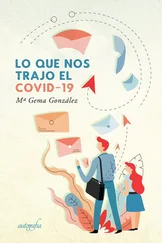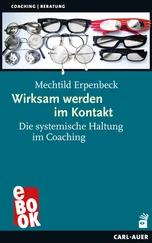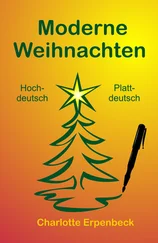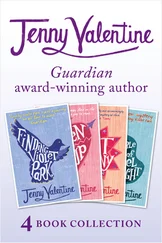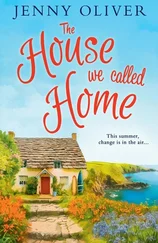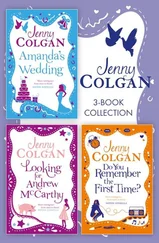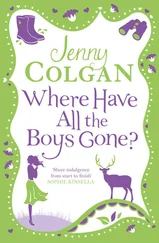Während er wenig später mit Karon ganz allein in einem langen Gang des Bezirksamts sitzt und darauf wartet, für Zimmer 3086 aufgerufen zu werden, fragt er: Wie also kauft man ein Grundstück in Ghana?
Karon wartet, bis die Schritte einer Beamtin, die auf Stöckelschuhen, einen dicken Aktenstapel unter dem Arm, gerade aus einer der vielen Türen herausgekommen ist und nun den Gang hinuntergeht, verklingen.
Auf dem Dorf, sagt er, weiß jeder, wem so ein Grund gehört und auch, wem er vielleicht vorher gehört hat, denn auf dem Dorf kennt von Geburt an jeder jeden. Der King muss zum Verkauf seine Einwilligung geben.
Der King?
Ja, sagt Karon. Dann bringt man drei Zeugen, die bei der Unterzeichnung des Vertrags dabei sind. Diese Zeugen erzählen, wenn ihre Kinder älter werden, den Kindern davon, wem das Grundstück gehört. Wenn die Eltern sterben, wissen die Kinder, wer der Eigentümer des Grundstücks ist.
Also wird die Zeugenschaft quasi vererbt?
Ja, sagt Karon.
Und woher weiß man, wie groß genau das Grundstück ist?
Es wird einfach gesagt: Von dem Baum dort bis zu jenem Stein, oder dem Haus, oder dem Fluss. Das können die Zeugen sich merken.
Frag doch einmal, ob es ein Grundstück in deinem Dorf gibt, das die richtige Größe für deine Familie hätte, sagt Richard.
Und dann geht die Tür des Zimmers 3086 auf und heraus schaut ein Beamter und sagt: Anubo, Karon?
Zwei Tage später bekommt Richard von einem Freund Karons das Foto eines Grundstücks geschickt: viel Grün, hier und da lehmige Erde, im Hintergrund ein paar Bäume. Im Vordergrund ist ein Schild aufgestellt, darauf steht mit Kohle geschrieben: Plot for sale , der Preis: 12 000 Ghanaische Cedi, darunter zwei Telefonnummern. Der alte Kaufvertrag, von dem auch ein Foto beigefügt ist, ist nicht einmal eine Dreiviertelseite lang — etwa so wie die Vereinbarung des Senats mit der Oranienplatz-Gruppe. Sharing common boundaries with the properties of Kwame Boateng, Alhassan Kingsley and Sarwo Mkambo. Gibt es das Grundstück wirklich? Wo liegt das Dorf überhaupt? Und wieviel wert ist ein Cedi?
Drei von den vier Unterzeichnern des vorigen Kaufvertrags haben ihren Finger in violette Tinte gedrückt und mit dem Abdruck unterschrieben.
Richard erinnert sich noch gut daran, wie er und seine Frau einige Jahre nach dem Mauerfall beschlossen, ihr Grundstück, das sie die ganze DDR-Zeit über gepachtet hatten, nun doch zu kaufen. Der oder jener ihrer Nachbarn war da schon in einen Prozess mit dem sogenannten Alteigentümer verwickelt, also demjenigen, dessen Familie das betreffende Grundstück bis zur Flucht aus der von den Russen besetzten Zone gehört hatte. Die Gesetzgebung des vereinigten Deutschlands knüpfte, wie bald allen DDR-Bürgern klar wurde, beim letzten Zeitpunkt, zu dem der Osten kapitalistisch organisiert war, an — also 1945. Aus eigentumsrechtlicher Sicht war das verständlich. Die Jahre zwischen 1945 und 1990 waren in diesem Teil Deutschlands ja nur ein nicht von Erfolg gekrönter Versuch gewesen, andere Besitzverhältnisse zu schaffen. Nun wurden die Grundbücher von 1945 wieder hervorgeholt, die Eintragungen vom Kriegsende einfach fortgesetzt und, wenn es sich nicht vermeiden ließ, um das bisschen Zeit dazwischen, das leider nicht anerkannt werden konnte, prozessiert. Im Computerdeutsch gab es für ähnliche Vorgänge eine Vokabel: undo — ein Wort, das ihn von seinem ersten IT-Kurs an fasziniert hatte. Undo , so als könnte man Zeit, die stattgefunden hat, wieder zurückdrehen, Erfahrungen ungeschehen machen, als könnte man beschließen, was vergessen sein sollte, was nicht, könnte programmieren, was Folgen hat — und was keine. Bis zum sogenannten Wendejahr ’89 hatten Richard und seine Frau das Wort Grundbuch ein ganzes Leben lang nicht ein einziges Mal gehört. Zu ihrem Glück war der Eigentümer, dem ihr Grundstück gehörte, weder vor noch nach dem Mauerbau in den Westen geflohen, er war einfach im Osten geblieben und freute sich nun, dass der Verkauf des Grundstücks an seine langjährigen Pächter glückte und ihm den Lebensabend in diesem unbekannten Land, das inzwischen sein eigenes war, mitfinanzierte. Richard und seine Frau hatten einen Kredit aufnehmen und dafür Gehaltsnachweise beibringen müssen, für die Übergabe des Geldes musste ein Treuhandkonto eröffnet, und zur Beratung, ob der Vertrag in Ordnung war, ein Notar aufgesucht werden. Das Ganze hatte mehrere Wochen gedauert, und selbst nach dem Besitzübergang , wie es hieß, trafen noch etliche Rechnungen ein, die sich auf den Verkauf bezogen und erst bezahlt werden mussten, bevor der Vertrag rechtsgültig war.
Nun schickte Richard sich also an, zum zweiten Mal in seinem Leben ein Grundstück zu kaufen, diesmal in Ghana, 10 000 Quadratmeter zum Preis von 3000 Euro in einem Dorf der fruchtbaren und regenreichen Region Ashanti, für Berliner Vorstadtverhältnisse so gut wie geschenkt. Wie lange würde es dauern, bis ein Grundstück in solcher Ferne tatsächlich dem neuen Besitzer gehörte? So wie Richard vor Jahren gehofft hat, dass die Bank ihm den Kredit in der beantragten Höhe bewilligen würde, hofft er nun, dass ein ghanaischer King seine Einwilligung zum Verkauf gibt. Richard stellt ihn sich als einen Häuptling mit Speer in der Hand und rasselnden Fußbändern vor, dabei weiß er doch: Wenn der King wirklich mächtig ist, trägt er sicher ein Trikot des Fußballvereins Barcelona .
Der King sagt Ja. Und so fährt Richard an einem grauen Berliner Tag Mitte Januar, 3000 Euro in Hunderter-Scheinen in die Innentasche seines Wintermantels gesteckt, mit der S-Bahn hinein in die Stadt — bar soll es sein, hat Karon gesagt — und geht dann mit Karon ein Stück die Straße entlang durch den Schneematsch, die Fußgängerampel ist rot, wird grün, Autos hupen, es schneit, ein Lottoladen, ein Laden für billige Mobiltelefone, ein Döner-Imbiss, und dann noch um zwei Ecken herum, Karon klopft an die Tür eines Ladens, dessen Rolläden heruntergelassen sind, die Tür geht auf und schlägt beim Aufgehen eine Glocke an, die sicher noch aus der Zeit stammt, als hier ein Metzger war oder ein Bäcker. Dann gehen sie über die Schwelle, aber was ist hier innen, was außen? Es ist neblig in dem Raum, oder rauchig, so dass es Richard nur allmählich gelingt, überhaupt etwas zu sehen. An Stecken ringsherum sind überall Zöpfe angebunden, in hölzernen Schalen sieht er hoch aufgehäuft seltsame Früchte, manche mit Stacheln, manche mit durchsichtiger Haut, manche sehen wie Eier aus, andere wieder wie Fleisch. Wie um einen Altar sind diese Früchte arrangiert, in der Mitte des Raumes aber sitzt eine Afrikanerin mit wirrem Haarschopf auf einem dreibeinigen Schemel, im Linoleumfußboden vor sich einen Spalt, aus dem Dämpfe aufsteigen. Ist da unten der aufgebrochene Bombenkeller? Junge Männer und Frauen lehnen schweigend an den mit bunten Stoffen bespannten Wänden und fächeln der Sitzenden mit großen trockenen Palmwedeln Luft zu, oder verteilen sie nur den Dampf, der aus dem Spalt aufsteigt, damit man überhaupt etwas sieht? Karon spricht mit einem der Männer, während die Frau mit dem wirren Haarschopf ihre Augen noch immer halb geschlossen hält und sich vor und zurück wiegt, dann übersetzt Karon für Richard, was der Mann ihm eben erklärt hat: Richard soll der Frau das Geld geben.
Richard sagt: Wie denn?
Just like this, sagt Karon, leg es ihr in den Schoß.
Richard nimmt den Umschlag mit den Geldscheinen aus der Innentasche seines Mantels und legt ihn der Frau in den Schoß, und die Frau, die Augen immer noch halb geschlossen, nimmt den Umschlag, und lässt ihn, so wie er ist, ohne das Geld darin zu zählen, den Arm ausgestreckt, in den Spalt hineinfallen.
Das Geld! ruft Richard und will das Geld noch erwischen, aber Karon hält ihn zurück und sagt:
Читать дальше