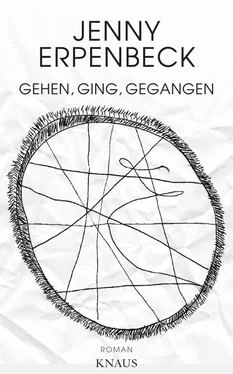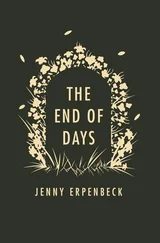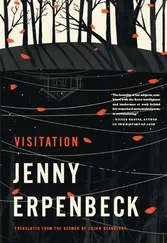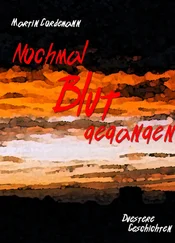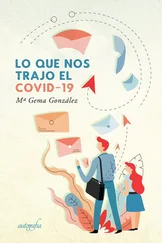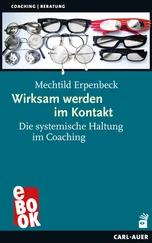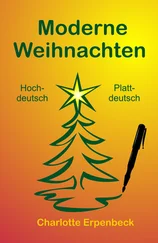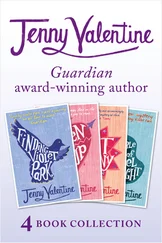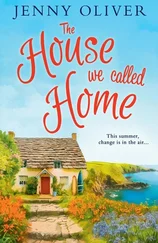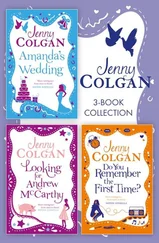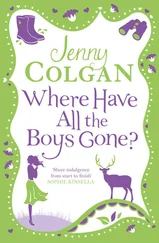Am Abend hört er in den Nachrichten, dass die in Berlin-Friedrichshain untergebrachten Flüchtlinge der Oranienplatz-Gruppe zum Protest gegen ihre Ausweisung aus Berlin seit gestern acht Uhr die oberste Etage ihres Hauses besetzt hätten, einige von ihnen seien aufs Dach gestiegen und drohten damit, sich hinunter zu stürzen. Es heißt, alle übrigen Etagen des Hauses seien geräumt und abgesperrt worden.
Als Richard am nächsten Morgen im Spandauer Heim eintrifft, ist nur Raschid in seinem Zimmer. Er liegt in seinem Bett, winkt Richard aber herein: How are you? Ja, die anderen seien im Friedrichshain, um die Freunde zu unterstützen, aber er könne einfach nicht mehr. Er hebt eine durchsichtige Plastiktüte in die Höhe, die voller Medikamentenschachteln ist.
Kennst du die, die auf dem Dach stehen? fragt Richard.
Klar, sagt Raschid, wir waren ja alle zusammen auf dem Oranienplatz. Die haben nichts zu verlieren.
Wie soll das alles denn weitergehen?
I don’t know. Dreimal hab ich in den letzten acht Wochen versucht, den Innensenator persönlich zu sprechen. Von Mann zu Mann. Three times.
Und?
Er hatte Sitzungen oder war nicht im Haus. Wir haben sogar schriftlich um einen Termin gebeten, aber er hat nie reagiert.
Einen Blitzeschleuderer antichambrieren zu lassen, ist sicher die hohe Schule der Diplomatie, denkt Richard. Ein ermordeter Vater und zwei ertrunkene Kinder machen einen Abschluss in Wirtschafts- und Sozialwissenschaft nicht wett, eine Gruppe von Flüchtlingen ist kein Volk, und ein Anführer, der sich für seine Leute einsetzt, kein Staatsoberhaupt. Das Praktische an einem Gesetz ist, dass niemand es persönlich gemacht hat und daher auch niemand persönlich dafür zuständig ist. Ein Politiker, der heutzutage an einem Gesetz dies und das ändern will, kann es natürlich versuchen, aber einer, der nichts ändern will, kommt ebensogut durch — und womöglich mit mehr Eleganz.
Vielleicht hätte man gestern auch hier in Spandau irgendeine Protestaktion machen müssen, sagt Richard.
Wir haben das überlegt, sagt Raschid. Aber hier sind doch die Kinder.
Verstehe, sagt Richard. Und dann sagt er eine lange Zeit nichts mehr.
In der Stille, die eintritt, fallen Raschid die Augen zu, er schläft ein.
Richard sitzt noch eine Weile neben ihm, so wie er vor Jahren neben seiner noch atmenden Mutter gesessen hat.
Irgendwann steht er auf, geht hinaus und zieht leise die Tür hinter sich zu.
Auf der Rückfahrt ruft Anne ihn an und sagt: Hast du schon von denen gehört, die auf dem Dach stehen und protestieren? Richard sagt: Ja. Einer der Flüchtlinge, sagt sie, hat von oben hinuntergepinkelt, alle regen sich fürchterlich darüber auf, weißt du das auch schon? Richard sagt: Nein.
Es ist schön, wenn es im Winter nach Schnee riecht. Frischem Schnee, der sich über das modrige Laub gelegt hat. Das Gartentor aufschließen, die Luft tief einatmen, so macht er es seit zwanzig Jahren, wenn er nach Hause kommt. Zwanzig Jahre lang war schon Winter in diesem Garten, hat es so gerochen, hat er so das Gartentor aufgeschlossen und hinter sich wieder zugeschlossen.
Richard weiß, dass er zu den wenigen Menschen auf dieser Welt gehört, die sich die Wirklichkeit, in der sie mitspielen wollen, aussuchen können.
Einen Tag später, so liest er in der Zeitung, wird den Dachbesetzern Strom und Wasser gesperrt. Richard sieht ein Foto, auf dem steht ein Mann mit ausgebreiteten Armen auf dem Dach, er sieht wie eine Vogelscheuche aus. Das Dach sei durch Frost und Schnee rutschig, die Situation prekär, sagt die Bildunterschrift. Richard fragt sich, ob die Geschwindigkeit, mit der man Menschen zugrundegehen lässt, etwas mit der Reputation eines Landes zu tun hat. Warum eigentlich der Sprung eines Flüchtlings von einem Dach für das Ansehen des Landes um so viel schlimmer wäre, als dessen langsames Vergehen in einem elenden Leben? Wahrscheinlich, weil in so einem Moment sicher ein Fotograf vor Ort wäre, um auf den Auslöser zu drücken. Oder besteht der Skandal darin, dass diese Männer über ihren Tod selbst bestimmen wollen, anstatt ihr unmöglich gewordenes Leben immer weiter von irgendeinem Land, das sie nicht haben will, verwalten zu lassen? Ist die Frage nach der Macht über das eigene Leben immer noch in erster Linie eine Frage der Macht? Und nicht die nach dem Leben? Obs edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern /des wütenden Geschicks erdulden oder, / Sich waffnend gegen eine See von Plagen, /Durch Widerstand sie enden?
Eine der größten deutschen Zeitungen schreibt im Internet einen launigen Artikel über die Flüchtlinge auf dem Dach: In Berlin sei eben immer was los. Richard liest: Wo hört der Protest auf und fängt die Erpressung an? Einen kurzen Moment versteht er diese Frage falsch und glaubt, mit Erpressung sei hier die Taktik der Polizisten gemeint, die Dachbesetzer durch das Abstellen von Strom und Wasser dazu zu zwingen, das Haus zu verlassen. Aber dann wird ihm schnell klar, dass stattdessen diejenigen, die ihr eigenes Leben zur Disposition stellen, als Erpresser bezeichnet werden. Die Leser der Zeitung loben den Artikel und beklagen sich in ihren Kommentaren allenfalls darüber, dass nur Flüchtlinge das Privileg haben sollen, auf einem Dach stehend, mit Selbstmord zu drohen. Und zu pinkeln natürlich.
Kaum in Deutschland, pinkelt der als ALLERERSTES vom Dach!
Als ALLERERSTES, denkt Richard, nunja, nach bald drei Jahren der Flucht und des Wartens.
Haben Sie die Herrschaften der» Flüchtlingsszene «und ihre Unterstützer schon jemals irgendwo geregelt arbeiten oder Werte schaffen gesehen? Ich jedenfalls nicht.
Ihnen das Arbeiten zu verbieten und ihnen gleichzeitig Untätigkeit vorzuwerfen, ist, findet Richard, rein gedanklich eine gewagte Konstruktion.
Geschildert wird in dem Artikel dieser wichtigen Zeitung, sozusagen dem Zentralorgan des neuen Deutschlands, auch das Leben und Treiben der Sympathisanten, die vor dem Haus ein Solidaritätscamp eingerichtet haben: Sie singen, sie tanzen, sie halten Fürbitten ab. Die Männer auf dem winterlichen Dach seien im Grunde genommen nur Opfer dieser Sympathisanten, würden für deren politische Ziele instrumentalisiert, nur fehle es ihnen an Intelligenz und Durchblick, um das zu erkennen. Richard erinnert sich an den jungen Mann mit dem Plakat, den er auf der Demonstration gesehen hat: Hoch leben die Schwulen und Lesben von Kenia! Wahrhaftig, Richard, ebenso wie die anderen Leser dieser wichtigen deutschen Zeitung beim Frühstück sitzend, in einem warmen Haus, vor sich Toast, Tee, Orangensaft, Honig und Käse, Richard sieht wahrhaftig eine düstere Zukunft über Deutschland heraufziehen, sollte sich dieser Unterstützer mithilfe der Flüchtlinge, die aus jugendlichem Übermut und politischer Verblendung auf dem Dach stehen und pinkeln, ins Kanzleramt putschen.
Dass ihn bei der unerquicklichen Lektüre dieser Kommentare eine Nachricht von Karon unterbricht, kommt Richard gelegen.
Hi, schreibt der Dünne, how are you?
Richard schreibt zurück: Fine, how are you?
Es stellt sich heraus: Der Dünne hat einen Termin auf dem Bezirksamt.
Richard schreibt: Hast du jemanden, der dich begleitet?
Karon schreibt zurück: I have no body.
No body , schreibt er wirklich: Ich habe keinen Körper, statt nobody : niemand, und Richard denkt unwillkürlich wieder an die Toten auf Urlaub . Schon oft hat er gedacht, dass alle Männer, die er hier kennengelernt hat, genauso auch am Grund des Mittelmeers liegen könnten. Und umgekehrt, dass all diejenigen Deutschen, die während des sogenannten Dritten Reichs umgebracht wurden, Deutschland als Geister noch immer bewohnen, all die Fehlenden und auch deren ungeborene Kinder und Kindeskinder gehen, denkt Richard manchmal, neben ihm auf der Straße, sind unterwegs zur Arbeit oder zu Freunden, sitzen unsichtbar in den Cafés, spazieren, kaufen ein, besuchen Parks und Theater. Gehen, ging, gegangen. Die Trennlinie zwischen Geistern und Menschen war für ihn, und er weiß nicht, woran das liegt, schon immer sehr dünn, mag sein, weil er selbst damals, als Säugling, in den Wirren des Kriegs so leicht hätte verlorengehen und ins Totenreich abrutschen können.
Читать дальше