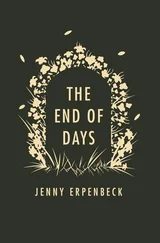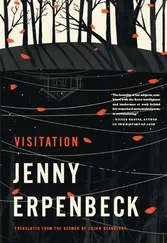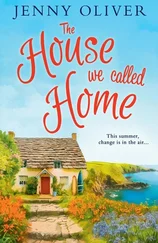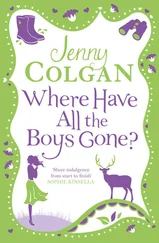Nur Gott kann mich beurteilen.
Diejenigen der Männer, die ein Telefon mit Internetzugang haben, schicken sich, das weiß Richard inzwischen, über einen Dienst, der nichts kostet, Nachrichten, Fotos und Tonaufnahmen. Sie stellen Profilfotos ein und schreiben in einer sogenannten Statusanzeige , wie es ihnen gerade geht. Manche ändern diese Statusanzeige täglich, bei anderen bleibt sie über Wochen und Monate hinweg gleich.
Ich vermisse die Zeit mit meinem besten Freund Bassa.
Mach dir keine Sorgen, was andere von dir denken.
Bin in der Schule.
Vor einiger Zeit hat Richard begonnen, sich diese Zeilen herauszuschreiben. Manchmal, wenn einer von den Männern in ein Berliner Mädchen verliebt ist, das ihn aber keinesfalls heiraten will, steht da nur:
Ich will einfach mit dir zusammen sein.
Aber manchmal stehen dort auch solche Dinge wie:
Bleib dir selbst treu.
Oder:
Der Fehler liegt in der Auswahl.
Darf ich dich etwas fragen? sagt er in der Woche vor dem vierten Advent zu Apoll.
Aber ja.
Wie kannst du dir so ein teures Handy und einen Internetzugang leisten?
Ich hab keine Familie. Ich hab niemanden, dem ich Geld schicken muss.
Richard sieht auf dem Kühlschrank noch immer den Teller stehen, der mit Silberpapier abgedeckt ist. Vor zwei Tagen stand der schon da, und Apoll hatte auf Richards Frage hin das Silberpapier angehoben, um Richard zu zeigen, was er gekocht hat. Auf dem Teller war etwas wie Couscous gewesen, eine flache Portion, von der erst ein Viertel gegessen war. Richard hatte an die hochaufgetürmten Portionen denken müssen, die ihm Ithemba immer hinstellte, wenn er zu Besuch kam.
Das reicht für ein paar Tage, hatte Apoll gesagt.
Dieser eine Teller?
Ja. Wenn man mehr isst, wird man wie ein Säugling.
Wie ein Säugling?
Zu verwöhnt.
Verstehe.
Man kann doch nie wissen, was kommt. Es kann sein, man muss wieder hungern oder hat nichts zu trinken, dann muss man das aushalten können.
Im Fernsehen hat Richard einmal einen Bericht über ein jüdisches Berliner Mädchen in der Nazizeit gesehen, das schon wusste, dass es bald nach Osten deportiert werden würde, und deshalb bei zwölf Grad Minus mit Halbschuhen zur Schule ging statt mit Stiefeln: Ich will mich abhärten für Polen , schrieb es in einem Brief an seine Eltern. Daran hatte Richard denken müssen, als Apoll ihm vor zwei Tagen den Teller mit der flachen Portion gezeigt hatte, von der erst ein Viertel gegessen war, und daran denkt er nun wieder, als er sieht, dass der Teller noch immer dasteht, der Teller, von dem Apoll pro Tag wie vom Zifferblatt einer Uhr nur je eine Viertelstunde aufisst.
Ich hab keine Familie. Ich hab niemanden, dem ich Geld schicken muss.
Richard hat Apoll auch noch nie etwas anderes als Wasser trinken sehen. Wasser aus dem Wasserhahn, ohne Sprudel. Keiner von den Männern trinkt hier je Alkohol. Keiner raucht. Keiner von ihnen hat eine eigene Wohnung oder auch nur ein eigenes Bett, die Kleidung stammt aus der Kleidersammlung, es gibt kein Auto, keine Stereoanlage, keine Mitgliedschaft in einem Sportclub, keinen Ausflug, keine Reise. Es gibt keine Frau und keine Kinder. Und auch keine Aussicht auf eine Frau oder auf Kinder. Tatsächlich ist das einzige, was jeder von den Flüchtlingen besitzt, ein Handy, manche haben eines mit zersplittertem Display, manche ein neueres Modell, manche eines mit Internetzugang, manche eins ohne — aber jeder besitzt irgendeines. Broke the memory, hat Tristan gesagt, als er Richard davon erzählt hat, wie die Soldaten die Speicherkarten der Mobiltelefone aller Gefangenen zerbrochen haben, damals in Libyen.
Verstehe, sagt Richard.
Es könnte sein, erzählt ihm Tristan, dass der Freund seines Vaters vielleicht doch noch lebe und nach Burkina Faso geflüchtet sei. Ein Bekannter habe ihm eine Nachricht geschickt. Der Name sei tatsächlich derselbe, und nun hoffe er darauf, dass der Bekannte ihm die Telefonnummer dieses Mannes beschaffe. Burkina Faso. Wenn der Freund meines Vaters doch noch am Leben wäre —, sagt Tristan und hört mitten im Satz auf.
Raschid sagt: Seit dreizehn Jahren habe ich meine Mutter nicht mehr gesehen, nur manchmal, wenn wir über Facebook telefonieren. Hat sie einen Computer? Nein, aber einer der Nachbarn. Raschid setzt sich bei diesen Telefonaten dann so hin, dass seine Mutter die Narbe über seinem Auge nicht sehen kann. Wie geht es dir, Junge? Gut. Manchmal gehe ich auch nicht ans Telefon, wenn sie anruft, sagt Raschid — es bewegt sich hier ja nichts seit zwei Jahren, was soll ich ihr sagen.
Für Khalil, sagt Raschid, versuche ich seit zwei Jahren, über Facebook seine Eltern wiederzufinden. Neulich, sagt Raschid, hat er wieder bei mir im Zimmer gesessen und geweint. Richard muss an die Zeichnung von Khalil denken: Ein Boot, wie eine Mondsichel flach, und darunter sehr, sehr viel Wasser.
Richard merkt bei jedem seiner Besuche, dass die Männer in den paar Funkwellen mehr zu Hause sind, als in irgendeinem der Länder, in denen sie auf eine Zukunft warten. Ein Netz aus Zahlen und Kennwörtern spannt sich quer über die Kontinente und ersetzt ihnen nicht nur das, was für immer verloren gegangen ist, sondern auch den Neuanfang, der nicht stattfinden kann. Das, was ihnen gehört, ist unsichtbar und aus Luft.
An meinem Telefon hat Raschid mich wiedererkannt, sagt der Dünne. Sein Mobiltelefon ist aus billigem Kunststoff, mit Klebeband zusammengehalten, pinkfarben, ein abgelegtes Mädchentelefon. Ich habe es seit Lampedusa, seit bald drei Jahren, sagt er, und hebt es in die Höhe. Aber jetzt hat es manchmal einen Wackelkontakt. Im Verzeichnis hat er italienische, finnische, schwedische, französische, belgische Telefonnummern — von afrikanischen Freunden, die so wie er durch Europa irren: die ursprünglich auch aus Ghana sind, oder in Libyen auf derselben Baustelle gearbeitet haben, oder bei der Überfahrt mit ihm auf demselben Boot waren, die er in Lampedusa, im Camp, auf irgendeinem Bahnhof, in irgendeinem Caritasquartier kennengelernt hat. Alles Freunde, die, weil sie keine Arbeit haben, auch keine Wohnung haben und damit keine Adresse, die nirgends gemeldet sind, und deren Vor- und Nachnamen auf den Behelfsausweisen in lateinischen Buchstaben nur annäherungsweise richtig notiert sind.
Wie sollte ich sie ohne Telefonnummer je wieder finden?
Der dünne Mann, der heute den Besen nicht dabei hat, lehnt an der Tür zur Terrasse, das schwarze Rechteck in seinem Rücken verbirgt das, was bei Tageslicht ganz selbstverständlich der Garten genannt wird.
Mein bester Freund und ich, sagt er, haben bei der Ankunft in Europa beschlossen, jeder seinen eigenen Weg zu gehen. Wir dachten uns, vielleicht hat wenigstens einer Glück und kann dann später dem anderen helfen.
Richard denkt an Grimms Märchen, die er als Kind so gern gelesen hat: Von den Brüdern, die von ihrem Vater ausgesandt werden, um ihr Glück zu machen, um eine schöne Königstochter zu finden, um Aufgaben zu lösen und sich ihr Erbe zu verdienen. Die dem Pfeil folgen, den ein jeder von ihnen in eine der vier Himmelsrichtungen abgeschossen hat, Prinzen, die sich an einer Wegkreuzung trennen, oder die der Vater auf Pferde setzt, den ältesten auf ein schwarzes, den mittleren auf ein rotes, den jüngsten Sohn aber auf ein weißes Pferd, um sich zu bewähren. Eines Tages dann kehren sie heim, abgeschlagene Drachenhäupter und Gold im Gepäck, sie sind Männer geworden, haben vor sich im Sattel die Braut. Oder aber sie bleiben aus, verzaubert durch einen Bann, in Erwartung der Erlösung durch einen andern der Brüder, bis dahin in ein Tier verwandelt im fremden Wald, oder versteinert, oder zungenlos, oder zerstückelt im Hexenkochtopf. In diesen Märchen war die Welt immer das, was an einer Kreuzung, einer Weggabelung begann: Die Geschichte führte von da aus nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. In diesen Märchen blieb die Erlösung nie aus. Wenn das Schwert rostig wird, wisst ihr, dass ich in Not bin. Ein Prinz braucht keinen Pass. Es ist noch gar nicht so lange her, denkt Richard, da war die Geschichte der Auswanderung und der Suche nach Glück eine deutsche Geschichte.
Читать дальше