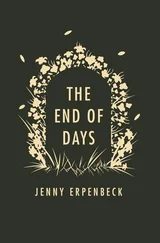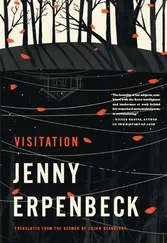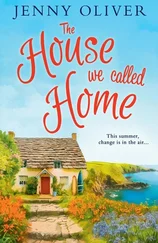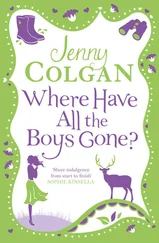Und dann soll es losgehen: der erste Ausflug in eine richtige deutsche Schule, geradenwegs in die Zukunft hinein. Ein Betreuer fragt, ob jeder ein Ticket dabei hat, und da erst fällt Richard auf, dass doch einer noch fehlt: Rufu, der Mond von Wismar. Ja, aber jetzt ist es zu spät, sagt ein Betreuer, wir müssen. Richard notiert sich eben noch den Namen der Schule, da setzt sich auch schon die festliche Prozession in Gang: Häuptlinge und Prinzen mit stolzem Blick, um den Hals Ketten aus Kaurimuscheln, wippende Pfauenfedern auf dem Kopf, in schimmernde Gewänder gehüllt, verlassen den glänzenden Palast, Freudentriller erfüllen die Luft, das Tor öffnet sich wie von Zauberhand, zahme Antilopen und ein Einhorn schließen sich der Delegation an, den Abschluss des Zuges aber bilden drei weiße Elefanten: auf deren gewaltigen Rücken schaukeln in edelsteinbesetzten Sitzen die drei Betreuer. Noch bis der prächtige Zug am Horizont entschwunden ist, sieht man die Diener, die das Tor für all die Herrlichkeit aufgemacht haben, mit den Stirnen im Staub.
Ohne dass Richard lange darüber nachdenken müsste, klopft er im zweiten Stock bei Zimmer 2018 an: bei der Tür, die ihm noch nie einer aufgemacht hat, auf dem Schild draußen steht der Name Heinz Kröppcke . Und wenn Rufu nun gar nicht mehr lebt? Wenn ihn, der immer allein ist, nicht einmal jemand vermisst? Richard drückt die Klinke vorsichtig hinunter, aber die Tür von Heinz Kröppcke ist zu. Rufu, ruft er in den Flur hinein, auf gut Glück. Rufu. Geht den Flur hinunter. Rufu. Und da öffnet sich ganz am Ende des Gangs, kurz vor der Küche, in der er neulich noch zusammen mit der Lehrerin das Bode-Museum aufgehängt hat, eine Tür, und heraus schaut tatsächlich Rufu, der Mond von Wismar. Dante? fragt er.
Nein, sagt Richard, heute beginnt der Deutschunterricht in einer richtigen Schule. Komm.
Rufu sieht ernst aus, wie immer, aber er nickt und sagt: Un attimo, bevor er die Tür wieder schließt und fünf Minuten später in Jacke und Mütze erscheint.
Ob sie wirklich um soviel schneller sind mit dem Auto, weiß Richard nicht, aber er hofft es. Erst nach dem Tod seiner Frau hat er sich ein Navigationsgerät gekauft, denn bis dahin hatte sie, seine Frau Christel, den Atlas auf den Knien, immer auf dem Beifahrersitz gesessen und ihm gesagt, wann er rechts fahren sollte, wann links. Christel. Der Name ist noch lebendig, nur der Mensch nicht mehr, zu dem der Name gehört. Jetzt sagt eine Frauenstimme, mit der er nicht verheiratet ist, zu ihm: Biegen Sie rechts ab, biegen Sie links ab. Auf einer Fahrt nach Rügen hat diese Stimme ihm zum ersten Mal gute Dienste geleistet, das zweite Mal auf einer Fahrt nach Weimar.
Hast du Autofahren gelernt? fragt Richard den stillen Rufu, der neben ihm sitzt.
Nein.
Die ersten drei roten Ampeln braucht Richard, um die Adresse einzugeben, dann sagt die Frau in dem kleinen Gerät plötzlich: Drehen Sie, wenn möglich, um. Die Frau denkt wohl immer noch, er sei auf der Rückfahrt von Weimar.
Rufu zuckt zusammen und fragt: Was ist das?
Sie sagt mir, wie ich fahren soll.
Aha, sagt Rufu und runzelt die Stirn.
Nach 80 Metern fahren Sie geradeaus.
Wozu brauchst du das? fragt Rufu und zeigt noch einmal auf das Navigationsgerät.
Ich kenne mich im Westen nicht so gut aus, sagt Richard, dann fällt ihm wieder sein Gespräch mit Osarobo ein.
Fahren Sie geradeaus.
Weißt du , dass zwischen dem Westen und dem Osten von Berlin beinahe dreißig Jahre lang eine Mauer war?
Nein, sagt Rufu.
Richard kennt die Untiefen dieses Dialogs jetzt schon, deswegen sagt er nur:
Es gab eine Grenze, und es war nicht erlaubt, vom Osten in den Westen Berlins zu gehen. Bei dem Versuch, über die Grenze zu kommen, wurden manchmal sogar welche erschossen.
Ah, capisco, man wollte sie im Westen nicht haben.
Nein, man wollte sie aus dem Osten nicht rauslassen.
Okay.
Nach 200 Metern halten Sie sich rechts, sagt jetzt die weibliche Stimme des Navigationsgeräts, die in der Gebrauchsanleitung sogar einen Namen hat, an den Richard sich aber nicht erinnert. Annemarie vielleicht, oder Regina.
Aber wenn sie es geschafft haben, haben sie dann im Westen einen Pass bekommen?
Ja, ohne Probleme. So, als ob sie schon immer Bürger im Westen gewesen wären.
Warum?
Halten Sie sich rechts.
Weil sie Deutsche waren. Brüder und Schwestern, sagt Richard und denkt wieder an das Gedränge aus weinenden West- und Ostberlinern, durch das er sich nach der Öffnung des Grenzübergangs den Weg hatte bahnen müssen.
Es waren alles Brüder und Schwestern?
Nein, natürlich nicht. Also manche schon, aber nicht alle.
Okay, sagt Rufu, aber Richard sieht, dass Rufu nicht wirklich versteht, was es mit dem Westen und dem Osten und den Brüdern und Schwestern und dieser Mauer, die es da offenbar gegeben hat, auf sich haben soll.
War die Mauer so hoch wie der Zaun in Melilla?
So ungefähr, sagt Richard.
Einen Freund von mir haben die Spanier gleich wieder nach Marokko zurückgeschickt, sagt Rufu. Obwohl er es über den Zaun geschafft hat. Sein Bruder lebte in Spanien. Aber trotzdem.
War sein Bruder Spanier?
Nein.
Na, siehst du.
Was sehe ich?
Ja, was soll Rufu eigentlich sehen? Annemarie oder Regina hat in diesem Moment auch keine Antwort auf Rufus Frage parat, sie sagt nur: Abbiegung vor Ihnen.
Richard überlegt, ob er Rufu erklären soll, dass hinter den Bäumen das Sowjetische Ehrenmal ist, entscheidet sich aber dagegen. Soll er etwa auf Italienisch erklären, was schon auf Deutsch schwer zu verstehen ist, nämlich dass dort ein sowjetischer Soldat ein deutsches Kind auf dem Arm trägt, zum Zeichen eines Neubeginns nach dieser letzten Schlacht des Weltkriegs, bei der 80 000 sowjetische Soldaten für die Befreiung eines Berlins, das gar nicht hatte befreit werden wollen, gefallen sind? Und dass die sowjetischen Soldaten Helden gewesen sind. Einerseits. Richard weiß nicht, was Vergewaltigung auf Italienisch heißt.
Fünfhundert Meter weiter überqueren sie die unsichtbare Linie auf dem Asphalt, die früher die Grenze war, und fahren bald darauf an einem Wachturm vorüber, der als Relikt aus der Zeit der Grenze mitten in einem Park steht, auf dem Gelände, wo früher die Spanischen Reiter aufgestellt und die Minen im Sand versteckt waren.
Auch dazu sagt Richard nichts.
Ein wenig ist es so, denkt er, als sei Rufu krank oder schwerhörig, und er, Richard, sein Besucher, der sich nicht die Mühe macht, die Sätze, die ein Gespräch in Gang bringen könnten, zu sagen. Zuviel müsste erklärt werden. Zuviel fehlt.
Wenig später ist immerhin wieder Annemarie oder Regina zu hören: Biegen Sie links ab.
Draußen sieht man jetzt eine Kirche, einen Taxistand, eine restaurierte Feuerwache, Häuser aus dem letzten Jahrhundert.
Rufu sagt: Das ist schön.
Wieso warst du nie hier? Der Oranienplatz ist doch gar nicht so weit entfernt.
Die U-Bahn fährt unter der Erde, da sieht man nicht, wo man ist.
Verstehe.
Sotto terra, sagt Rufu. Sotto terra.
Sie kommen gerade noch rechtzeitig in der Schule an, die Betreuer stehen mit dem Leiter der Schule im Flur und sprechen über Termine. Der eine zeigt, als er Richard und Rufu sieht, mit dem Zeigefinger auf eine Tür. Tatsächlich sitzen da in einem großen Raum die afrikanischen Männer schon an den Tischen. Ein Zettel mit Fragen soll ausgefüllt werden, damit die Lehrerin, die die Einteilung macht, weiß, wer von den Männern überhaupt lateinische Buchstaben lesen und schreiben kann. Das Eingeständnis, nicht schreiben zu können, kommt Richard in dieser Welt, die das Schreiben voraussetzt, kaum weniger intim vor als das Ablegen der Kleider bei einem Arzt, er will gleich wieder gehen, aber dann fragt ihn Tristan, ob er hier etwas eintragen muss? Und Osarobo hat keinen Stift. Und die schon etwas ältliche Lehrerin versteht das afrikanische Englisch so schlecht. Könnten Sie vielleicht noch so nett sein, mir nachher beim Einsammeln der Zettel zu helfen, nur wegen der Namen? Ja, sicher. Und so setzt er sich auf einen Stuhl an den Rand, während die Männer ganz still sind und jeder versucht, den Zettel so gut auszufüllen wie möglich, und die ältliche Lehrerin an ihrem Tisch sitzt und leise ihre Papiere sortiert.
Читать дальше