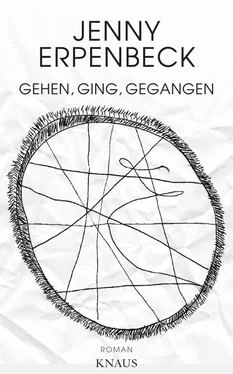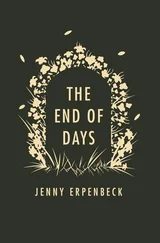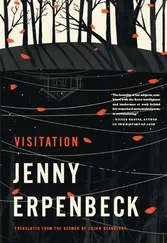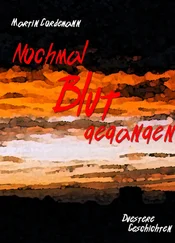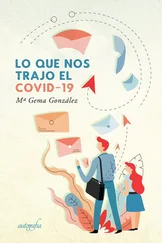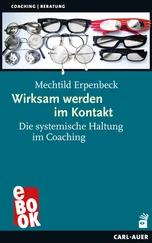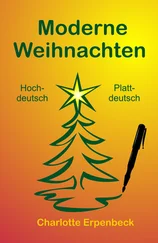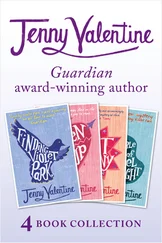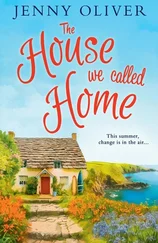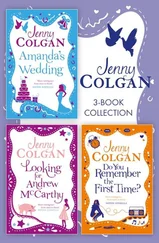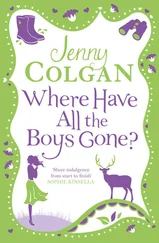Auch wenn einer reich und vermögend ist,
ist der Tod ihm nahe.
Der Tod ist größer als die Zeit, er umfängt sie.
Gerade jetzt sendet er seine Pfeile aus, sie gehen nieder
in die Mitte der Herde.
Aus dem heutigen Syrien, vielleicht sogar aus dem Kaukasus, sollen die Vorfahren der Tuareg vor über 3000 Jahren über Ägypten nach Nordafrika gekommen sein, das in der Antike im ganzen Libyen hieß, also auch das heutige Tunesien und Algerien umfasste. Von dort sind sie im Laufe der Zeiten dann weiter west- und südwärts gezogen: bis nach Timbuktu, Agadez, Ouagadougou.
Richard liest, und während er liest, verrückt sich für ihn plötzlich auch der griechische Götterhimmel, der doch eigentlich sein Spezialgebiet ist, und er versteht plötzlich neu, was es bedeutet, dass sich für die Griechen das Ende der Welt da befand, wo heute Marokko ist, am Atlasgebirge, dort stemmte Atlas Himmel und Erde auseinander, damit Uranus nicht wieder in Gaia hineinstürzt und ihr Gewalt antut. Die Gegenden, die heute Libyen, Tunesien, Algerien heißen, waren in der Antike das Gebiet vor dem Ende der Welt, also die Welt. Auf libyschem Sand stand der Sohn der Gaia, der Gigant Antaeus, der seine Kraft aus der Verbindung mit seiner Mutter, der Erde, schöpfte — und erst besiegt wurde, als Herakles ihn aufhob und so lange in der Luft hielt, bis die Verbindung des Antaeus mit seiner Mutter erlosch. Die eulenäugige Athene, von manchen Wissenschaftlern sogar als schwarze Göttin bezeichnet, wuchs bei ihrem Ziehvater Triton am Ufer des Tritonsees auf, im heutigen Tunesien. Die Amazonen, die Athene als erste verehrten, ursprünglich Amazigh genannte kriegerische Berberfrauen, tanzten am Ufer dieses Sees, von dort aus auch zogen sie in den Kampf — und sprachen Tamashek, die gleiche Sprache wie der, den Richard vor einigen Wochen, noch ganz in Verkennung der mythischen Lage, Apoll genannt hat: der Flüchtling aus Zimmer 2019.
Richard liest.
Auch Medusa, die Gorgone mit den sich ihr auf dem Kopf windenden Schlangenhaaren, die jeden, der sie ansah, durch ihren Blick in Stein verwandelte, sei, heißt es, einmal ein schönes libysches Berbermädchen und eine erfolgreiche Kriegerin gewesen. Erst nachdem Poseidon, der Gott des Meeres, am libyschen Ufer ausgerechnet in einem Tempel Athenes mit der Schönen geschlafen hatte, habe die empörte Göttin der Amazone die Schreckensgestalt verliehen und später Perseus den spiegelnden Schild gegeben, mit dem dieser dem tödlichen Blick der Gorgone ausweichen und ihr so, ohne zu Stein zu werden, endlich den Kopf abschlagen konnte. Noch aus den Blutstropfen, die bei der Enthauptung der Medusa in den libyschen Sand fielen, seien Schlangen geworden, liest Richard. Nein, es ist sicher kein Zufall, dass den Frauen der Tuareg auch heute noch die Viehherden und die Zelte gehören, dass sie sich die Männer aussuchen und sich scheiden lassen können, wie es ihnen beliebt, dass sie unverschleiert, die Männer aber verschleiert gehen, dass die Frauen die Erbfolge begründen und auch heute noch berühmt sind für ihre Dichtkunst und ihre Lieder, dass sie es sind, die ihre Kinder die Schrift lehren, und zwar dieselbe Schrift, die schon Herodot mit eigenen Augen gesehen hat.
Vieles von dem, was Richard an diesem Novembertag, einige Wochen nach seiner Emeritierung, liest, hat er beinahe sein ganzes Leben über gewusst, aber erst heute, durch den kleinen Anteil an Wissen, der ihm nun zufliegt, mischt sich wieder alles anders und neu. Wie oft wohl muss einer das, was er weiß, noch einmal lernen, wieder und wieder entdecken, wie viele Verkleidungen abreißen, bis er die Dinge wirklich versteht bis auf die Knochen? Reicht überhaupt eine Lebenszeit dafür aus? Seine — oder die eines andern?
Wenn er sich den Weg ansieht, den die Berber vielleicht genommen haben: vom Kaukasus über Anatolien und die Levante bis nach Ägypten und ins antike Libyen, später dann in den heutigen Niger und vom Niger wieder zurück ins heutige Libyen und über das Meer bis nach Rom und Berlin, ist es beinahe ein vollkommener dreiviertel Kreis. Tausende von Jahren dauert die Bewegung der Menschen über die Kontinente schon an, und niemals hat es Stillstand gegeben. Es gab Handel, Kriege, Vertreibungen, auf der Suche nach Wasser und Nahrung sind die Menschen oft dem Vieh, das sie besaßen, gefolgt, es gab Flucht vor Dürre und Plagen, Suche nach Gold, Salz oder Eisen, oder es konnte dem Glauben an den eigenen Gott nur in der Diaspora die Treue gehalten werden, es gab Verfall, Verwandlung, Wiederaufbau und Siedler, es gab bessere oder schlechtere Wege, niemals aber Stillstand. Um einem Studenten zu erklären, dass er damit nicht einmal ein moralisches, sondern vielmehr ein Naturgesetz meine, hätte Richard nur aus dem Fenster zeigen müssen, wo so viele der Blätter, über deren Erscheinen er sich im Frühjahr gefreut hat, nun schon auf dem Gras liegen, indes die Knospen für den nächsten Frühling schon angelegt sind. Aber es gibt keinen Studenten hier, der ihn danach fragt.
Richard liest.
Von den verlorenen Städten der Garamanten liest er, von ihren verwehten Burgen und ausgeklügelten Bewässerungssystemen unter der Erde in den einstmals dicht besiedelten Oasen am Beginn der Handelsstraßen, die durch die Wüste nach Süden führten. Nun, nach Gaddafis Sturz sei endlich durch Satellitenbilder erwiesen, dass es sich bei den libyschen Ureinwohnern nicht um Räuber am Rande der Zivilisation, sondern um Menschen gehandelt habe, die technologisch auf der Höhe ihrer Zeit gewesen seien, heißt es auf der Website der Übergangsregierung. Die Website ist schon zwei Jahre alt, sieht Richard. Jetzt hoffe man, so heißt es weiter in dieser zwei Jahre alten Gegenwart, auf einen Neubeginn für die libysche Altertumsforschung, die unter Gaddafi sträflich vernachlässigt worden sei. Bald schon werde es für das libysche Volk zum ersten Mal die Möglichkeit geben, sich mit seiner lange unterdrückten, ureigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Im Moment sei zwar der die Forschungen leitende Professor aufgrund der Unruhen evakuiert, aber sobald die Sicherheit im Lande wiederhergestellt sei, werde er mit seinen Untersuchungen, finanziert durch europäische Gelder, beginnen. Richard wohnt ja nun in dieser inzwischen schon zwei Jahre alten Zukunft und weiß daher, dass Libyen seit dem Sturz Gaddafis durch die verschiedenen Milizen, deren Ziele niemand mehr durchschaut, vollends in ein Schlachtfeld verwandelt worden ist. Das libysche Volk ist seit zwei Jahren durchaus nicht damit befasst, seine ureigenen, vorislamischen Wurzeln zu ergründen, sondern ausschließlich damit, zu überleben. Gaddafi hatte den landeseigenen Altertumsforschern zwar nur kärgliche Gelder für ihre Forschungen bewilligt, das mochte wahr sein, aber jetzt hatten auch die Europäer ihre Förderungen eingefroren, und die Altertumsforscher saßen wahrscheinlich seit zwei Jahren im Exil, während die Burgen, Städte und Dörfer der Garamanten allenfalls von uniformierten Antiquitätenjägern erforscht und all der Dinge beraubt wurden, die sich zu Geld machen ließen. Die Nachfahren der Garamanten wurden im heutigen Libyen als Ausländer angesehen und waren deshalb genauso wie alle anderen Ausländer vor zwei Jahren in Boote gesetzt und nach Europa gejagt worden. In welchen Zeiträumen muss man messen, wenn man wissen will, was Fortschritt genannt werden kann?
Richard liest und liest.
Und deswegen hat er noch nicht einmal zu Mittag gegessen, als das Telefon klingelt und seine Freunde ihm vorschlagen, einen Spaziergang mit ihnen zu machen. Es werde ja schon bald wieder dunkel, sagt Sylvia. Und Detlef ruft aus dem Hintergrund: Thomas kommt auch mit.
Thomas muss nicht das ganze Wochenende zu Haus sein?
Nein, seine Frau hat Besuch von ihrer Cousine.
Der dicke Thomas, früher Wirtschaftsprofessor, inzwischen Computerspezialist, steckt sich beim Gehen eine Zigarette an.
Читать дальше