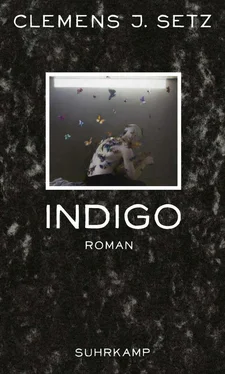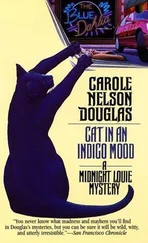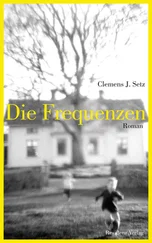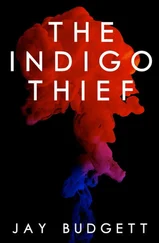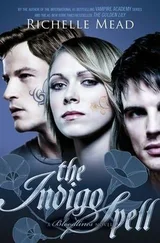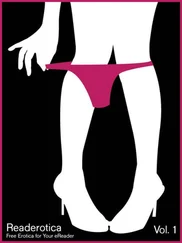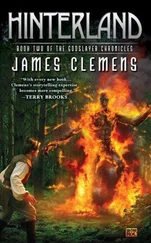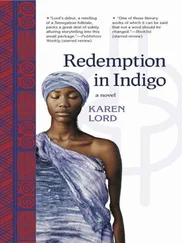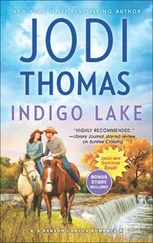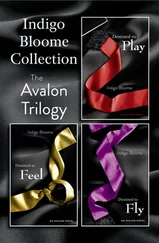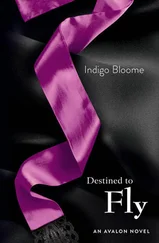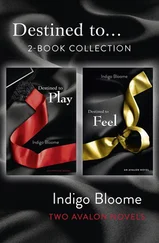Er suchte die Visitenkarte des Mannes, der ihn im Bankfoyer angesprochen hatte. inter_f@apuip.eu. Dann zerriss er sie und ging ins Nebenzimmer, um irgendetwas zu finden, das er kaputtmachen und wieder reparieren konnte, bevor Cordula nach Hause kam.
7 Romeo und Julia im Institut
Es gebe natürlich schon einige, na ja, wie soll man sagen, äh, Romeo-und-Julia-Tendenzen unter den Schülern, so Dr. Rudolph, das sei auch ganz normal und erwartbar, wenn die Hormone einen entsprechenden Wert in den Individuen erreichten. Und gerade jetzt, wo es langsam wieder Sommer werde, sei die Luft zudem auf diese außergewöhnliche Weise gesättigt mit Stoffen, die einem die Anwesenheit des eigenen Körpers quasi den ganzen Tag unter die Nase reiben. Pollen, Blumen und Gräser, die Hitze selbst, die Schweiß und Verunreinigung der Poren und eine Überallverbreitung des Eigengeruchs mit sich bringe. Es sei absolut normal, dass sich gerade in dieser Zeit oft besonders intensive Empfindungen in den jungen Menschen herausbildeten. Man müsse als Erzieher dieser Umstände immer gewärtig sein, ihnen gewissermaßen mit ruhigem Auge entgegenblicken, denn die Natur habe vorgesorgt, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, sogar eine Allergie, wie sie viele der Institutskinder in diesen Monaten befalle, sei die ständige Erinnerung daran, dass man einen Körper besitze, der, unwillkürlich und ohne sich um die Wünsche und den Willen seines Besitzers zu kümmern, auf seine Umwelt reagiere, mit ihr in Interaktion trete, Moleküle aufnehme und diese dann falsch interpretiere, ja, so eine Allergie sei eigentlich ein sehr einprägsames Sinnbild für all die anderen unangenehmen Folgen, die so ein Sommer auf das Leben in jener Alters- und Entwicklungsstufe habe. Und dazu kämen natürlich noch die Proximitätsproblematik und das individuell unterschiedliche Zonenverhalten, was sehr häufig zu enormen nervlichen Belastungen der Kinder führe, so Dr. Rudolph. Besonders sei ihm noch der Fall von Felix und Max im Gedächtnis, letztes Jahr. Felix sei heute nicht mehr am Institut, aber zumindest in der Verbreitung von proximity awareness in der Bevölkerung aktiv.
Dr. Rudolph wiederholte den Satz auf eine eigentümliche Weise, fast so, als sei es ein Mantra oder eine sprachliche Konvention wie das eilig hinter den Namen eines Verstorbenen gesetzte Gott hab ihn selig.
Und dann natürlich Max, sagte Dr. Rudolph, das sei ein wirklich ungewöhnlicher Fall, weil niemand etwas spüren konnte, zumindest anfangs nicht, er leide wahrscheinlich an einer ganz seltenen Spielart der Proximitätsverzerrung.
— Manchmal stellt die Forschung ihre Kinderschuhe eben zu früh in den Schrank.
— War das derselbe Max, den wir vorhin …?
— Jaaa, sagte Dr. Rudolph und nickte stolz.
— Aha.
— Der Felix ist inzwischen reloziert, aber beim Max ist das Problem weniger ein hormonell –
— Entschuldigung, aber was bedeutet reloziert?
Dr. Rudolph schaute mich erstaunt an.
— Locus. Lateinisch für der Ort. Relokation. Relozieren.
— Also meinen Sie, er ist in eine andere Schule versetzt worden?
— Nun ja, sagte Dr. Rudolph. Das könnte man so sagen. Wissen Sie, Herr Seitz, die Welt funktioniert für Kinder mit eingeschränkten sozialen Optionen ein wenig anders als für uns. Wie ich immer sage: Es gibt keine Happy Ends in solchen Dingen. Aber Fair Ends kann man doch verlangen. Fair Ends, wissen Sie?
Ich nickte.
— Fairends, wiederholte Dr. Rudolph lachend. Fairends! Darauf kann man sich immer verlassen. Dass die eintreten.
Es schien für ihn etwas Wohltuendes in diesen Worten zu liegen. Fast wie eine süße Erinnerung, die er damit verband.
Wir gingen wieder durch den schmalen Korridor in Richtung Garten. Als wir durch die Tür ins Freie traten, sah ich in einiger Entfernung zum Gebäude zwei Jugendliche, die sich miteinander unterhielten. Wie zwei Landvermesser standen sie einander gegenüber und gestikulierten. Ihre Stimmen waren nicht zu hören. Je länger ich sie beobachtete, desto unsicherer wurde ich, was an ihren die mündliche Kommunikation ergänzenden Gebärden so beunruhigend wirkte. Dann wurde mir klar, dass es ihre Sanftheit sein musste. Besonders eine Geste, die jeder der beiden in regelmäßigen Abständen ausführte, erinnerte mich an die Art, wie mir als Kind von einem Erwachsenen eine Bocciakugel oder ein anderes Spielzeug zugeworfen wurde: Man bewegte die Hand beinahe kraftlos — als wünschte man, es möge gar keinen Parabelflug des Objekts geben — nach oben und entließ den Ball in das Schwerefeld des Planeten, der dann für den Rest sorgte, für die Bahn und die Beschleunigung, bis in meine offenen Hände.
Das Zonenspiel
Die beliebtesten Sportarten unter den Schülern des Instituts waren Völkerball, Fußball, Tennis. Und einmal im Monat wanderten sie zu einem in der Nähe gelegenen Golfplatz und prügelten dort kleine kreideweiße Bälle über ein siebzehn Hektar großes Gebiet, aber dieser Service werde nicht von allen Eltern unterstützt, so Dr. Rudolph, im Augenblick seien nur drei Kinder aktive Golfer. Im riesigen Pausenhof (der von allen Bewohnern und Angestellten immer nur Garten genannt wurde) stand auch ein Tischtennistisch, aber auf ihm hatte jemand ein paar ineinandergesteckte Eimer abgestellt. Die etwas kleineren Eimer in die etwas größeren, so war eine Art blecherne Zikkurat entstanden, deren Zweck ich nicht erkennen konnte. Ein paar Kaffeetassen standen neben dem Turm auf der kaum Abnutzungsspuren aufweisenden Tischplatte.
Das Verhalten der Kinder im Garten zu erleben sei schon ziemlich beeindruckend, aber Dr. Rudolph meinte, dazu käme es in diesen Tagen nicht allzu oft. Es sei jetzt nicht die richtige Zeit dafür. Eher im Herbst, da stünden sie alle tatsächlich andauernd im Garten herum, Gott weiß, warum. Das Zonenverhalten verändere sich im Herbst nämlich in auffallender Weise, da seien die persönlichen Grenzen plötzlich nur mehr dazu da, ausgelotet zu werden. Wie Drahtmodelle von Molekülen bewegten sich die Schüler dann durch den Hof, die Abstände zwischen ihnen stets gleich haltend, als hingen sie an Verbindungsrohren aus Stahl. Ein menschliches Mobile. Manchmal werde einem da allein schon vom Zuschauen schwindlig, so Dr. Rudolph. Von seinem Fenster aus könne er das Mysterium fast den ganzen Oktober über betrachten und es erinnere ihn sogar an die herbstlichen Starenschwärme auf Jütland, die er als Kind einmal gesehen habe, gigantische, sich nach unbekannten Prinzipien übers Land hin bewegende, mal aufquellende, mal in sich zusammenfallende Wolken aus Vogelleibern, die einander im morphogenetischen Feldflug niemals berühren. Natürlich, die Kinder könnten schließlich auf ein mit jahrelangem Training für diese besondere Form alltäglicher Bewegungskunst verbrachtes Leben zurückblicken, und wenn man diesen Faktor bedenke, erscheine einem das Schauspiel schon wieder um eine ganze Ecke weniger mysteriös. Aber trotzdem, sagte Dr. Rudolph, es werde ihm immer ganz sonderbar, wenn sie sich auf diese Art hin und her bewegten und miteinander redeten, als sei das alles ganz normal. Als hätten sie hinten und vorne Augen. Oder Fühler. Oder eine Art Spinnennetz um sich, und einer braucht bloß an einer Stelle zu zupfen, schon wissen die anderen genau, wo er gezupft hat. Und niemals, bis auf den trivialen Ausnahmefall von Mobbing oder einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jungen, würde einem von ihnen schlecht, nein, das käme niemals vor, nicht einmal eine Schwindelattacke, niemals stoße einer an eine Mauer und werde so in die Zone eines Kommilitonen gedrängt, wenn dieser Punkt erreicht sei, bilde sich einfach ein neues Muster. Schon bemerkenswert und ungeheuerlich, mit welchen Situationen sich der Mensch zu arrangieren verstehe. Und dann komme auch noch eine solche Geometrie dabei heraus, die einem den Atem nehme. Sogar im Inneren der Erde können wir wohnen, sagte Dr. Rudolph, in vollkommen lichtlosen Verhältnissen, in Gegenden mit verpesteter Luft und giftigem Wasser, auf Polarstationen im ewigen Eis oder in Klöstern in Tausenden Metern Meereshöhe, wo der Sauerstoffgehalt der Luft so niedrig ist, dass sich alle Menschen zu Gott bekehren.
Читать дальше