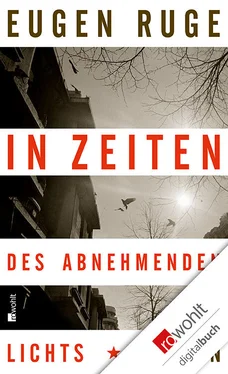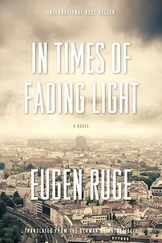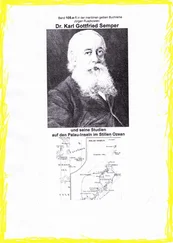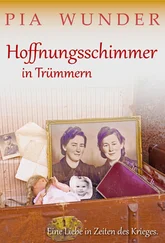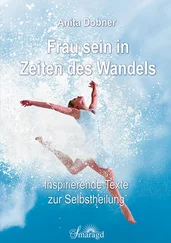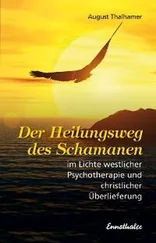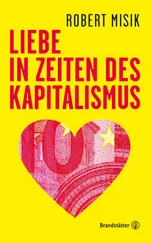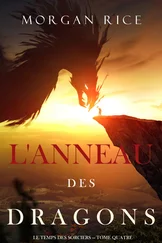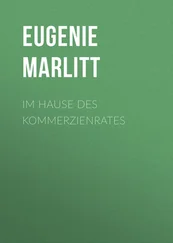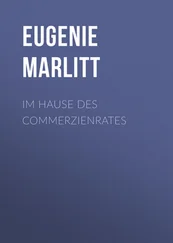Am Nachmittag, wenn die heißeste Stunde des Tages sich nähert, wird Alexander die losen Blätter wieder ins Schachbrett packen und zum Gästehaus aufsteigen. Der Motorradrocker wird ihn, als er ihn mit dem Schachbrett unter dem Arm kommen sieht, zu einer Partie auffordern, und Alexander wird zustimmen, obwohl die Nachmittagsschläfrigkeit ihm schon die Augen zuzudrücken beginnt.
Wie immer, wenn sie Schach spielen, werden sie sich, um ungestört zu sein, auf die Bank hinter dem Frida-Kahlo-Trakt setzen, wo Alexander sonst die Zeitung vom zwölften September liest, seitlich einander zugewandt, das Schachbrett zwischen ihnen, leicht geneigt, wie die Sitzfläche.
Alexander wird mit f2–f4 eröffnen, einer aggressiven, etwas leichtsinnigen Variante, die er oft — und anfangs mit Erfolg — gegen Kurt gespielt hat. Der Motorradrocker wird ganz unaufgeregt mit d7–d5 antworten, und Alexander wird, auch um einem späteren Dame h4 vorzubeugen, den Springer, den vor mehr als einem halben Jahrhundert ein Häftling aus dem Holz einer sibirischen Zeder geschnitzt hat und bei dem, seit Alexander denken kann, die Schnauze fehlt, nach f3 ziehen.
Die Hühner der mexikanischen Angestellten werden hinter dem Maschendrahtzaun im fruchtlosen Sand herumpicken.
Alexanders Gedanken werden, während er mechanisch 2. … c5, 3. e3 e6, 4. b3 Sc6, 5. Lb2 Sf6 und 6. Ld3 spielt, noch einmal zu jenem fernen Wintertag zurückkehren: zu den vereisten Gehwegen auf der Schönhauser, zu dem merkwürdigen, ziellosen Gang, zu der Afrika-Szene … Aber plötzlich wird der Film weitergehen: Alexanderplatz, kalter Wind. Das alte, längst nicht mehr existierende Automatenrestaurant links neben der Weltzeituhr — ist das möglich?
Der Motorradrocker, der übrigens Xaver heißt, wird sich nach der beiderseitigen Rochade weit über das Brett beugen, sodass sein Kopf das halbe Spielfeld verdeckt, und Alexander wird, um nicht auf die rötliche Haut sehen zu müssen, die an den lichten Stellen zum Vorschein kommt, seinen Blick in die Ferne richten und sich, während der Kopf des Motorradrockers nachdenklich über der Stellung zu wippen beginnt, plötzlich an Details erinnern: an die damals modernen, aber schon abgeschabten Stehtische aus Sprelacart; an den metallenen Tresen; an den Geruch von — war es Kesselgulasch? Er wird Kurt sehen, in seinem Lammfellmantel und seiner biederen Pelzmütze, an einem jener Sprelacart-Tische stehend und seine Suppe löffelnd; er wird sich selbst sehen, von außen: kahl geschoren, in seinem zerschlissenen Parka und — unglaublich, auch das weiß er noch! — in jenem blauen, mehrfach und in nicht ganz passender Farbe geflickten Pullover, den zu tragen er damals für nötig befand, weil er das unerklärliche Bedürfnis verspürte, abstoßend zu wirken.
Der Motorradrocker wird Dame b6 spielen, und Alexander wird schon im Moment, da der Motorradrocker gezogen hat, spüren, dass er nicht die nötige Konzentration aufbringen wird, um diesen eigentlich plumpen, kaum ernstzunehmenden Angriff auf seine durch die Eröffnung f2–f4 leicht entblößte Königsstellung zu entkräften.
Nach der Schachpartie, die er nach dem siebzehnten Zug aufgegeben haben wird, wird er sich in die Hängematte vor seiner Zimmertür legen. Er wird sich mit den Fingerspitzen am Terrassengeländer abstoßen, wird seine vom Laufen ermüdeten Sehnen und Muskeln spüren, und während die Schwerkraft ihn in die Arme nimmt, werden allerlei Gedanken unkontrolliert in seinem Kopf umherspringen, Kolumbus wird ihm einfallen, der die Hängematte nach Europa gebracht hat, und der Gedanke, es könnte sich um eines der größten Missverständnisse zwischen den beiden Kulturen handeln, dass Kolumbus beim Anblick des indianischen Hängebetts nichts anderes sah als eine effektive Möglichkeit, Matrosen in Schiffen zu stapeln, wird Alexander für einen Augenblick als große Entdeckung erscheinen; auch wird er sich fragen, ob er gleich hätte Läufer d5 spielen sollen; noch einmal wird ihm der hässliche, mehrfach und in nicht ganz passender Farbe geflickte Pullover einfallen, und er wird sich fragen, wieso es so schön, sogar tröstlich ist, sich daran zu erinnern.
Dann werden die Palmenblätter aufgehört haben zu rascheln. Verstummt sein wird das Schreien und Lachen im Dorf und das Geklapper in der hauseigenen Küche. Die Motoren werden schweigen, und schweigen werden auch die Radiostimmen, die sonst zu allen Tageszeiten aus den Lautsprechern einer gerade eröffneten Bankfiliale herüberschwappen.
Einzig das Knirschen der Hanfseile wird noch zu hören sein. Und das gleichgültige, ferne Rauschen des Meeres.
Von den fünfziger Jahren über das Wendejahr 89 bis zum Beginn des neuen Jahrtausends reicht dieser Roman einer Familie. Im Mittelpunkt drei Generationen: Die Großeltern, noch überzeugte Kommunisten, kehren aus dem mexikanischen Exil in die junge DDR heim, um dort ihren Anteil am Aufbau der neuen Republik zu leisten. Ihr Sohn, als junger Mann nach Moskau emigriert und später in ein sibirisches Lager verschleppt, tritt die Reise vom anderen Ende der Welt, dem Ural, an. Er kehrt mit seiner russischen Frau zurück in eine Kleinbürgerrepublik, an deren Veränderbarkeit er weiterhin glauben will. Dem Enkel wird die Wahlheimat von Eltern und Großeltern indes zusehends zu eng — bis er, ausgerechnet am neunzigsten Geburtstag des Patriarchen, in den Westen geht. Die Strahlkraft der politischen Utopie scheint sich von Generation zu Generation zu verdunkeln: Es ist die Zeit des abnehmenden Lichts.
Ein halbes Jahrhundert gelebter Geschichte, ein Deutschlandroman voll überraschender Wendungen und Details: groß durch seine menschliche Reife, seine Genauigkeit, seinen Humor.
Eugen Ruge, 1954 in Soswa (Ural) geboren, studierte Mathematik an der Humboldt-Universität und wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralinstitut für Physik der Erde. Er war beim DEFA-Studio für Dokumentarfilm tätig, bevor er 1988 aus der DDR in den Westen ging. Seit 1989 arbeitet er hauptberuflich fürs Theater und für den Rundfunk als Autor und Übersetzer.
2009 wurde Eugen Ruge für sein erstes Prosamanuskript «In Zeiten des abnehmenden Lichts» mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet.
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Umschlaggestaltung: ANZINGER | WÜSCHNER | RASP, München
Umschlagabbildung: Stockwerk/Plainpicture
Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital — die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
ISBN Buchausgabe 978 — 3 — 498 — 05786 — 2 (1. Auflage 2011)
ISBN Digitalbuch 978 — 3 — 644 — 01411 — 4
www.rowohlt-digitalbuch.de