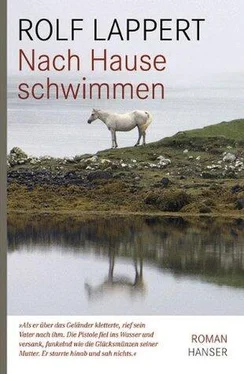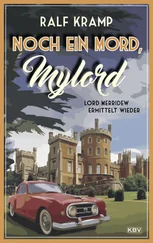Ich stehe da mit der Zuckerdose in den Händen und sehe auf das Stück Flur im Türrahmen, den roten fusseligen Teppich, die zerkratzte, mit schwarzen Striemen bedeckte Wandleiste und die Tapete, deren Blau fleckig ist, ein Himmel voller Risse und gekritzelter Botschaften. Dann ertönt, begleitet vom Ächzen des erwachenden Fahrstuhls, Aimees Stimme:»Kommst du?«
Der Speiseraum ist so groß wie die Lobby, aber fensterlos. Von der Decke hängen weißschalige Lampen, deren Licht auf ein Dutzend Tische fällt. Die Stühle sind zusammengetragen, Holz, Metallrohr und Kunstleder, Plastik, jeder Tisch hat andere. An den Wänden hängen gerahmte, großformatige Schwarzweißfotos, Aufnahmen des Hotels aus besseren Tagen. Hinter einer Kantinentheke steht Madame Robespierre in ihrer weißen Uniform und der schwarzen Kopfbedeckung, die einem Cowboyhut für Kinder nicht unähnlich sieht. Randolph sagt, sie komme aus Haiti, Leonidas meint, sie sei Puertoricanerin, und Alfred und Mazursky tippen auf Mississippi oder Alabama, während Enrique behauptet, Madame Robespierre sei zweifelsfrei Kubanerin. Jeder hat für seine Theorie Erklärungen, aber nicht einmal Randolph, der die sechzig-, vielleicht siebzigjährige Frau eingestellt hat, Beweise. Das Essen, das sie mit dem wenigen Geld, das ihr zur Verfügung steht, jeden Morgen zubereitet und das ein wilder, sensible Mägen ignorierender Mix aus Cajun-Küche, Karibik und westlicher Fast-Food-Kultur ist, macht das Rätseln um ihre wahre Herkunft nicht einfacher, ebenso wenig wie die Tatsache, dass sie außer ein paar Worten melodischen Englischs keinen Ton von sich gibt.
Leonidas hat mir erzählt, dass es im Hotel bis vor einem halben Jahr noch ein Zimmermädchen gab, das Staub gesaugt und im Keller die Bettwäsche gewaschen und getrocknet hat. Als die Maschinen den Geist aufgaben, das Zimmermädchen eine alte Frau wurde und der Hotelbesitzer kein Geld für Neuanschaffungen lockermachte, verkündete Randolph, die Gäste müssten ab sofort ihre Zimmer selber sauber halten und die Bettwäsche auf eigene Kosten waschen lassen. Als Trost versprach er den maulenden Männern, Madame Robespierres Arbeitsplatz sei unantastbar.
Die Hälfte der Tische ist besetzt. Alfred schlingt Rühreier mit Schinken und Bohnen hinunter, Enrique schwitzt über einem Teller Eintopf und Reis. Mazursky kämpft mit einer Zeitung wie ein Tourist mit einem Stadtplan, während seine Krawatte in der Porridgeschüssel hängt. Elwood und ein alter Mann, der gelegentlich hier übernachtet und dessen Namen ich mir nicht merken kann, sitzen vor ihrer Tasse Kaffee und schweigen sich an, ein vom Leben ernüchtertes Ehepaar, das im Wartesaal die Abfahrt des Zuges verdämmert. Spencer, herausgeputzt wie zu einem Rendezvous, frühstückt englisch mit Tee und Toast und Orangenmarmelade, die er selber besorgt. Er nickt Aimee und mir zu und gießt dann Milch in seine leere Tasse.
Ich sage Madame Robespierre, dass Aimee mein Gast sei, und als sie mich fragend ansieht, lege ich kurz und eher pantomimisch meinen Arm um Aimee zum Zeichen unserer Zusammengehörigkeit. Madame Ro bespierre versteht und lacht und droht mir mit einem Schöpflöffel. Aimee lässt sich Spiegeleier geben und gebratene Tomaten und Würstchen und Bohnen in Tomatensoße und einen Stapel Toastbrot und dazu Kaffee. Ich bekomme mein übliches Kännchen Tee und eine Schüssel halbvoll mit Cornflakes. Wir setzen uns an den Tisch, an den ich mich vor fünf Tagen zum ersten Mal gesetzt habe. Leonidas, der sich nach dem Ende seiner Schicht mit einem Kaffee für den Heimweg stärkt, hatte mich aufgefordert, meinen Tee hier zu trinken statt alleine in meinem Zimmer. Der Tisch steht ein Stück weg von der Theke und ihren Gerüchen und den Männern, die schlürfen und schmatzen und dummes Zeug reden und sich mit Zahnstochern Fleischfasern zwischen den lockeren Brücken hervorpulen.
«Ist das alles?«fragt Aimee und deutet auf meine Cornflakes, die ich mit Milch übergossen habe. Doughnuts gibt es hier keine, dafür getrocknete Fische und grüne Papayas. Cornflakes, Toast und Haferschleim sind die einzigen Zugeständnisse, die Madame Robespierre an kontinentale Frühstücksgepflogenheiten zu machen bereit ist.
«Ja«, sage ich. Ich warte, bis sie isst. Ich kann nicht essen, wenn jemand am Tisch sitzt, es sei denn, dieser jemand isst auch. Wenn ich kaue, erscheint es mir unanständig laut, obwohl mein Mund geschlossen ist. Außerdem denke ich dauernd, dass mir Essensreste zwischen den Zähnen stecken oder in den Mundwinkeln kleben. Nach jedem Bissen wische ich mir mit einer Papierserviette die Lippen sauber und taste mit der Zunge diskret über die Zahnreihen.
«Du solltest mehr essen«, sagt Aimee. Sie tunkt ein Stück Brot in den Eidotter, steckt es zwischen die Lippen und leckt die Finger ab.»Was Richtiges. Nahrhaftes.«
«Damit ich groß und stark werde?«
Aimee sieht mich an, hört auf zu kauen und runzelt die Stirn.»Nein, damit du was im Magen hast«, sagt sie ernst und irgendwie vorwurfsvoll.»Die Arbeit hier ist bestimmt kein Spaziergang am Strand.«
«Ich esse zwischendurch was«, sage ich möglichst munter. Das mit dem groß und stark war dumm von mir. Aimee kann ja nichts von Pauline Conway ahnen. Davon, dass mich meine Mutterdarstellerin dauernd zum Essen genötigt hat. Der festen Überzeugung, dass zwischen meiner hageren Erscheinung und einem kräftigen Körper nur eine seit Jahren existierende Wüste des Mangels lag, die es in Begleitung einer Karawane aus Kohlehydraten, Fetten, Kalorien und Vitaminen zu durchqueren galt, hatte diese Frau so viel Essen vor mich hingestellt, dass die Fata Morgana meines zukünftigen Ichs vor meinen Augen in dampfenden Schleiern von Übelkeit verschwand. Ihr mit verbissener Fürsorglichkeit ausgearbeitetes Vorhaben, mich zu einem normalen Jungen zu mästen, scheiterte am Widerstand meiner Gene, und alles, was mir aus jener Zeit geblieben ist, sind chronische Appetitlosigkeit und Verstopfung. Drängt man mich dazu, ein Lieblingsgericht zu nennen, sage ich Reis mit Gemüse und Sojasoße. Aber eigentlich esse ich nicht gern, empfinde es nicht als lustvoll. Ich bin kulinarisch frigid.
Nach dem Frühstück geht Aimee. Sie will sich in der Bibliothek Zeitungsartikel ansehen, die über das Susan und Kate Caldwell Institut für Humanforschung berichten, die Stadt der Selbstmörder. Es ist kalt, aber es regnet noch immer nicht, und sie geht, eingehüllt in ihren Mantel und den Schal bis unter die Nase gewickelt, zu Fuß zur U-Bahn-Station. Die Nebenstraße, in der das Hotel liegt, ist fast menschenleer. Ein paar Autos fahren vorbei, langsam, als wüssten die Fahrer nicht, wohin sie wollen. Zwei schwarze Jugendliche stehen unter der hochgeklappten Kühlerhaube eines Wagens von der Sorte, wie ich sie aus vierzig Jahre alten Filmen kenne. Ein dritter sitzt hinter dem Steuer und raucht. Am Ende der Straße dreht Aimee sich um und winkt, und ich winke zurück.
Dann biegt sie um die Ecke. Winston sitzt mit einer erloschenen Zigarre im Mund vor dem Laden und sieht ihr nach. Als sie verschwunden ist, faltet er die Wolldecke, die über seinen Beinen gelegen hat, zusammen und erhebt sich, als sei eine Vorstellung zu Ende.
«Gleich regnet es«, verkündet er, bleibt einen Atemzug lang unschlüssig stehen und geht dann in seinen Laden.
Obwohl ich kaum Geld habe und mit der Arbeit beginnen sollte, folge ich ihm. Die Glocke, die über meinem Kopf an einem spiralförmigen Blechband hängt, klingelt, als die Tür hinter mir ins Schloss fällt. Der Laden ist ein langer Schlauch, der sich in der Mitte, wo Winston hinter dem Kassentisch sitzt, zu einem engen Korridor verjüngt, durch den man in den hinteren Teil gelangt, den Raum mit dem Plunder. Vorne, beschienen vom diffusen Licht zahlloser Deckenlampen, hat Winston seine Schätze auf Tischen und Regalen ausgebreitet. Vasen, bemalte Porzellankannen, Fotoapparate, bronzene Türklopfer, Kristallgläser, Spieldosen, Segelboote in Flaschen, dunkel angelaufenes Silberbesteck, mechanische Kaffeemühlen, Aschenbecher aus dem Ritz , handgeschliffene Karaffen, Operngläser, Flachmänner mit eingravierten Initialen, Parfümflakons mit paillettenbesetzten Zerstäubern, lange Reihen ledergebundener Bücher, Inseln aus Arztkoffern und Handtaschen, Schreibtischlampenwälder, Schallplattentürme.
Читать дальше